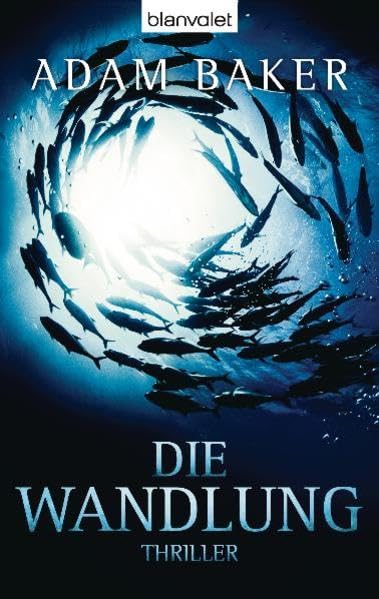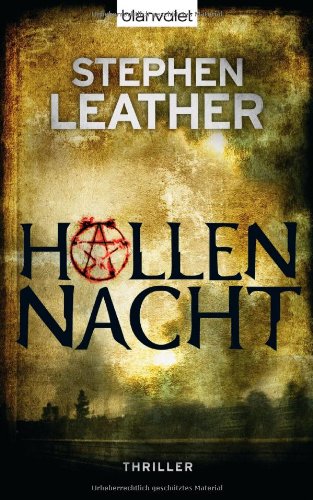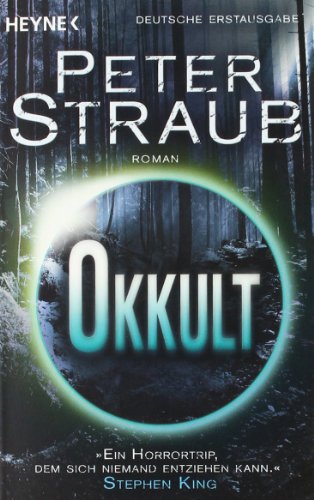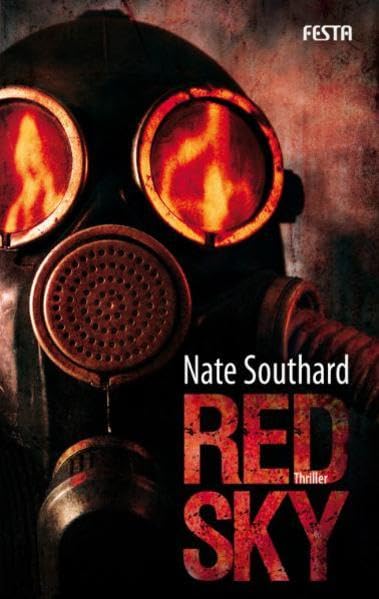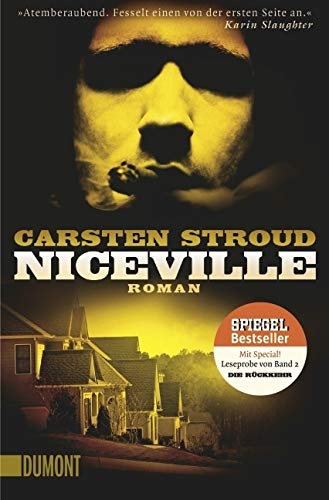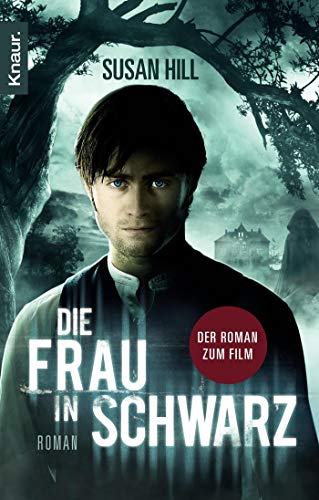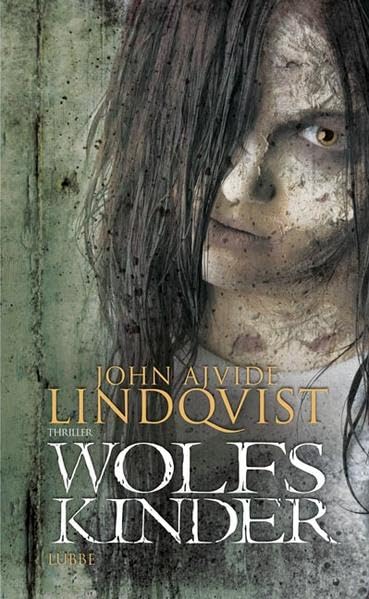_Das geschieht:_
Barrington House erhebt sich seit jeher in einer der besseren Wohngegenden Londons. In ruhiger Abgeschiedenheit leben hier reiche Menschen in einem der 40 Apartments, die auf dem Wohnungsmarkt praktisch unbezahlbar sind. Apryl Beckford kann deshalb ihr Glück kaum fassen, als ihr Großtante Lillian Archer das Apartment Nr. 39 vererbt. Der Kontakt zur verschrobenen Verwandten war schon vor vielen Jahren abgerissen, zumal Apryl im US-Staat New Jersey lebt. Bis ein Verkauf in die Wege geleitet ist, zieht die junge Erbin in die Wohnung und sichtet den Nachlass der Verstorbenen. Dabei stößt sie auf einige Tagebücher, die entweder den Wahnsinn der Tante oder einen Fall von Verfolgung aus dem Geisterreich dokumentieren.
Seth, ein brotloser Künstler, der sich seinen Lebensunterhalt als Nachtwächter in Barrington House verdient, glaubt längst an einen bösen Spuk. Er manifestiert sich im Apartment 16, das seit über 50 Jahren leer steht und nicht betreten werden darf. Dennoch hört Seth es während seiner nächtlichen Kontroll-Rundgänge dort umgehen. Die Erscheinungen werden manifester, und sie beschränken sich bald nicht mehr auf Barrington House. Seth beginnt die Geister jener zu sehen, die nach ihrem Tod zwischen Diesseits und Jenseits ‚hängen‘ blieben – armselige, böse Kreaturen, die es freilich in keiner Weise mit dem Grauen aufnehmen können, das in Nr. 16 lauert.
Auch Apryl wird inzwischen heimgesucht. Aus den Tagebüchern ihrer Tante kennt sie zumindest den Namen des bösen Geistes von Barrington House: Der Maler und Okkultist Felix Hesse fand hier 1949 einen grausamen Tod aber keineswegs sein Ende. Seitdem spuken er und seine nicht minder üblen Begleiter durch das Haus. Hesse will Rache, sie suchen nach Opfern – die ideale Basis für eine Zweckgemeinschaft der besonders grässlichen Art, die ihr Visier auf Apryl zu richten beginnt …
_Großes Haus mit dunklen Ecken_
Man kann und mag es kaum glauben, aber selbst in einer phantastischen Gegenwart, die von weinerlichen „Twilight“-Vampiren, plapperschnattrigen Freizeit-Hexen oder – offenbar als Kontrast – genetisch verdrehten, kannibalischen, wahnsinnigen Mutanten und Hinterwäldlern dominiert wird, gibt es noch einsame Rufer in der Wüste bzw. Autoren, die der klassischen |ghost story| die Treue halten. Adam Nevill beweist in „Apartment 16“, dass dieses ehrwürdige Genre längst nicht ad acta gelegt ist, wenn man die alten Regeln behutsam aber durchaus nachdrücklich hinterfragt und neu interpretiert.
Den Anhängern der eingangs gelisteten Grusel-Gestalten mag der Schrecken, der in einer scheinbar verlassenen Wohnung lauert, allzu zahm sein. Wer sich daran erinnert, dass „Horror“ sich nicht nur aus der Suche nach dem untoten Mr. Right oder aus Blut & Gemetzel, sondern auch aus einer besonderen Atmosphäre der Angst speisen kann, denkt anders und freut sich über eine Geschichte, die anderen Ansprüchen gerecht wird, ohne darüber in literarischen Sphären zu schweben: „Apartment 16“ ist kein Ort, an dem es nur vielleicht spukt und die Furcht auch auf Einbildung beruhen könnte. Hier geht es mit Pauken & Trompeten um, wenn man ein einprägsames Bild bemühen möchte.
Denn in Apartment 16 hat sich nicht einfach ein finster gestimmtes Gespenst eingenistet. Felix Hesses Ambitionen gehen über simple Rache weit hinaus. Er gehört zu zwar jenen Pechvögeln, die nach vielen Jahren einer entbehrungsreichen Suche tatsächlich fanden, was sie gesucht haben. Nun ist Hesse in jeder Hinsicht klüger und zorniger geworden.
|Das Jenseits als (Vor-) Hölle|
Hesses Informationsgier galt seit jeher der „Vortex“. Das Konzept einer Vorhölle, in der jene Seelen gefangen sind, die den ‚Aufstieg‘ in höhere und friedlichere Gefilde nicht schaffen, ist keineswegs neu. Autor Nevill verfügt jedoch über die notwendige Wortgewalt, diesen Ort anschaulich zu beschreiben. Der verhinderte Maler Seth – die zweite Hauptfigur – muss ihn stellvertretend für uns Leser erleben und erleiden. Die „Vortex“ wird zum verzerrten Spiegelbild einer Realität, die auf ihre negativen, bösen, unerfreulichen Seiten komprimiert wurde. Selbstmörder, Mordopfer und Mörder sind typische „Vortex“-Bewohner. Der arme Seth erlangt die Fähigkeit, sie zu sehen, wie sie an den Stätten ihres Todes immer wieder Qualen erleiden. Ihr Elend macht sie nicht nur hässlich, sondern auch bösartig.
Unter den Blinden ist offensichtlich auch im Jenseits der Einäugige König. Hesse fügt sich nicht in sein Schicksal. Auch ihn hat die „Vortex“ geprägt: Er ist noch gefährlicher geworden. Vor allem hat er das Potenzial dieser Sphäre erkannt. Hesse zwingt die verirrten Seelen unter seine Gewalt. Sie dienen ihm, wobei sich seine Macht nicht auf Barrington House beschränkt. In den Jahrzehnten seit seinem Tod konnte Hesse eine Art Bannkreis um das Gebäude ziehen, den jene, die dort wohnen oder arbeiten, nicht verlassen können.
Apartment 16 bildet nichtsdestotrotz das Zentrum des durch Hesse entfesselten und teilweise gebändigten Grauens. Hier hat er die „Vortex“ erforscht und in seinen Gemälden zu begreifen versucht. So gelang es ihm, seine alte Wohnung in ein Portal zu verwandeln, das ihm und seinen Nachtmahren den Weg in die Realität öffnet.
|Gefährliches Wissen: die nächste Generation|
Altes Unrecht zieht neues Unglück nach sich; dazwischen liegt eine Erkenntnisphase, die durch Recherchen geprägt ist: Auch Adam Nevill orientiert sich an diesem bewährten Handlungsgerüst, aber der Autor kennt jenen Ausweg, der „Variation“ heißt. Dieses Mal ist der Weg in die Hölle mit ungewöhnlichen Gemälden gepflastert. Auch diese Idee ist keineswegs originär; u. a. hat sich H. P. Lovecraft 1927 ihrer in „Pickman’s Model“ (dt. „Pickmans Modell“) sehr eindrucksvoll bedient.
Als eines seiner größten Vorbilder nennt Nevill indes nicht Lovecraft, sondern Montague Rhodes James (1862-1936), den Meister der englischen „ghost story“. In der Tat sind die Parallelen augenfällig. In erster Linie betrifft dies den Ingrimm, mit dem die Bewohner des Jenseits‘ die Menschen verfolgen. Unwissenheit schützt bei James keineswegs vor Strafe. Auch Hesse beendet seinen Rachefeldzug nicht, nachdem er alle bestraft hat, die ihn einst in den Mahlstrom der „Vortex“ warfen. Das Böse benötigt irgendwann keine Begründung mehr; es existiert für sich und aus sich heraus.
Aus Seth macht Hesse einen Gefolgsmann, aus Apryl ein Opfer. Kapitelweise springt Nevill von einer Figur zur anderen. Lange bleiben die beiden Handlungsstränge isoliert. Erst im Finale laufen sie zusammen. Bis es soweit ist, verwandelt sich Seths Leben in einen Leidensweg, während Apryl parallel dazu die Mechanismen entschlüsselt, die Hesse die Existenz nach dem Tod ermöglichen.
|Fluch mit Fragen|
Dieser Mittelteil ist Nevill zu lang geraten. Viele interessante aber für die Handlung wenig relevante Episoden unterbrechen vor allem Apryls Weg zur Erkenntnis, während Seth ein wenig zu oft zwischen grotesken „Vortex“-Kreaturen umherirrt und sich graust. Zudem fehlt eine schlüssige Begründung, wieso Hesses Wirken sich auf Apartment 16 beschränkt, wenn seine Macht sich doch bis auf Londons Straßen hinaus erstreckt.
Gelungen sind Nevills Charakterisierungen von Personen, die von der Gefangenschaft, zu der Hesses Spuk sie verdammt hat, zunehmend in den Wahnsinn getrieben wurden. Natürlich ist Barrington House darüber hinaus besonders stark von verlorenen Seelen befallen: Hesses Opfer, die er schon früher erwischen konnte. Vergangenheit, „Vortex“-Realität und Gegenwart beginnen sich vor allem für Seth immer stärker zu vermischen, bis sie miteinander verschmelzen – ein Prozess, den Nevill anschaulich gruselig zu beschreiben weiß.
Das Finale ist vorgegeben: Die Pforten der „Vortex“-Hölle werden sich öffnen und Hesse endlich ausspucken. Auch hier vermag der Autor dem Geschehen einige unerwartete Wendungen einzuflechten. Dass dem Bösen von Apartment 16 nicht wirklich ein Ende bereitet werden kann, dürfte keine Überraschung sein. Sehr modern bleibt auch ein Happy End aus. Faktisch wird sich der Mikro-Kosmos von Barrington House neu bilden. Die „Vortex“ wird um einige Unglücksraben reicher sein und neue Opfer fordern. So ist es logisch, so hat es schon M. R. James gern gehalten und ist gut damit gefahren. Auch Adam Nevill ist – mit kleineren Abstrichen – jene gleichzeitig klassische und zeitgemäße |ghost story| gelungen, an der Susan Hill seit vielen Jahren scheitert.
_Autor_
Adam L. G. Nevill wurde 1969 im englischen Birmingham geboren. Er wuchs dort sowie auf der Insel Neuseeland auf, später studierte er an der schottischen Universität von St. Andrews. Nach seinem Abschluss schlug Nevill die Laufbahn eines Schriftstellers ein. Es schlossen sich 15 Jahre entsprechender Versuche und ein Leben am Rande des Existenzminimums an, in denen sich Nevill u. a. mehrere Jahre als Pförtner und Nachtwärter in West-London durchschlug; die hier gesammelten Erfahrungen flossen 2010 in den Roman „Apartment 16“ ein.
Seinen ersten Phantastik-Roman, eine Gespenstergeschichte in der Tradition des englischen Großmeisters M. R. James, veröffentlichte Nevill bereits 2004: „Banquet for the Damned“ wurde 2005 von der „British Fantasy Society“ als bester Roman des Jahres nominiert.
Hauptberuflich ist Adam Nevill Herausgeber für erotische Literatur. Nachdem er in dieser Position bis Juni 2009 für „Virgin Books“ tätig war (und selbst neun Romane für Imprints wie „Black Lace“ und „Nexus“ schrieb), wechselte er nach Einstellung dieser Reihen zu „Xcite Books“.
|Paperback mit Klappenbroschur: 494 Seiten
Originaltitel: Apartment 16 (London: Pan 2011)
Übersetzung: Ronald Gutberlet
ISBN-13: 978-3-453-52876-5|
|eBook (epub): Mai 2012 (Wilhelm Heyne Verlag)
733 KB
ISBN-13: 978-3-641-07511-8|
http://www.adamlgnevill.com
http://www.randomhouse.de/heyne
_Adam Nevill bei |Buchwurm.info|:_
[„Im tiefen Wald“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7551