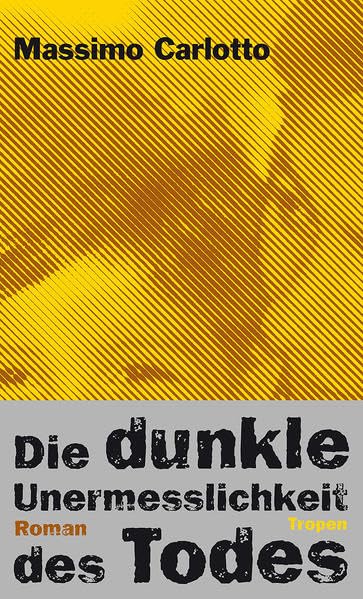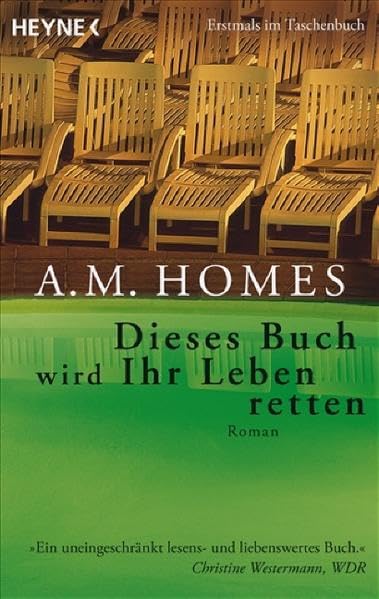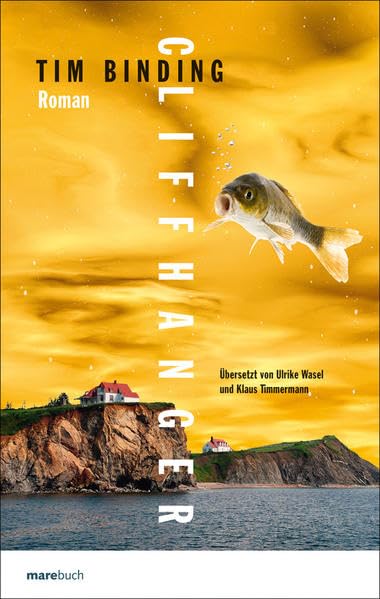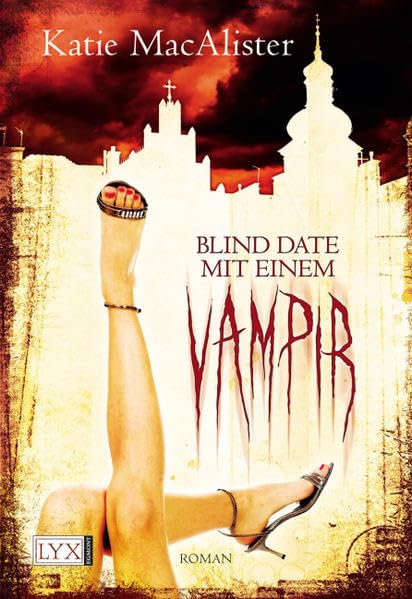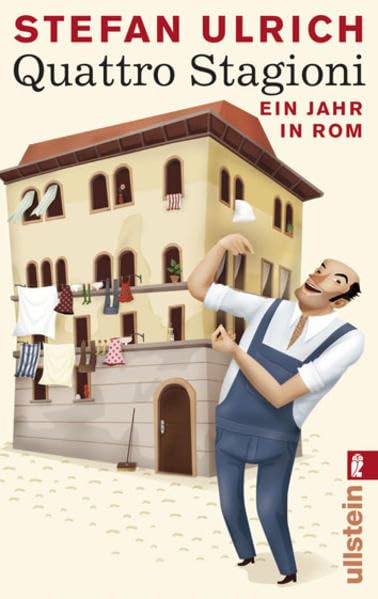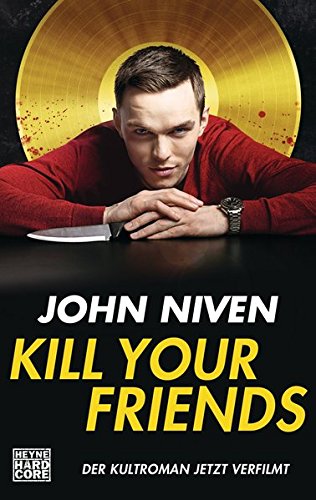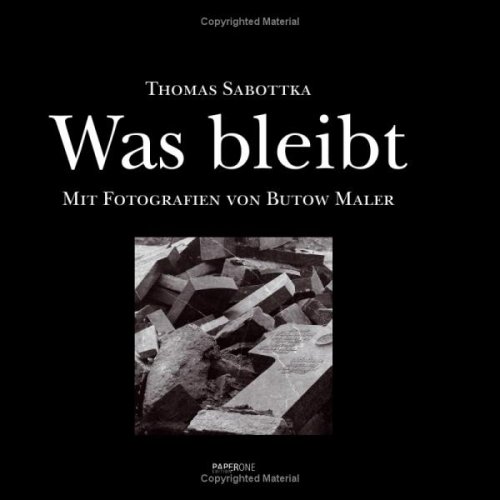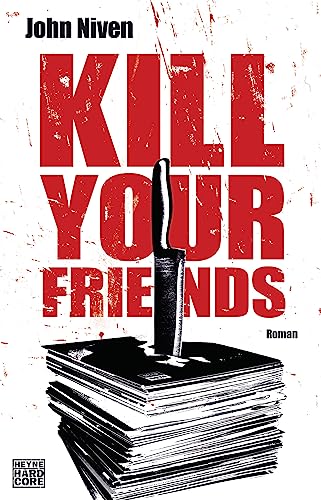Isabel Allende, chilenische Bestseller-Autorin mit Wohnsitz in San Fancisco, geht mittlerweile stark auf die siebzig zu, und doch scheint sie keineswegs müde. Erst letztes Jahr erschien ihr farbenprächtiger historischer Roman [„Inés meines Herzens“, 4229 und auf den aktuellen PR-Fotos, die auf ihrer Homepage einsehbar sind, lacht sie strahlend in die Kamera. Vielleicht ist Allende ja tatsächlich ein bisschen altersweiser geworden, verspürt den Wunsch nach Reflektion ihres Lebens stärker denn je. Doch gleichzeitig ist sie immer noch leidenschaftlich, spleenig und ein erzählerischer Wirbelwind.
Ihr neuestes Buch, „Das Siegel der Tage“, knüpft lose an ihren großen Erfolg „Paula“ an, einem romanhaften Brief an ihre sterbende Tochter Paula, der ihr die Geschichte der Allendes – also ihre eigene Geschichte – näherbringen soll. „Paula“ ist ein intimes Buch, ein Buch, das vom großen Mut seiner Autorin zeugt, sich der Geschichte, dem Schmerz und dem eigenen Leben zu stellen. „Paula“ zu lesen, ist ergreifend, auch weil durch all die Trauer um die verlorene Tochter die unglaubliche Stärke dieser Isabel Allende durchscheint.
„Das Siegel der Tage“ nun ist eine Art Fortsetzung; wieder beginnt Allende mit einem Adressat an ihre Tochter. Diesmal ist es eine Reminiszenz an deren Beerdigung. Die vertrauliche Anrede, „du, meine Tochter“, wird der Leser des Öfteren während der Lektüre finden, doch die Verbindung ist lockerer. Allende kehrt immer wieder zu Paula zurück, doch das erlebte Leid ist nicht mehr so allgegenwärtig wie in „Paula“.
Was geschah also nach Paulas Tod? Wie ging es mit der Familie weiter? Genau das, und vieles mehr, packt Allende in ihren langen Brief. Sie erzählt von der lähmenden Trauer nach Paulas Tod, dem Stillstand in ihrem eigenen Leben. Sie erzählt, wie diese Zäsur fast ihre Ehe zerstört hätte. Kurzum, sie erzählt, wie es mit der Sippe weitergeht. Dabei gibt es längst nicht nur Happy Ends, doch auch in katastrophalen Situationen, die das Potenzial haben, eine Familie komplett zu zerstören, verliert Allende nie den unerschütterlichen Glauben daran, dass sich alles irgendwie und irgendwann zum Positiven wenden wird. Es ist diese Grundeinstellung, dieser unverwüstliche Wunsch nach Leben, der sich bei der Lektüre unweigerlich auf den Leser überträgt. Und dieses Feel-Good, trotz aller Widrigkeiten und Probleme, ist eines der Geheimnisse von Isabel Allendes Prosa.
Isabel Allende schart eine große Familie um sich, nicht nur ihre leibliche, sondern auch eine angeheiratete und „adoptierte“ (so hat sie kein Problem damit, auch enge Freunde zur Sippe zu zählen). Diese unorthodoxe Großfamilie bietet ihr einen perfekten Spielplatz, um „Das Siegel der Tage“ mit erheiternden, spannenden, komischen, mitreißenden und persönlichen Anekdoten zu füllen. Der Leser erfährt tatsächlich ziemlich genau, was seit Paulas Tod im Leben der Allende passiert ist. Einiges davon kennt man schon, anderes ist neu, und es ist wohl auch diese Melange aus Bekanntem und Neuem, die beim Leser den Eindruck erweckt, zum Plausch bei einer guten Freundin eingeladen zu sein. Sie sieht ihren Leser als Freund, dem man auch Geheimnisse anvertrauen kann, und als Leser kann man sich des Eindrucks der Demut nicht erwehren, dass einem solcherart Ereignisse so offen und ehrlich anvertraut werden.
Die Kritik hat ihr das offensichtlich übel genommen. Die Rezensentin der |Süddeutschen Zeitung| sieht den Voyeurismus des Lesers bedient und spricht erschrocken von „Intimitäts-Terror“. Das sei alles nur ein einfaches Herunterschreiben von Familiengeschichten, an dem nichts Erdachtes zu finden sei – was in ihren Augen offensichtlich ein Qualitätsmakel ist. Dabei wird ein aufmerksamer Leser längst gemerkt haben, dass Isabel Allendes Bücher schon immer (auto)biographisch waren. Mal mehr, mal weniger hat sie Familienmitglieder verfremdet und zu Protagonisten gemacht – im „Geisterhaus“, im „Unendlichen Plan“, in „Paula“, in [„Mein erfundenes Land“ 2979 – überall findet sich der Allende-Clan wieder. Es ist gerade ihre Stärke, Biographien in Romane und Profanes in Literarisches zu verwandeln. Bei der Veröffentlichung von „Paula“ wurde ihr dafür noch applaudiert, bei „Das Siegel der Tage“ ist das gleiche Prinzip plötzlich anrüchig? Wohl kaum …
„Das Siegel der Tage“ trägt weder den Untertitel ‚Roman‘ noch ‚Autobiographie‘, und das aus gutem Grund, denn es ist weder das eine noch das andere. Sicher, die Charaktere existieren – sie sind Familie und Freunde der Autorin. Doch zu welchem Grad sie und ihre Lebenswege fiktionalisiert wurden, das bleibt das Geheimnis der Autorin, die sich persönlich keinen Deut um den Zusammenhang zwischen Fiktion und Realität schert. „Jedes Leben kann wie ein Roman erzählt werden, wir sind alle Hauptfiguren unserer eigenen Geschichte“, sagt sie relativ am Anfang des Buches, um daraufhin den Beweis ihrer These anzutreten. „Meine Darstellung der Ereignisse ist eigenwillig und überspitzt“, heißt es später. Solche kleinen Einwürfe sollten dem Leser eigentlich Hinweis genug sein, um einschätzen zu können, inwieweit er hier eine Intimschau der Autorin vor sich hat.
Zugegeben, „Das Siegel der Tage“ wird sicherlich hauptsächlich für Leser interessant sein, die Allendes Bücher kennen und mehr über die Autorin erfahren wollen. Sie rekapituliert nicht nur die fünfzehn Jahre seit Paulas Tod, sondern gibt auch Einblick in ihr Schaffen. Wie schreibt sie? Wie findet sie Stoffe? Wie entstehen ihre Romane und wie empfindet sie Lesereisen? Doch am beeindruckendsten ist zu sehen, dass die starken Protagonistinnen, die Allende gern auftreten lässt, keineswegs unerreichbare Heldinnen sind. Isabel Allende lebt diese unerschütterliche Stärke vor. Sie kämpft, sie liebt und sie steht wieder auf, wenn sie gefallen ist. Sie hat ihre Schwächen (es scheint, als wäre sie als Schwiegermutter ein echter Drachen) und sie ist nicht immer erfolgreich. Aber ihr Durchhaltewillen und ihre Leidenschaft – in allen Dingen des Lebens – machen sie, genauso wie ihre Bücher, so unglaublich bemerkenswert.
|Originaltitel: La Suma de los Días
Aus dem Spanischen von Svenja Becker
409 Seiten, gebunden
ISBN-13: 978-3-518-42010-2|
http://www.suhrkamp.de
_Mehr von Isabel Allende auf |Buchwurm.info|:_
[„Zorro“ 1754
[„Mein erfundenes Land“ 2979
[„Inés meines Herzens“ 4229
[„Im Bann der Masken“ 605
[„Die Stadt der wilden Götter“ 1431
[„Im Reich des goldenen Drachen“ 1432