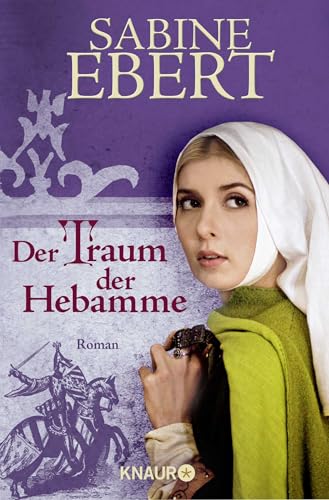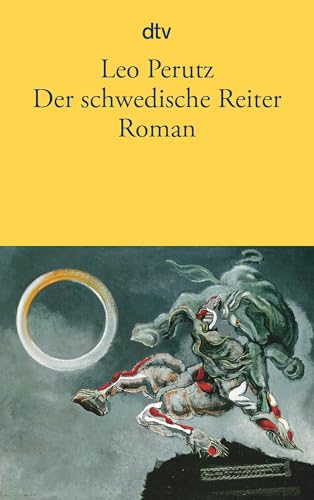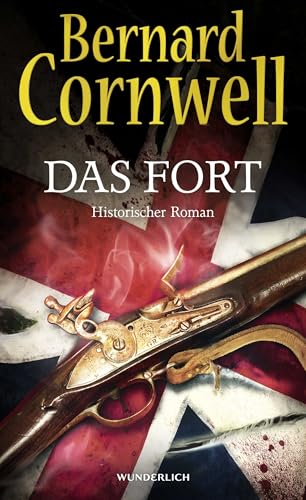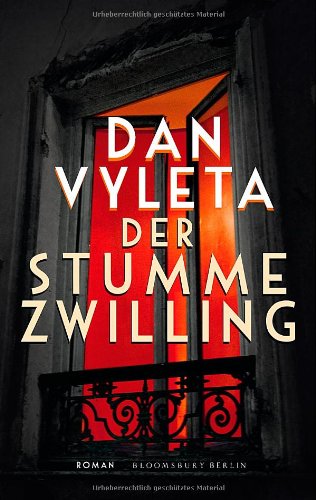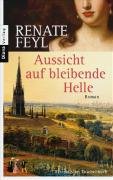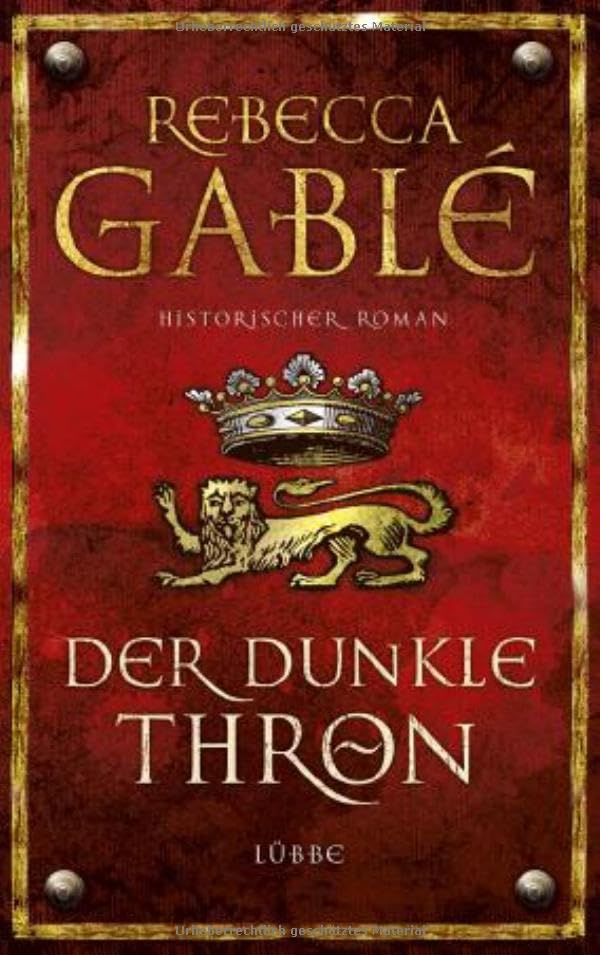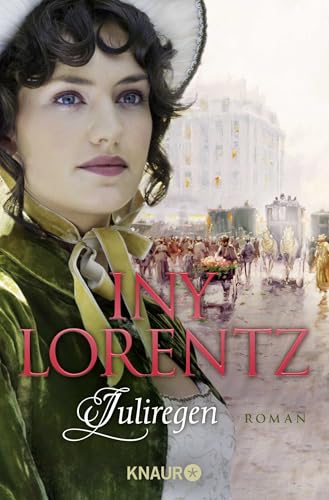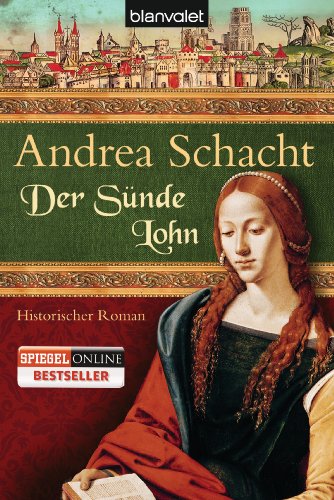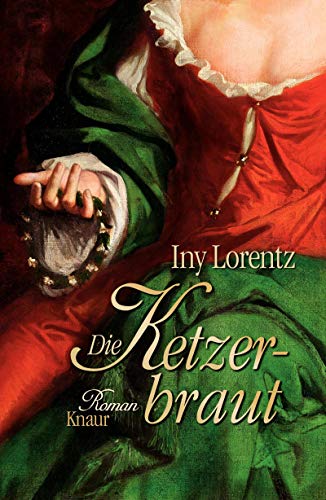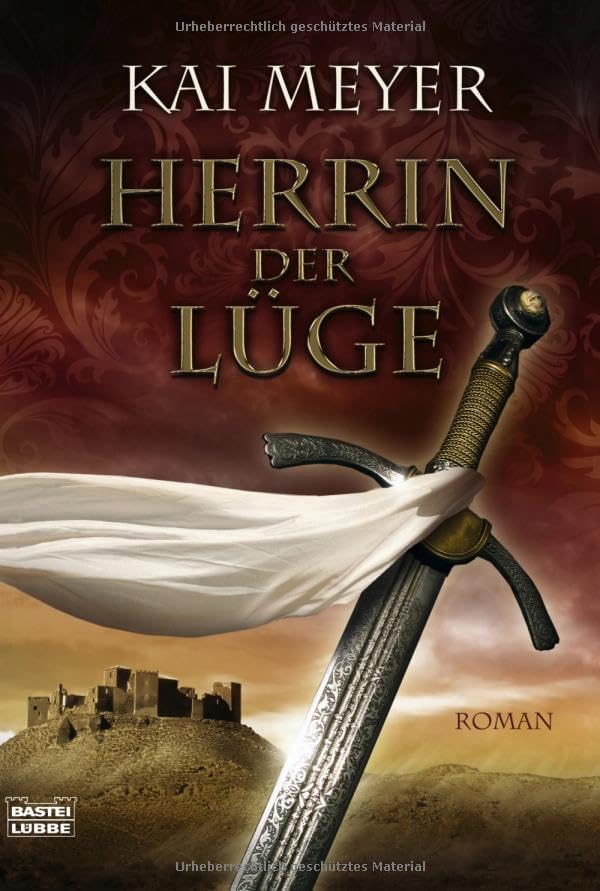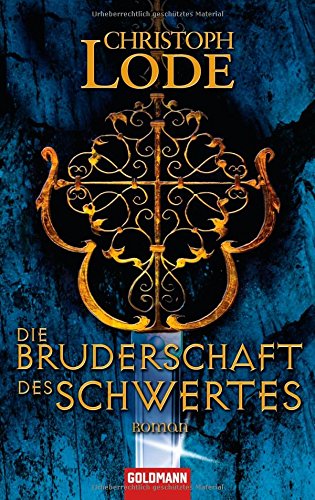_|Die Hebamme|:_
Band 1: [„Das Geheimnis der Hebamme“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6864
Band 2: [„Die Spur der Hebamme“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6871
Band 3: [„Die Entscheidung der Hebamme“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6878
Band 4: [„Der Fluch der Hebamme“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6883
Band 5: _“Der Traum der Hebamme“_
_Desillusioniert kehrt Marthes Sohn Thomas_ im Herbst 1191 vom Kreuzzug zurück. Doch auch in der Heimat findet er keinen Frieden, denn dort herrscht der grausame Albrecht über die Mark Meißen. Als dieser seinen Bruder Dietrich, an dessen Seite Thomas im Heiligen Land gekämpft hat, angreift, bleibt beiden keine andere Wahl, als erneut zu den Waffen zu greifen. Die Lage scheint aussichtslos, deshalb muss Dietrich ein Zweckbündnis mit dem Landgrafen von Thüringen eingehen. Dafür fordert dieser die Verlobung Dietrichs mit seiner Tochter. Ein hoher Preis, denn Dietrich liebt seit Langem heimlich Marthes Tochter Clara … (Verlagsinfo)
_Kritik_
Mit „Der Traum der Hebamme“ findet die Reihe um Hebamme Marthe und das frühe Freiberg seinen Abschluss. Wie gewohnt präsentiert uns Sabine Ebert ein ausgezeichnet recherchiertes Stück deutscher Geschichte. Ob es die Probleme des einfachen Volkes sind, oder die Belange der Grafen und anderem Adel, die Autorin versteht es meisterhaft, an diesen teilhaben zu lassen. Authentisch beschriebene Kleidung, Kampftechniken, Benimmregeln lassen die Zeit des endenden zwölften Jahrhunderts wieder aufleben. Ob die Lebensumstände der verschiedenen Stände, Kampftechniken, die unstandesgemäße Liebe zweier Darsteller und deren Folgen, Machtspiele, die Autorin hat vereint, was einen guten historischen Roman ausmacht.
Sabine Ebert fügt ihre Darsteller perfekt in die historischen Ereignisse der damaligen Zeit ein. Mit einem lebendigen Erzählstil erzählt, fällt es leicht, dem Geschehen zu folgen. Zeitgemäße Dialoge fügen sich angenehm in den schlichten Schreibstil ein. Geschickt verwebt Sabine Ebert die fiktive Geschichte von Marthe, Lucas und Clara mit den historischen Ereignissen der damaligen Zeit. Nebenhandlungen passen sich perfekt dem Plot an und ergänzen die Rahmengeschichte sinnvoll. Schnell findet der Leser Anschluss an die vorangegangenen Ereignisse und ist so wieder mitten im Geschehen. Obwohl die Autorin nur im Ansatz auf die vergangenen Ereignisse zu sprechen kommt, wird genug übermittelt, um diese wieder in Erinnerung zu haben.
„Der Traum der Hebamme“ spielt in der Zeit von 1191 bis 1197. In vier Teilen erlebt der Leser, mal zeitlich sehr dicht und dann auch mal in Zeitsprüngen von mehreren Monaten, die Entwicklung der verschiedenen Ereignisse. Da werden Kriege geführt, ein erneuter Kreuzzug steht an und auch das Leben im sächsischen Freiberg wird ausführlich behandelt.
Erzählt aus der Perspektive eines Beobachters, der den Fokus immer mal wieder auf eine andere Person lenkt, bekommt der Leser einen guten Überblick der verschiedenen Ereignisse. Der Blickwinkel liegt dabei vor allem auf Dietrich, Graf von Weißenfels, Marthe und Lukas sowie Marthes Kindern Clara und Thomas. Weiterhin lässt der Erzähler auch Ereignisse aus Freiberg nicht aus. Auch wenn die Perspektive so öfter wechselt, bleibt es für den Leser leicht nachvollziehbar und verständlich.
Schon durch die kämpferische Handlung kommt es zu spannungsgeladenen Szenen. Aber auch zwischenmenschliche Belange sorgen dafür, dass der Leser kaum aus der Geschichte auftauchen mag. Schnell fiebert man mit den liebgewonnen Figuren mit und hofft auf ein gutes Ende.
Auch wenn die Figurenzeichnung sich an der schwarz – weiß – Methode orientiert ist es der Autorin gelungen lebendige und dreidimensionale Charaktere zu erschaffen. Seid nunmehr fünf Bänden existieren die ansprechenden Protagonisten und entwickeln sich immer weiter. Über den Zeitraum von insgesamt 30 Jahren haben wir Leser die Entwicklung vieler Figuren miterleben dürfen, Trauriges, Lustiges, Ernstes. Haben Geburten von Kindern miterlebt und Tote betrauert. In Kämpfen mitgefiebert, von grausamer Folter gelesen und von Liebe erzählt bekommen. Geheimnisse gehütet und Verrat und Missgunst miterlebt. Kein Wunder, dass uns dabei viele der Figuren wahrlich ans Herz gewachsen sind. War es im ersten Band noch hauptsächlich Marthe, von der geschrieben wurde, sind in den weiteren Bänden immer wieder neue und unverzichtbare Personen, ob fiktiv oder historisch belegt, hinzugekommen und so verlagerte sich auch der Fokus.
Die Aufmachung des Buches ist wieder insgesamt gelungen. Angefangen mit einem ansprechenden Cover, auf dem wir eine standesgemäß und authentisch gekleidete Frau sehen über Karten, Figurenregister, Zeittafeln, Stammbäume und Nachwort. Die Dramatis Personae sind unterteilt nach Handlungsspielräumen beziehungsweise Heimat. Durch Kennzeichnung wird deutlich gemacht welche historisch belegt sind und welche der Fantasie der Autorin entspringen. In einem ausführlichen Nachwort geht Sabine Ebert noch einmal auf die belegten historischen Ereignisse ein und erklärt, wo sie auf das wahrscheinlichst Mögliche zurückgreifen musste. Eine korrekte Zeittafel und genealogische Tafeln vervollständigen die Aufmachung.
_Autorin_
Sabine Ebert wurde in Aschersleben geboren, ist in Berlin aufgewachsen und hat in Rostock Sprach- und Lateinamerikawissenschaften studiert. In ihrer Wahlheimat Freiberg arbeitete sie als Journalistin für Presse, Funk und Fernsehen. Sie schrieb einige Sachbücher zur Freiberger Regionalgeschichte, doch berühmt wurde sie mit ihren historischen Romanen, die alle zu Bestsellern wurden.
_Fazit_
Wieder einmal hat es Sabine Ebert geschafft, auf äußerst unterhaltsame Weise ihren Lesern einen Blick in das Leben Ende des 12. Jahrhunderts zu gewähren. Gründliche Recherche, ein passender und nachvollziehbarer Erzählstil sowie die lange lieb gewonnenen Figuren fesseln an die Geschichte. Leser, die sich für deutsche Geschichte interessieren, sollten auf jeden Fall zu den Büchern der Hebammensaga greifen. Nicht nur bekannte Aspekte werden dort behandelt, auch so manche Überraschung wartet darauf entdeckt zu werden. Mit „Der Traum der Hebamme“ ist der Autorin der krönende Abschluss ihrer zurecht beliebten Mittelalter Saga gelungen.
Nach dieser absolut empfehlenswerten Reihe freue ich mich schon jetzt auf die Geschichte der Völkerschlacht von Leipzig, die passend zur Zweihundertjahrfeier 2013 veröffentlicht wird.
|Taschenbuch: 720 Seiten
ISBN-13: 978-3426638378|
[www.droemer-knaur.de]http://www.droemer-knaur.de/home
_Sabine Ebert bei |Buchwurm.info|_
[„Blut und Silber“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6068
[„Interview“]http://buchwurm.info/artikel/anzeigen.php?id=115