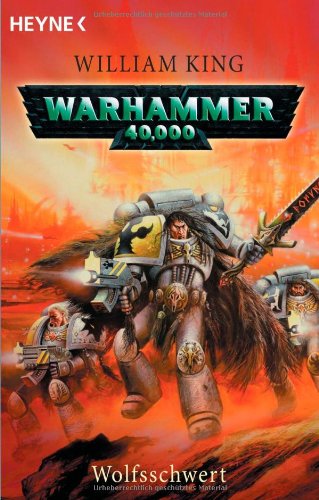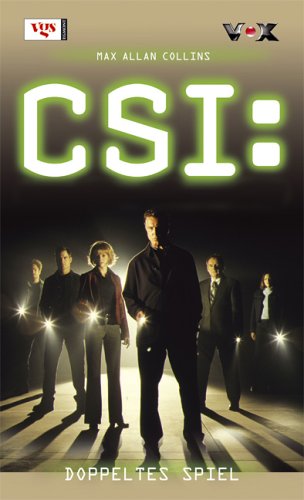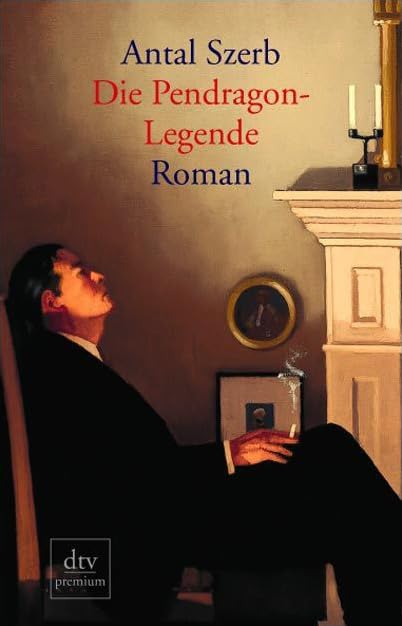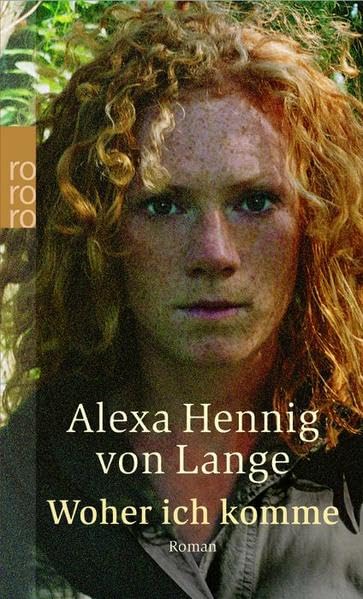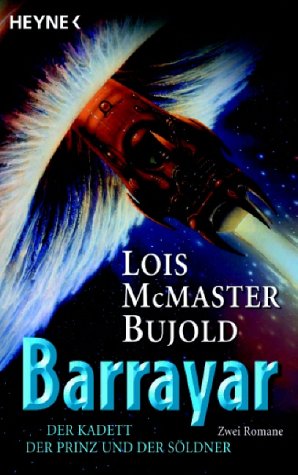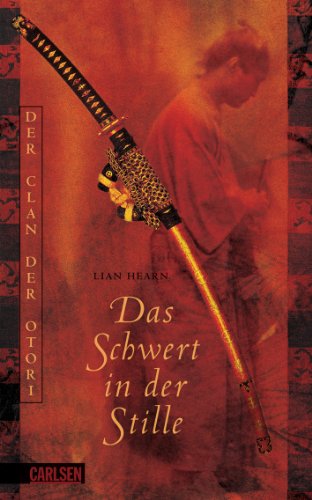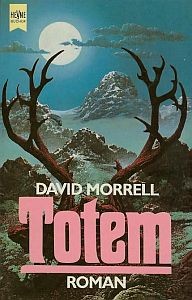Archiv der Kategorie: Rezensionen
Armstrong, Tim J. – Kelch der Könige, Der
Nachdem Tim J. Armstrongs Erstlingswerk „Die Bruderschaft“ in Großbritannien mit dem begehrten |Author’s Club First Novel Award| ausgezeichnet wurde, durften die Erwartungen an sein zweites Buch „Der Kelch der Könige“ hoch sein.
Dieses zweite Werk des Autors führt uns ebenfalls ins Mittelalter: Man schreibt das Jahr 1261, als Wilfridus, Kurat eines kleines Dorfes in der englischen Grafschaft Kent, im Rahmen der Untersuchungen des Dominikaner-Ordens seine Erlebnisse des Jahres 1235 niederschreibt. Zu dieser Zeit – als er selbst noch ein junger Dominikaner war – hat er als Adlatus und Schreiber seinem Mentor Thomas dabei geholfen, Beweise gegen die deutsche Adlige Cäcilia, die unter Verdacht der Ketzerei steht, zu sammeln.
So hören die beiden nahezu Tag für Tag die Lebensgeschichte einer bemerkenswerten Frau, die in ihrer Jugend mit Walter von der Ouwe (uns heute bekannt als Walther von der Vogelweide) von ritterlichen Idealen und der Minne geträumt hat, die Nonne war, eine Visionärin und auch Ehefrau und Mutter.
Doch um diese Untersuchung herum steht die Welt nicht still. In einem Templerorden geschehen mehrere Morde. Ein Prior gräbt nachts in der Kapelle einen Kelch aus, dessen Intarsien-Steine einem kabbalistischen System folgen. Ein Jude mit finanziellen Kontakten zum Königshof und einem Alchemisten-Keller wird verhaftet. Und Bruder Thomas erhält Drohungen und kurz darauf verschwinden seine Geliebte und seine Kinder. Und immer wieder wird klar, dass ein Zusammenhang besteht zwischen all diesen Ereignissen und ihren Untersuchungen der Domna Cäcila. Doch worin genau besteht dieser Zusammenhang? Und warum liegt jemandem so viel daran, dass Cäcilia als Ketzerin verbrannt wird?
Der Autor greift viele wichtige Themen jener Zeit auf: Es geht um Minnesang, Religionen und Ketzertum, Kabbala und Alchemie. Damit bezieht er nicht nur eine dieser komplexen Thematiken in seine Geschichte ein, sondern gleich mehrere. Und das wird auf den Kreis der Leser, die überwiegend nicht in allen diesen Gebieten vorgebildet sein werden, verwirrend wirken. Zwar geht Armstrong auf einige Themen – insbesondere den Glauben der Katharer – sehr gründlich ein und erklärt sie gut verständlich, andere sehr komplexe Themen, wie insbesondere die Kabbala, werden aber ohne weitere Erläuterung eingebracht und ihre Bedeutung – auch für den Sinn der Geschichte – bleibt dem Leser zu einem großen Teil ein Rätsel. Ebenso fühlt sich der Leser mit dem Ende, das – obwohl nicht offen – doch viele Fragen stehen lässt, etwas im Stich gelassen.
Auch die Teilung der Geschichte in drei verschiedene Handlungszeiträume (die Zeit, in der Wilfridus die Geschichte niederschreibt, die Zeit der Untersuchung an Domna Cäcilia und als dritte Zeitspanne die Lebensgeschichte der Domna Cäcilia) trägt dann nicht gerade zur Verständniserleichterung bei.
Der geschichtliche Hintergrund ist jedoch für einen historischen Kriminalroman, der primär ein Unterhaltungswerk sein soll, mehr als hinreichend recherchiert und überzeugend dargestellt. Der Autor gibt sich hier keine erkennbare Blöße und zeichnet im Gegenteil ein breit angelegtes Bild des Mittelalters in verschiedenen Ländern auf eine glaubhaft erscheinende Weise mit der genau richtigen Mischung aus erfundener, aber „zeitgemäßer“ Geschichte und realistisch erscheinendem zeitlichen Rahmen.
Durch den verwendeten Erzählstil des Rückblicks werden von Beginn an gewisse Andeutungen zum Verlauf der Geschichte gegeben. Das weckt an einigen Stellen die Neugierde auf den Verlauf der Geschichte, andererseits werden dadurch auch gewisse Ereignispunkte vorab ungeschickt und spannungshinderlich enthüllt.
Die deutsche Übersetzung liest sich für ein Buch, das in diesem Zeitrahmen spielt, angenehm flüssig. Autor und Übersetzer haben hier ganze Arbeit geleistet. Die Sprache klingt ungekünstelt und zurückhaltend neutral, so dass die Geschichte selbst umso mehr in den Vordergrund rücken kann. Es sind auch nur wenige lateinische und religiöse Wörter eingeflochten, deren Bedeutungen einem halbwegs interessierten Leser nicht sofort klar sind.
Zwar handelt es sich bei „Der Kelch der Könige“ um mehr als einen reinen historischen Kriminalroman, der Krimianteil überwiegt aber knapp. Mit „Der Kelch der Könige“ hat Armstrong ein gutes Buch vorgelegt, das von der ersten bis zur letzten Seite spannend ist. Die Verstrickung der Personen und Ereignisse untereinander nehmen den Leser gefangen und katalpultieren ihn zugleich in eine andere Zeit. Auch die schrittweise Lösung des Falls durch Wilfridus und Thomas ist spannend beschrieben, das Ende des Buches jedoch eine regelrechte Antiklimax mit einer Menge offener Fragen; der Aha-Effekt bleibt fast vollständig aus.
Punktabzug in der B-Note erhält das Buch für die Erzähl-Figur des Wilfridus. Auch nach 383 Seiten „seiner“ Erzählung bleibt er für den Leser eine unbekannte Größe, während andere Personen – allen voran Cäcilia, Walter von der Ouwe und Bruder Thomas zu den wahren Hauptpersonen des Buches aufsteigen. Ebenfalls als kleines Minus müssen ein Zuviel des Buches an mystischem Inhalt und ähnlichem Gedankengut sowie eine Anzahl offener Fragen nach Ende des Buches verbucht werden. Statt Templer, Judentum, Musiktheorie, Katharer, Katholiken, Kabbala, Minnesang und Alchemie der Reihe nach in teilweise unbefriedigender Weise abzuhandeln, hätte der Autor einige dieser Thematiken streichen und sich den verbleibenden etwas intensiver widmen sollen. Insgesamt ist Armstrong aber trotz der genannten Kritikpunkte ein guter, spannender und teilweise auch bewegender Mix aus historischem Roman und Mystery-Krimi gelungen.
King, William – Wolfsschwert (Warhammer 40.000: Ragnar-Zyklus Band 4)
Ragnar ist bei den Wolflords von Fenris in Ungnade gefallen, nachdem er im Kampf gegen Magnus, den Primarchen der Thousand Sons, den heiligen Speer des Russ eingebüßt hat. Dennoch erscheint die Strafe, die ihm auferlegt wird, im ersten Moment vergleichsweise milde: Er wird auf den Heimatplaneten der Menschheit, Terra, abkommandiert, um dort in den Reihen der Wolfsklingen dem Navigatorenhaus Belisarius, das durch jahrtausendealte Verträge eng mit dem Orden der Space Wolves verbunden ist, zu Diensten zu sein.
Doch wie so oft trügt der erste Anschein. Zwischen den Häusern Belisarius und Feracci herrscht seit langem ein Krieg, der im Verborgenen mit Verrat, Intrigen und Attentaten geführt wird. Während des Transits zum Heimatplaneten kann Ragnar im letzten Moment den Mord an Gabriella Belisarius verhindern und am Ziel seiner Reise – Terra – muss er erfahren, dass die Wiege der Menschheit in keiner Weise dem glorreichen und ruhmreichen Bild in den Erzählungen seines Ordens entspricht: Moralische Verkommenheit und Dekadenz auf der einen Seite und die gnadenlose Ausbeutung von Menschen in den ewig-dunklen und verseuchten Schluchten der Makropolen auf der anderen lassen die harten Bedingungen auf Fenris geradezu friedlich und paradiesisch erscheinen; die Clans der Space Marines werden von den normalen Bürgern gehasst und auch die Wolfsklingen, der zynische Torin und der fette Haegr, scheinen weit von den Idealen seines Ordens entfernt.
Als ein Auftrag sie gegen religiöse Fanatiker führt, erkennen die drei Marines, dass der Arm der Verräter weit in das verbündete Haus reicht und sie froh sein können, wenn sie mit dem Leben davonkommen. Angesichts einer Übermacht aus Hunderten Zeloten und einem mächtigen Psioniker, bleibt ihnen nur die Flucht auf die untersten Ebenen der Makropole und die Hoffnung, dass es ihnen gelingen wird, sich an die Oberfläche zurückzukämpfen. Angewiesen auf die Hilfe von Menschen, die ihnen misstrauen, und verfolgt von zahllosen Feinden beginnen sie ihren Aufstieg, während sich oben die Schlinge um den Hals der Celestarchin Lady Juliana Belisarius immer weiter zusammenzieht.
Einmal mehr beweist King, dass er sein Handwerk beherrscht und in der Lage ist, sowohl das komplexe WH40k-, als auch das WHFB-Universum zum Leben zu erwecken.
Die actionbetonte Handlung ist in gewohnt routinierter Art und Weise verfasst, Kings Schreibstil ist so gefällig und flüssig, dass der Leser gerne über kleine Schwächen in der Charakterisierung von Protagonisten und in der Dramaturgie hinwegsieht.
Haegr wirkt im wahrsten Sinne des Wortes überdimensioniert, seine obelixhaften Fressgelage vollkommen überzeichnet und selbst unter Berücksichtigung der außerordentlichen Space-Marine-Physiologie unglaubwürdig. Die Wortgefechte mit Torin sind zwar anfangs unterhaltsam, stellen aber mit Fortgang des Romans den Leser mehr und mehr auf die Geduldsprobe.
Etwas größeren Augenmerk hätte King auf den geheimnisvollen, übermenschlichen Assassinen Xenothan und dessen Verbindungen zur Inquisition richten können; hier verschenkt er einiges an Potenzial und vergibt die Möglichkeit, einen starken Antagonisten aufzubauen.
Dafür gewinnt Ragnar im Vergleich zu den ersten Romanen durchaus an Tiefe, wächst in seiner Auseinandersetzung mit dem bis ins Mark korrupten System Terras und der menschenverachtenden und intriganten Politik sowohl der Navigatorenhäuser im Besonderen, als auch des Imperiums im Allgemeinen. Selbst wenn er nach wie vor treu seinen mörderischen Dienst leistet, so beginnt doch der Zweifel in seinem Herzen zu nagen. Der Autor umschreibt diesen Sachverhalt sehr gelungen mit „Sünde der Relativierung“, wonach es keine per se wertvolleren Menschen gibt und die Leistung des Individuums immer im Kontext seines Umfeldes beurteilt werden muss. Ein kleiner Untersekretär der dritten Klasse in der Imperialen Fabrik Nummer sechs wäre demnach ebenso viel „wert“ wie ein Space-Marine-Veteran. Und diese Erkenntnis steht im fundamentalen Widerspruch zur grundsätzlich faschistischen Ideologie nicht nur der Space Wolves, sondern aller Orden.
Hinsichtlich der Dramaturgie scheint es im ersten Moment bedauerlich, dass der Ausgang des Konfliktes teilweise dadurch vorweggenommen wird, dass die eigentliche Geschichte eine Rückblende, eine Erinnerung Ragnars ist und die ursprüngliche Zeitebene des Prologs in einer unbestimmten Zukunft liegt. Andererseits bediente sich King schon in seinen ersten drei Ragnar-Romanen dieses nicht-linearen Konstruktionsprinzips, trägt also hier nur dem einheitlichen Erscheinungsbild der Reihe Rechnung. Und letztendlich verliert dieser Aspekt angesichts der mitreißenden Action und fesselnden Atmosphäre ohnehin an Bedeutung, weil es King mühelos gelingt, den dystopischen Charakter des Warhammer-40k-Szenarions einzufangen. Zwar reizt er nicht den zentralen Aspekt der Geschichte – die Intrigen zwischen den Navigatorenhäusern – bis in den letzten Dialog und die kleinste Szene aus, dennoch ist sich der Leser auf Grund einiger geschickt gesetzter Akzente der moralischen Verderbtheit jederzeit bewusst. Auch in der Schilderung der unmenschlichen Lebensbedingungen auf den unteren Ebenen beweist er genügend Augenmaß, um den Leser nicht mit einer Aneinanderreihung beschreibender Passagen zu langweilen, sodass dieser mit „Wolfsschwert“ einen zwischen Action und Stimmung sehr gut ausbalancierten Roman in den Händen hält.
Etwas, wofür nicht der Autor verantwortlich zeichnet, ist das schlechte Coverbild von Geoff Taylor. Daran, dass die Gestaltung der neueren Warhammer-40k-Romane grundsätzlich keine künstlerische Offenbarung darstellt, hat man sich ja schon gewöhnt, dieses Machwerk jedoch stellt alles bisher Gesehene in den Schatten: schlampige Ausführung, ohne Sinn für Perspektive, Proportionen und dynamisches Posing, sowie ein völliges Versagen in der Gestaltung von Gesichtszügen. Das ist insofern schade, als dieses stereotype, schlecht gearbeitete Bild durchaus potenzielle Leser vom Kauf eines unterhaltsamen Buches abschrecken könnte.
Fazit: Eine atmosphärisch dichter, temporeicher Warhammer-40.000-Roman, der sich in seinen düsteren Abschnitten durchaus mit den großartigen WH40k-Büchern Ian Watsons messen kann, der allerdings auch gute Kenntnisse des allgemeinen WH-Backgrounds voraussetzt.
|Originaltitel: Wolfblade
Übersetzer: Christian Jentzsch|
_Frank Drehmel_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [buchrezicenter.de]http://www.buchrezicenter.de/ veröffentlicht.|
Collins, Max Allan – CSI Las Vegas: Doppeltes Spiel
Eine Nacht wie jede andere in Las Vegas, der Stadt in der Wüste des US-Staates Nevada, die noch viel seltener schläft als New York. Gleich zwei Leichenfunde zur selben Zeit sind nichts Ungewöhnliches für das Team der „Crime Scene Investigation“ (CSI) des „Las Vegas Criminalistics Bureau“, das Tatorte sichert, Spuren untersucht und der Kriminalpolizei – meist verkörpert durch Captain Jim Brass von der Mordkommission, der früher selbst beim CSI war – zuarbeitet.
Wie üblich teilt man sich auf. Gil Grissom, leitender Beamter der Nachtschicht, und seine Kollegen Warrick Brown und Sara Sidle machen sich auf ins Beachcomber-Casino-Hotel. Dort ist ein Gast vor den Augen eines entsetzten Etagenkellners buchstäblich hingerichtet worden: Zwei Kugeln jagte der Killer präzise in den Schädel seines Opfers, bevor er unerkannt entkam. Doch Spuren hat er trotzdem hinterlassen, auch wenn wie so oft das gesamte fahndungstechnische Instrumentarium der CSI sowie das geballte Wissen seiner unkonventionell denkenden und arbeitenden Beamten gefordert ist, sie nicht nur zu entdecken, sondern auch zu entschlüsseln.
Nick Stokes und Catherine Willows, die beiden übrigen Mitglieder von Grissoms Team, mühen sich derweil auf einem Baugrundstück ab, wo unter einer wilden Müllhalde die vollständig mumifizierte Leiche eines Mannes entdeckt wurde, die dort wohl mindestens fünfzehn Jahre gelegen hatte. Hier wird es besonders schwierig, die Todesumstände zu rekonstruieren. Eines steht allerdings rasch fest: Mord beendete dieses Leben, genauer gesagt: zwei Kugeln, präzise in den Schädel gejagt …
Lange dauert es nicht, bis den CSI-Leuten die Übereinstimmung auffällt. Zunächst glauben sie noch einen makabren Zufall – bis auf Gil Grissom, der den Zufall generell ausklammert und nur handfeste Beweise gelten lässt. Nur mühsam gehen die Ermittlungen voran, aber ein erster Teilerfolg kann errungen werden: Die Mumie war einst Malachy Fortunato, 1985 plötzlich verschwundener Buchhalter in einem der großen Casinos, gleichzeitig ein Spieler – ein ungute Kombination, wenn man für das Syndikat arbeitet. Las Vegas war in den 80er Jahren noch fest im Würgegriff des organisierten Verbrechens. Gemeinsam mit Fortunato verschwand damals eine große Summe Mafia-Geldes, was seiner Witwe einige unangenehme Besucher ins Haus brachte. Doch sie war tatsächlich ahnungslos, und ihr Gatte womöglich auch.
Wer steckt also wirklich hinter dem Fortunato-Mord? Nach so vielen Jahren ist die Spur erkaltet, die Schar der Verdächtigen groß. Aber in den Labors der CSI setzt man allen Ehrgeiz daran, das Puzzle zusammenzusetzen – und vergisst darüber, dass die Karriere eines Killers durchaus länger als anderthalb Jahrzehnte dauern kann. Der „Deuce“, der die Köpfe seiner Opfer löchert wie die Zwei im Kartenspiel, ist jedenfalls noch sehr aktiv, und er beginnt jetzt allmählich nervös zu werden …
Bücher zu Filmen oder Fernsehserien, die zudem von der Vgs Verlagsgesellschaft herausgebracht werden, sollte man eigentlich meiden. Sie leben allein vom Ruhm der Vorlage, gelten den Studios als nettes Zusatzgeschäft und werden von fix schreibenden, aber minderbegabten Autorenknechten wie am Fließband produziert. Eile tut Not, ist doch das Verfallsdatum solcher „tie-in-Literatur“ identisch mit dem Zeitpunkt, an dem der Film aus dem Kino verschwindet oder die TV-Serie abgesetzt wird.
Zwei Gründe gibt es, das hier besprochene Werk trotzdem eines näheren Blickes zu würdigen. Da ist zum einen der Verfasser: Max Allan Collins hat zweifellos einen guten Namen als „tie in“-Autor, denn er produziert bei aller Hast solide Unterhaltungsware, die mehr ist als die bloße Nacherzählung eines Drehbuchs. Sein Name steht heute über unerhört zahlreichen Film- und Fernseh-Romanen, aber der wahre Leser kennt und ehrt Max Allan Collins als Autor vorzüglicher Kriminalromane, der mit seinen historischen Thrillern noch eines draufzusetzen vermag. Was? Noch nie davon gehört? Kein Wunder, denn Deutschland ist Collins-Diaspora. Man müsste eigentlich bitterlich klagen (oder fluchen): Während dieser Autor mit seinen Butter-aufs-Brot-Büchern in jedem Buchladen vertreten ist, werden seine wahren Kunstwerke nur noch in den Antiquariaten gehandelt – wenn sie denn überhaupt zu bekommen sind! Wer einmal einen der grandiosen Nate-Heller-Thriller gelesen hat, die das Chicago der 30er Jahre mit seinen selbst dem historischen Laien wohl bekannten Gangstern wieder aufleben lassen, wird süchtig nach diesem Stoff, der Reales und Erfundenes so meisterhaft mischt. Theoretisch gäbe es genug davon: Collins ist ein fleißiger Mann (der auch Elliot Ness, den berühmten „Unbestechlichen“, neue-alte Abenteuer erleben lässt). Davon werden wir in Deutschland allerdings nicht profitieren: Nachdem |Bastei-Lübbe| vor vielen Jahren fünf Heller-Bände publiziert hatte, startete der |DuMont|-Verlag in seiner „Noir“-Reihe einen weiteren Versuch. Die Zeit reichte gerade, den dürstenden Fan wie den sprichwörtlichen Tantalus mit einem einzigen neuen Abenteuer zu quälen, dann wurde die Reihe mangels Nachfrage eingestellt: Der deutsche Krimileser mag es lieber gemütlich und nicht gar zu aufregend. So müssen wir uns eben mit einem Collins aus zweiter Hand zufrieden geben.
Der zweite Punkt geht an die Serie: „CSI“ gehört eindeutig zu den besten Thriller-Shows des an Qualität in dieser Hinsicht nicht gerade armen US-Fernsehens. (Ich weiß, dass 99 von 100 amerikanischen Serien Bockmist sind, aber handwerkliche Professionalität und die schiere Quantität der ausgestoßenen Shows garantieren auch heute ein gutes Quantum Sehenswertes.) Die Storys sind krude, aber stets überzeugend, das Tempo rasant (Produzent: Jerry „Pearl Harbor“ Bruckheimer, sonst die Pest der Kinowelt, aber hier in seiner holterdipoltrigen Großkotzigkeit wohltuend gezügelt), die Effekte heftig. Dazu kommt das große Glück einer fabelhaften Besetzung. Zuvor eher unbekannte, aber TV-erprobte Darsteller formen eine Riege, der man einfach gern bei der Arbeit zuschaut. Besonders William L. Petersen als Gil Grissom ist eine Figur mit Ecken und Kanten, die nicht im Reagenzglas des TV-Labors für Instant-Quotenhits lieblos zusammengebraut wurde. Die Chemie stimmt zwischen den Männern und Frauen des CSI-Teams, obwohl sie tüchtig miteinander konkurrieren und streiten.
Collins schafft es, alle diese Punkte in seinen Roman zu retten. Während der Lektüre kann man vor dem inneren Auge einen CSI-Film „Doppeltes Spiel“ ablaufen sehen. Dabei hilft es maßgeblich, dass der Plot mit einer der überdurchschnittlichen TV-Episoden mithalten kann. Der ökonomisch arbeitende Verfasser greift auf die Ergebnisse früherer Recherchen zurück: Mit „The Million Dollar Wound“, dem vierten Nate-Heller-Roman (1986, dt. „Las Vegas 1946“) hatte Collins schon einmal die Geschichte der Casino-Stadt als Kulisse für einen Thriller genutzt. Sein Wissen hat er klug genutzt und ein leichtes, aber rundum lesenswertes Krimivergnügen realisiert, das sich der Genreliebhaber spätestens als nicht mehr gar so teures Taschenbuch auf die Leseliste setzen sollte.
Taylor, Stephen B. / Lueg, Lars Peter – Gruselmärchen mit Alptraumgarantie
|“Wie kommt man in der heutigen Zeit dazu, alptraumhafte Gruselmärchen zu schreiben?
Die Antwort liegt auf der Hand!
Nichts ist so fesselnd wie die pure Angst, die ein jeder Mensch auch heute noch in sich trägt. (…)“| (Lars Peter Lueg)
Und so verfassten Stephen B. Taylor und Lars Peter Lueg ihr erstes Hörbuch. Es entstand ein _“Gruselmärchen mit Alptraumgarantie“_ – vielmehr sieben an der Zahl, die geeint zu einer schaurigen Geschichte in diesem Hörbuch vertreten sind.
In einer Unwetternacht verunglückt ein junger Schriftsteller in einer abgelegenen, ländlichen Gegend mit dem Auto. Er entdeckt ein einsames Haus in der Nähe des Waldes, dessen Fenster hell erleuchtet sind. Dem jungen Autor scheint das Glück hold, gewährt ihm der Herr des Hauses doch Zuflucht am warmen Kamin und bietet ihm sogar an, ihn am folgenden Morgen mit in die Stadt zu nehmen. Dankbar ob der Gastlichkeit erklärt unser Gestrandeter sich bereit, aus seinem Manuskript vorzulesen – sechs schaurige Märchen hat er zusammengetragen, doch das siebente, welches ihm sein Gastgeber im Morgengrauen erzählt, wird sein ganzes Leben verändern …
_|Grusel| und |Märchen| – wie das wohl zusammenpasst?_
|Uns ist in alten mæren wunders vil geseit
von helden lobebæren, von grôzer arebeit,
von freuden, hôchgezîten, von weinen und von klagen,
von küener recken strîten muget ír nu wunder hœren sagen.|
Aus: Der Nibelunge Not (um 1200)
Hier gilt es wohl, zunächst ein wenig erklärend auszuholen: Das Wort Märchen ist ein Diminutiv zu dem heute veralteten Nomen |Mär| oder |Märe| (‚Kunde‘ oder ‚Nachricht‘) und wurde bis ins 19. Jahrhundert in der Bedeutung von ‚kleine Erzählung‘, aber auch im Sinne von ‚Gerücht‘ gebraucht. Der Wortstamm lässt sich jedoch bis zu den alten Germanen zurückverfolgen, deren Adjektiv |mar| so viel bedeutete wie ‚groß‘, ‚bedeutend‘, ‚berühmt‘. Im Alt- und Mittelhochdeutschen finden wir die Verben |maren| (ahd.) und |mæren| (mhd.), die man mit ‚verkünden‘ oder ‚rühmen‘ übersetzen kann.
Märchen sind frei erfundene kürzere Geschichten, die zumeist von wunderbaren Begebenheiten erzählen. Sie haben üblicherweise keinen direkten Bezug zu historischen Ereignissen, Orten oder Personen und sind zeitlich nicht festgelegt, wodurch sie sich von Sagen und Legenden unterscheiden. Das phantastische Element tritt in Form von sprechenden Tieren, verwunschenen Menschen in Tier- oder Pflanzengestalt, Hexen und Zauberern, Zwergen, Riesen oder Fabelwesen (Drachen, Einhörner etc.) in Erscheinung. Inhaltlich steht in der Regel eine heldenhafte Gestalt im Mittelpunkt, die sich mit natürlichen und übernatürlichen Ausprägungen des Guten wie auch des Bösen auseinandersetzen muss, um mit Herz und Geschick einem glücklichen Ausgang des Märchens entgegenzustreben. Diese Hauptfigur wird stets so beschrieben, dass die Zuhörerschaft sich mit ihr zu identifizieren vermag.
Alle volkstümlichen Märchen bedienen sich einer einfachen, eindimensionalen Erzählform, die es ermöglichte, die Geschichten von Generation zu Generation weiterzugeben. In vielen Märchen finden sich daher Sprichwörter und Redensarten.
Märchenhafte Erzählungen finden sich bei allen Völkern und waren ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Ausprägung. Wie alt Märchen tatsächlich sind, ist jedoch nicht geklärt.
Nun mag mancher denken, |Ich kenne die Kindermärchen der Gebrüder Grimm, die waren doch nicht gruselig, da hat immer das Gute gesiegt!|, und soweit es Kindermärchen betrifft, ist das wohl auch richtig, enden die meisten doch mit dem Satz |“Und so lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende.“| oder |“Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.“|. Diese Kindermärchen sind jedoch nur ein geringer Teil der Volksweisen, die überliefert wurden. Viele Märchen richteten sich an Heranwachsende und Erwachsene und dienten – neben einer vielleicht zu übermittelnden Botschaft – überwiegend der Geselligkeit.
Und so ist es in der heutigen Zeit kaum verwunderlich, dass auch das |Grauen| in einigen neueren Märchen seinen Platz findet. Während die klassischen Gespenstergeschichten eher den Mythen oder Legenden zuzuordnen sind, kann man die kurzen Geschichten eines H. P. Lovecraft durchaus als moderne Horror-Märchen bezeichnen.
_Gebrüder Grimm goes Horror_
Inspiriert von einer Originalausgabe der |Grimmschen Kinder- und Hausmärchen| aus dem Jahre 1812 kam Stephen B. Taylor (mit bürgerlichem Namen Steffen Schneider) die Idee zu diesem „Gruselmärchen mit Alptraumgarantie“. Für die Umsetzung stieg er tief hinab in die Katakomben seines Selbst, um dort die verborgenen Ängste zu ergründen und ans Tageslicht zu bringen. Zur besseren ‚Vorlesbarkeit‘ überarbeitete Lars Peter Lueg zusammen mit Stéphane Bittoun die Texte noch einmal und übernahm neben der Produktion auch die Regie. Die durchweg passende musikalische Untermalung stammt von den |Mountain Birds|.
Mit diesem Debüt-Werk, das im Herbst/Winter 2001 auf den Markt kam, fiel der Startschuss zu einer Reihe außergewöhnlicher Horror-Hörbücher aus der Schmiede von |LPL records|. Lars Peter Lueg wählt die Geschichten persönlich aus und sorgt für die notwendige dramaturgische Aufbereitung. Während er in den folgenden Jahren Oliver Rohrbeck, Sven Hasper und Frank Gustavus für die Regie verpflichtete, übernimmt er seit 2004 wieder selbst das Steuer.
_Eine Stimme, als käme sie direkt aus dem Fegefeuer_
Zum größten Teil verzaubert Stéphane Bittoun das Publikum und entführt die Hörerschaft in eine Welt des Grauens und der Angst. Dem |Gastgeber| jedoch leiht Lars Peter Lueg höchstpersönlich seine Stimme. Auf die Frage, wie es zu dieser Besetzung kam, antwortete LPL in einem Interview: |“Ich war schon für den Hessischen Rundfunk als Sprecher tätig, aber noch nie als Schauspieler! Aus Kostengründen war es uns einfach nicht möglich eine(n) weiteren Sprecher(in) zu engagieren. Daher musste ich einspringen. Da aber meine Stimme klingt, als käme sie direkt aus dem Fegefeuer war die Besetzung doch recht gelungen. Es hat sich jedenfalls noch niemand beschwert. ;-)“|
Dem habe ich nichts entgegenzusetzen, denn Anlass zu Beschwerden birgt dieses Hörbuch in keiner Weise. Ausgenommen vielleicht einer schlaflosen Nacht, wenn eine zart besaitete Seele dieses Märchen kurz vor dem Schlafengehen zu hören wünscht.
|Stéphane Bittoun| (geboren am 12. Februar 1970) ist seit 1997 für Rundfunk, TV und Film tätig. Neben Regie und Schauspielerei begeistert er sich auch für das Erzählen spannender und lebendiger Geschichten. Mit viel Liebe kleidet er sich in die verschiedenen Rollen und haucht ihnen Leben ein. Seine deutsch-französische Herkunft eröffnet ihm viele Möglichkeiten und so arbeitet er unter anderem für schauspielfrankfurt, ARTE, den Hessischen Rundfunk und das ZDF.
Lars Peter Lueg lebt und arbeitet in einem kleinen hessischen Dorf an der |Deutschen Märchenstraße|. Dort hört er „die verlorenen Seelen in der Ferne schreien, wenn der Wind des Nachts über die Dächer streicht.“ Nach erfolgreichen Jahren als Freier Mitarbeiter beim HR, Tourmanager und Musikproduzent entschied sich LPL letztendlich, die Menschen das Fürchten zu lehren und verzaubert uns seither mit seiner „Gänsehaut für die Ohren“.
Ich komme nicht umhin: Dieses Gruselmärchen wirkt wie eine gelungene Synthese aus alten Mären und dem subtilen Grauen eines H.P. Lovecraft. Zu guter Letzt bleibt mir nur noch, euch einen schaurigen Hörgenuss zu wünschen.
_CD1_
Der Anfang |(03:09)|
Eine Nacht auf dem See |(16:13)|
Der Trank |(16:14)|
Gevatter Tod |(24:24)|
_CD2_
Drei Uhr |(00:30)|
Frisches Fleisch |(14:01)|
Bruder Lukas |(17:49)|
Furcht |(36:25)|
Das Ende |(03:07)|
Michael Connelly – Schwarzes Echo
Der Lake Hollywood ist das Trinkwasserreservoir für die Großstadt Los Angeles. Die Hügel der Umgebung sind durchzogen von Zu- und Ableitungsrohren, die den Obdachlosen und Fixern der Umgebung einen willkommenen Unterschlupf bieten. Dass von diesen Untermietern immer wieder einer tot gefunden wird, ist ein Ärgernis, an das die Polizei gewöhnt ist. Als an diesem Sonntag anonym eine Leiche am Damm gemeldet wird, hat Hieronymus „Harry“ Bosch Bereitschaftsdienst. Er ist ein Vollblut-Kriminalist und auch nach vielen Polizeijahren nicht in Routine erstarrt. Bosch erkennt den Toten: William Meadows war vor zwanzig Jahren mit ihm Soldat in Vietnam, wo sie Seite an Seite den Vietcong im Gewirr jener Gänge bekämpften, die dieser tief unter der Erdoberfläche anlegte. Der mörderische Kampf in der Finsternis ließ eine verschworene Gemeinschaft entstehen ließ: die „Tunnelratten“.
Meadows gehörte zu den Veteranen, deren Psyche in Vietnam einen Knacks erhielt. Lange Jahre war er rauschgiftsüchtig, doch die Indizien, die auf eine Überdosis hindeuten, wurden manipuliert. Die Ermittlungen ergeben weiter, dass Meadows in einen spektakulären Bankeinbruch verwickelt war, der Los Angeles im Vorjahr in Atem hielt und bei dem die Täter mit einer Riesenbeute unerkannt entkommen waren. Michael Connelly – Schwarzes Echo weiterlesen
Hartmann, Christian / Hürter, Johannes – letzten 100 Tage des Zweiten Weltkriegs, Die
„Die letzten 100 Tage …“ bietet „Geschichte light“, d. h. als Mischung historischer Fakten und persönlicher Zeitzeugenberichte – leicht verständlich, mit „menschlichem Gesicht“, reich bebildert. Die Darstellung hakt nicht die üblichen „wichtigen“ Ereignisse ab, sondern schildert die letzten Kriegsmonate unter Berücksichtigung aller Beteiligten, Täter wie Opfer, Mitläufer wie Regimegegner, Befreier wie Befreite: ein sinnvoller Einstieg in eine komplexe Materie.
Chronologisch nähert sich die Darstellung ausgehend vom 30. Januar dem Kriegsende am 8. Mai 1945. In fünf Großkapitel gliedert sich der Text (Januar 1945, Februar usw.), von denen die Kapitel „Januar“ und „Mai“ naturgemäß recht kurz ausfallen. Jedes Großkapitel wird durch einen Text eingeleitet, der kurz das Gesamtgeschehen im jeweiligen Monat erläutert und Zusammenhänge herstellt. Jedem Einzeltag sind anschließend zwei Buchseiten gewidmet; dieses Schema wird streng durchgehalten.
Die Einzeltag-Einträge bilden in ihrer Gesamtheit keinen einheitlichen Überblick, denn die Spannbreite der angesprochenen Themen soll möglichst groß sein; sie schließt deshalb das militärische und politische Geschehen ein, berücksichtigt aber stets auch Kunst, Kultur oder Sport. Dem „großen“ Ereignis wird ebenso viel Raum gewidmet wie dem Alltäglichen und dem Einzelschicksal. Zu Wort kommt weniger zeitgenössische Prominenz, sondern der „kleine Mann“ bzw. die „normale Frau“ im Getriebe der Kriegsmaschinerie: der Flakhelfer, die Hausfrau, der KZ-Häftling, die Flüchtlingsfrau, der Kriegsgefangene u. a. Im individuellen Erleben spiegelt sich so der „Endkampf“ wider: primär als Kampf um das nackte Leben, als undurchschaubares Tohuwabohu auch aus alliierter Sicht, als Katastrophe auf allen Ebenen, die selbst den Beteiligten unbegreifbar erschien.
Unterhalb des Textblocks läuft über jede Doppelseite ein „Nachrichtenticker“: Weitere wichtige Ereignisse des Tages, die keine Berücksichtigung im Haupttext finden konnten oder sollten, werden hier im Telegrammstil aufgelistet. Selbst Hitlers Ende im „Führerbunker“ findet nur hier Erwähnung – es bildet nur einen der unzähligen Mosaiksteine, aus denen sich der Leser ein Bild von den letzten 100 Tagen des Zweiten Weltkriegs zusammensetzen muss.
Illustriert wird dieses Buch mit über 160 oft großformatigen Bilddokumenten und Karten, gedruckt auf qualitätsvolles Kunstdruckpapier und deshalb von bemerkenswerter Eindringlichkeit.
Zum 60. Mal jährt sich das Finale des II. Weltkriegs. Eigentlich endete dieser ja zweimal: am 8. Mai in Europa, am 2. September in Asien. Hartmanns & Hürters 100 letzte Tage beschränken sich indes auf den europäischen Schauplatz, was angesichts der Fülle des Materials sowie der Beschränkung auf einen historischen Überblick akzeptabel ist.
Denn „Die letzten 100 Tage …“ ist ein Sachbuch im klassischen Sinn: geschrieben nicht für Spezialisten, sondern für den Laien, der sich für die Geschichte interessiert, aber nicht durch allzu offensichtliches Fachlatein abgeschreckt werden möchte. Schon die historisch sinnfreie Begrenzung auf ausgerechnet 100 letzte Tage ist ein Zugeständnis an die Leserschaft. In diesem Sinne vermitteln die Autoren Wissen auf denkbar moderne Weise: Sie bieten „historische Häppchen“ an, die auch den intellektuell stets fluchtbereiten Mitgliedern der multimedialen MTV/Pisa-Generationen X, Y und Z munden dürften.
Wobei dies keineswegs ein Kniefall vor einer traurigen Realität, sondern eine geschickte Anpassung an das moderne Leseverhalten ist. Wenn der „Lehrer“ gut vorarbeitet, ist es durchaus möglich, sich ein Thema quasi selbst zu erarbeiten, aus Facetten ein Gesamtbild zu verschaffen. Was sogar von Vorteil ist, da es „das“ Bild vom Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich gar nicht gibt.
Hartmann & Hürter legen in kurzen Einstiegskapiteln Zusammenhänge offen. Dann gehen sie in Details. Bei näherer Betrachtung lassen sie freilich die Zeitzeugen nicht einfach nur sprechen. Ihre Äußerungen werden von den Autoren ausgewählt, in ein übergeordnetes Gerüst gebettet, kommentiert, interpretiert, wenn nötig korrigiert, da solche Zeugnisse aus der Vergangenheit trotz (oder wegen) ihrer Unmittelbarkeit nicht zwingend der Wahrheit entsprechen müssen.
Die ein- und überleitenden Texte sind mit großer Sorgfalt verfasst. Gerade in der Beschäftigung mit dem „Dritten Reich“ wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Historikerkollegen, die Medien und selbst berufene Tugendwächter läuten gern die Pestglocke – dies vor allem, wenn sie Relativierungen des NS-Unrechts wittern. Auch wenn hier immer wieder über das Ziel hinausgeschossen wird, so fördert die Gewissheit, von scharfen Kritikeraugen beobachtet zu werden, auf der anderen Seite die Sorgfalt von Autoren, die sich der thematischen Herausforderung stellen. Hartmann & Hürter wagen es und gewinnen. Auch in der erforderlichen Verkürzung achten sie auf historische Präzision.
Ausgewogenheit ist ein weiteres Merkmal ihres Werks. Zu Wort kommen sie alle: die „guten Deutschen“, die „bösen Nazis“, die Mitläufer; die Übergänge sind da fließender als den meisten Zeitzeugen selbst oder den Nachgeborenen klar ist. Die Opfer des Naziterrors werden nicht verklärt, sondern behandelt, wie sie es verdient haben: als ganz normale Menschen, die wegen einer kriminellen Wahnidee buchstäblich aus ihrem Leben gerissen wurden. Die schwer oder gar nicht begreifbare Selbstverständlichkeit und Alltäglichkeit, mit der dies anscheinend möglich war, wirkt viel erschreckender als jedes pathetische Zwangsgedenken, bei denen mit der Gnade der späten Geburt gesegnete Politiker betroffene Minen aufsetzen, Kränze austeilen & „Nie wieder!“-Reden schwingen.
Die letzten 100 Kriegstage werden selbstverständlich auch aus der Sicht der alliierten sowie der sowjetrussischen Zeitzeugen kommentiert. Hier schlägt das noch heute nachwirkende Unverständnis darüber durch, wieso die Deutschen, die selbst am besten wissen mussten, dass für sie der Krieg verloren war, den Kampf bis zum bitteren Ende nicht aufgaben. US-Amerikaner, Briten, Franzosen, Russen – sie alle kamen nicht nur in ein feindliches, sondern in ein zutiefst fremdes Land. So geht es uns Lesern von Heute ebenfalls, zumal der Verdrängungsprozess in Deutschland – die Autoren gehen auch darauf ein – bereits in diesen 100 letzten Tagen mächtig einsetzte.
Schon angesprochen: die Qualität der Bilder, die zudem gut ausgewählt, d. h. nicht tausendfach gesehen wurden und den Text illustrieren, ergänzen, kommentieren. Ein Bild sagt in der Tat oft mehr als tausend Worte. Absurdität und Agonie des „Drittes Reichs“ werden selten so offensichtlich wie in jenem Bild, das Adolf Hitler im Februar 1945 weiterhin in Großmachtsträumen schwelgend tief versunken beim Anblick eines bizarren Metropolis-Modells der geplanten „Führerstadt“ Linz zeigt („Tag 34“). Der Krieg ist längst mehr als verloren, aber er läuft wie geschmiert weiter – man beginnt zumindest zu ahnen wieso.
Christian Hartmann und Johannes Hürter arbeiten als Historiker am Institut für Zeitgeschichte in München. Dort forschen sie seit Jahren über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Die Ergebnisse geben sie einerseits als Dozenten an der Universität der Bundeswehr München weiter, während sie andererseits für eine Fülle von Publikationen zum Thema verantwortlich zeichnen. Hartmann wirkte außerdem als wissenschaftlicher Berater bei dem Aufsehen erregenden Filmwerk „Der Untergang“ mit.
Narciso, Giancarlo – schöne Hand des Todes, Die
Singapur: Fernab der Heimat kreuzen sich hier die Wege zweier Italiener, die sich zu Hause wohl gegenseitig nie wahrgenommen hätten. Der eine ist der unkonventionelle Weltenbummler Rodolfo, der sich seinen Lebensunterhalt als selbstständiger Übersetzer verdient, der andere ist Marco, der Boss eines großen internationalen Bauunternehmens. Auf den ersten Blick haben beide gar nichts gemeinsam. Allein in der Fremde entdecken sie allerdings ein paar Gemeinsamkeiten. Rodolfo hat stets unabhängig gelebt, Marco hat sich durch seine frühe Heirat schon sehr bald unter die Fittiche seiner Frau begeben, träumt aber heimlich immer noch von der Freiheit und Unabhängigkeit, die Rodolfo auslebt.
Die beiden ziehen regelmäßig zusammen durch die Kneipen Singapurs, doch ihre Freundschaft ist nur von kurzer Dauer. Marco steht eines Tages verzweifelt vor Rodolfos Tür und vertraut ihm einen Schließfachschlüssel und eine große Summe Bargeld an – für den Fall, dass ihm etwas zustoßen sollte. Außerdem trägt er Rodolfo auf, sich im Fall der Fälle darum zu kümmern, dass seine Geliebte Diana das Land verlassen kann. Rodolfo willigt ein und schon kurze Zeit später liegt es an ihm, zu seinem Versprechen zu stehen, denn Marcos verbrannte Leiche wird gefunden.
Rodolfo nimmt Diana zunächst einmal bei sich auf, bis er die nötigen Papiere besorgt hat und sie das Land verlassen kann. Doch so einfach kommt er aus der ganzen Geschichte nicht wieder heraus. Rodolfo steckt schon sehr bald in ernsthaften Schwierigkeiten und wird zu einer Figur in einem Spiel, dessen Regeln er nicht zu durchschauen vermag.
Reichlich Vorschusslorbeeren kann Giancarlo Narciso bei der deutschen Erstveröffentlichung seines zweiten Romans vorweisen. Lobeshymnen in der italienischen Presse und dann noch die Auszeichnung mit dem renommierten Preis „Premio Tedeschi“. Zusammen mit dem überaus poetisch anmutenden deutschen Titel „Die schöne Hand des Todes“ erscheint das sehr viel versprechend, wobei aber zumindest Letzterer völlig falsche Erwartungen weckt.
Wer vom Titel auf den Inhalt schließt, der könnte enttäuscht werden. Was der Titel an sprachlicher Finesse und Poesie verspricht, das sucht man im Roman leider vergeblich, so dass auf jeden Fall die Frage berechtigt ist, warum der Verlag zu dieser Irreführung greift. In meinen Augen könnte man als Leser eine wesentlich realistischere Erwartungshaltung entwickeln, wenn man auch für die deutsche Ausgabe beim Originaltitel „Singapore Sling“ (Marcos Lieblingscocktail) geblieben wäre. Dementsprechend brauchte ich zu Beginn des Romans überraschend lange, um damit warm zu werden. Es gilt eben erst einmal, die eigene Erwartungshaltung komplett umzustülpen und sich während des Lesens umzuorientieren.
Hatte ich mir aufgrund von Klappentext, Titel und Titelbild eine exotische, atmosphärisch dichte, spannende Geschichte mit ausgefeilter, poetischer Sprache erhofft, so entpuppte sich der Roman als wesentlich nüchterner, gradliniger und weniger exotisch – wenngleich dennoch sehr spannend. Narcisos Thriller ist mit gerade einmal 283 Seiten recht kompakt geraten. Man wird unvermittelt in die Geschichte hineingestoßen, Figuren und Atmosphäre werden nicht gerade ausschweifend skizziert, aber etwa ab der Mitte wird die Geschichte dann so spannend, dass man möglichst schnell erfahren will, wie sie endet.
Der Plot, den Narciso inszeniert, hat es wirklich in sich. Rodolfo wird in eine verzwickte Geschichte hineingezogen, in der es viele unterschiedliche Interessen gibt. Jeder verfolgt seine eigenen Ziele und wer auf welcher Seite steht, wer vertrauenswürdig ist und wer falsch spielt, ist schwer zu entschlüsseln. In dieser Hinsicht ist Narcisos Roman wirklich sehr gut gelungen. Auch sein Spannungsaufbau weiß zu überzeugen. Die Geschichte entwickelt sich mit steigender Seitenzahl zunehmend rasanter und undurchsichtiger, so dass man schon wirklich konzentriert folgen muss, um nicht den Faden zu verlieren. Im Angesicht der Achterbahnfahrt, auf die Narciso Leser und Figuren zum Ende hin schickt, kann einem schon mal schwindelig werden.
Raffiniert knüpft Narciso Verbindungen zwischen unterschiedlichen Figuren und inszeniert einen frühen Showdown, der noch längst nicht das Ende markiert. Nach dem Showdown folgt eine kleine Verschnaufpause, die Leser und Figuren kurz wieder Atem schöpfen lässt, um sie dann mit einem letzten Knall zum Ende der Geschichte zu schicken. Danach bleibt der Eindruck eines „runden“ Romans. Die Geschichte wirkt in sich stimmig, der Plot gut konstruiert, wenngleich der eine oder andere kleinere Schwachpunkt im Gedächtnis bleibt. Die Motive des Täters lassen sich zwar begründen, bleiben aber in meinen Augen auch etwas blass und können somit nicht die letzten Zweifel ausräumen.
Ähnlich blass bleiben teilweise die Figuren. Insbesondere Rodolfo lässt einige Fragen aufkommen. Seine Person wirkt sehr verschlossen und kalt. Obwohl er Frau und Kind hat, sitzt er einsam am anderen Ende der Welt und schafft es höchstens einmal im Jahr, sich bei seiner Familie zu melden. Er wirkt irgendwie leblos und innerlich leer. Diesen Eindruck kann Narciso zwar zum Ende des Romans etwas relativieren, dennoch bleibt Rodolfo uns etwas schwer begreiflich. Ähnlich sieht es mit seinem Verhalten aus. Für meinen Geschmack bewegt er sich fast schon zu souverän durch dieses verzwickte, undurchsichtige Spiel, um bis in den letzten Winkel glaubwürdig zu sein. Einerseits bringt er bestimmten Figuren (obwohl er keinen Grund dazu hätte) überraschend viel Vertrauen entgegen, andererseits kann man ihm kaum Leichtgläubigkeit vorwerfen, so souverän, wie er oftmals die Lage meistert. Das ist ein etwas sonderbarer Widerspruch.
Auch die übrigen Figuren strahlen eine gewisse Kühle aus, die in einem etwas merkwürdigen Kontrast zur schwülen Hitze Singapurs steht. Sonderlich nah geht uns keine der Figuren, was sicherlich auch in der Kompaktheit der Handlung begründet liegt. Narciso konzentriert sich eindeutig auf seinen ausgeklügelten, rasanten Plot, der wirklich überzeugend und durchgängig spannend ist. Figuren und Atmosphäre treten dabei etwas in den Hintergrund.
Ein weiterer Reiz des Romans ist der Handlungsort. Singapur als Ort einer Thrillerhandlung bekommt man nicht sehr oft serviert, so dass die Atmosphäre und das ganze Drumherum des Romans zwangsläufig etwas aus dem Rahmen gewohnter Klischees fallen müssen. Das tun sie letztendlich auch. Narciso hat selbst jahrelang in Singapur gelebt und pendelt heute zwischen Mailand und Indonesien. Er kennt das Land also aus eigenen Erfahrungen und hegt eine besondere Beziehung zu Südostasien allgemein.
Dass das Bild, das Narciso von Singapur zeichnet, also absolut realistisch ist, daran kann kein Zweifel bestehen. Trotzdem dauert es sehr lange, bis er diesen Vorteil voll ausspielt. In dem Handlungsort steckt mit Blick auf die Atmosphäre des Romans ein großes Potenzial, das Narciso leider nicht hundertprozentig ausschöpft. Ein Punkt, in dem die Kompaktheit des Romans etwas bedauerlich ist. Es entsteht zwar ein interessantes Bild von Singapur, zumal der durchschnittliche Mitteleuropäer darüber sicherlich nicht viel weiß, aber man hätte daraus sicherlich auch noch eine etwas dichtere Atmosphäre zaubern können. Singapur als Schmelztiegel unterschiedlicher asiatischer Kulturen, als Land ohne wirkliche Wurzeln und als Ansammlung moderner Bauwerke, ohne tief greifende Geschichte wird sehr deutlich ausgeformt, könnte aber hier und da auch tiefer greifend sein.
Was Narcisos sprachlichen Stil angeht, so ist der, wie angesprochen, längst nicht so feinfühlig und poetisch wie der Titel des Romans vermuten lässt. Er formuliert schlicht und etwas schnörkellos, sehr klar und direkt. Er scheint ein Faible für Marken zu haben, das an manchen Stellen etwas sonderbar anmutet, denn ich für meinen Teil finde es nicht unbedingt erwähnenswert, wenn jemand ein Poloshirt mit einem eingestickten Krokodil auf der Brust trägt.
Narciso konzentriert sich sehr auf die Interaktion der Figuren, schildert seine Handlung häufig in Dialogen und lässt auch trotz der gewählten Form des Ich-Erzählers nicht tiefer in seinen Protagonisten Rodolfo blicken. Sprachlich und inhaltlich fügt sich der Roman dennoch sehr gut zusammen. Letztendlich passt Narcisos Art zu Formulieren ganz gut zur Kompaktheit der Erzählung und zu seiner Konzentration auf den Plot.
Insgesamt betrachtet, ist Giancarlo Narciso mit „Die schöne Hand des Todes“ ein solider Thriller geglückt. Die Geschichte wird durchgängig spannend erzählt, der Plot ist ziemlich pfiffig inszeniert und entwickelt sich mit der Zeit so rasant, dass dem Leser fast schwindelig wird. Dass vor diesem Hintergrund die Figuren nicht so tief gezeichnet werden und sich auch die Atmosphäre Singapurs nicht bis in den letzten Winkel entfaltet, ist zwar eine etwas bedauerliche Begleiterscheinung – besonders wenn man im Hinterkopf behält, dass man aufgrund des deutschen Titels vielleicht mit einer etwas falschen Erwartungshaltung an das Buch herangeht -, aber letztendlich in gewissem Maß verzeihlich.
Patricia Cornwell – Wer war Jack the Ripper?
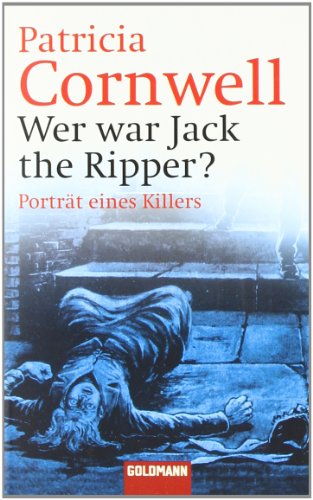
Szerb, Antal – Pendragon-Legende, Die
Ende 2004 erschien im |Deutschen Taschenbuchverlag| eine Neuübersetzung der „Pendragon-Legende“, die der ungarische Literaturprofessor Antal Szerb bereits im Jahre 1934 verfasste. Szerb ist in Ungarn bis heute berühmt, obwohl er bereits 1945 im Alter von nur 43 Jahren im Internierungslager Balf in West-Ungarn starb.
Im Alter von 32 Jahren lernt János Bátky auf einer Soiree bei Lady Malmsbury-Croft den Earl of Gwynedd kennen, der auch unter dem Namen Owen Pendragon bekannt ist. Die beiden unterhalten sich gut und diskutieren unter anderem über Fludds Naturphilosophie. Am Ende des Abends erhält Bátky eine Einladung nach Wales auf das Schloss Llanvygan der Pendragons, wo ihm eine ausführliche Sichtung der dortigen Bibliothek ermöglicht werden soll. Bátky freut sich zwar über das Angebot, fühlt sich allerdings viel zu träge, um wirklich nach Wales zu reisen. Dennoch wird seine Neugierde geweckt, als er erfährt, dass die Pendragon-Bibliothek weltweit berühmt ist für ihre Werke aus dem Gebiet der Mystik und des Okkultismus im 17. Jahrhundert. Kurze Zeit später erhält Bátky einen mysteriösen Anruf, der ihn vor einer Reise nach Wales warnen will, da dort sein Leben in Gefahr sei. Doch Bátky versucht, dieses Telefonat wieder zu vergessen.
Durch einen Zufall (?) lernt er bei seinen Studien zur Familiengeschichte der Pendragons im |British Museum| den lebens- und reiselustigen George Maloney aus Connemara kennen, der sogleich von seinen zahlreichen und aufregenden Auslandsaufenthalten erzählt. Bei einem gemeinsamen Abendessen stellt Maloney seinem neuen Bekannten Bátky den Neffen des Earl of Pendragon vor. Der gebildete Osborne Pendragon studiert in Oxford, möchte aber seine Ferien auf Llanvygan verbringen und hat dazu auch seinen Freund Maloney eingeladen. So beschließen Maloney und Bátky, gemeinsam nach Wales zu reisen.
Schon die Begrüßung auf dem Schloss verläuft nicht so erfreulich, wie Bátky sich das erhofft hat, und gleich in der ersten Nacht wird er von merkwürdigen Geräuschen geweckt. Als er seinen Revolver aus dem Nachtschrank holen will, muss Bátky erstaunt feststellen, dass sämtliche Patronen aus der Waffe entfernt worden sind und auch ein Päckchen fehlt, das er für Maloney mit sich geführt hat. Auf dem Gang vor seinem Zimmer trifft er auf eine mittelalterlich gekleidete Gestalt, die sich als Hausdiener vorstellt, doch bei einem Blick aus seinem Zimmerfenster kann Bátky einen schwarzen Reiter mit Fackel und Hellebarde beobachten. Kurz darauf wird ein Mordanschlag auf den Earl verübt, dem er nur mit viel Glück entkommen kann. Es scheint, als könnte der Earl drohendes Unglück spüren, denn dies war bereits der dritte Mordversuch, den er vereiteln konnte. Langsam aber sicher verdichten sich die Verdachtsmomente, bald ist ein angeblich Schuldiger gefunden, doch was steckt wirklich hinter den Mordanschlägen?
„Die Pendragon-Legende“ ist aus der Sicht des János Bátky geschrieben, der seine Lebensgeschichte erzählen möchte. In seinen ersten 32 Lebensjahren ist außer dem ersten Weltkrieg nichts Entscheidendes passiert; so entschließt sich Bátky, gleich beim Soiree der Lady Malmsbury-Croft einzusetzen und damit bei seiner ersten Begegnung mit dem Earl of Pendragon. Obwohl sofort offensichtlich wird, dass dieses Kennenlernen für den Ich-Erzähler von entscheidender Bedeutung gewesen sein muss, lässt Szerb sich in seiner Erzählung viel Zeit. Zunächst entwickelt er seine Charaktere und verleiht Bátky einige selbstkritische Züge, da er immer wieder einstreut, mit welchen Charakterzügen er an sich selbst unzufrieden ist. Die Charakterzeichnungen sind ein Punkt, der sofort positiv auffällt an diesem Buch, denn neben János Bátky lernt der Leser auch die anderen Hauptfiguren recht gut kennen. Eine besonders sympathische Figur ist dabei Maloney, der immer wieder unglaubliche Geschichten aus Connemara von sich gibt, die ihn ein wenig spleenig, aber auch nett erscheinen lassen. Aufgrund der abstrusen Geschichten bezeichnet Bátky Maloney wenig schmeichelhaft als Münchhausen, doch kommt der Leser nicht umhin, diesen Geschichten doch ein wenig Glauben zu schenken. Maloneys extravagante Hobbys tragen dazu bei, dass der Leser sich ein gutes Bild von diesem überdrehten und lebenslustigen Charakter machen kann. Szerb entwickelt Charaktere, wie es sie im wahren Leben möglicherweise eher weniger geben mag, dennoch kann man ihm dies nicht übel nehmen, da einem die Personen einfach ans Herz wachsen durch ihre menschlichen Macken und Eigenarten. Der Autor zeigt an vielen Stellen eine erstaunliche Beobachtungsgabe, da er in etlichen weiteren Situationen Eigenschaften und Merkmale seiner Charaktere anbringt. Als dritte Figur tritt Osborne Pendragon in Erscheinung, der zwar gebildet und intelligent ist, aber seine Schwierigkeiten mit Frauen zu haben scheint; auch er vermag es durch sein leicht schrulliges Verhalten, dem Leser in einigen Situationen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Besonders Lene Kretzsch weiß eine sehr amüsante Episode über Osborne zu berichten, als sie nämlich versucht, den reservierten und wohlerzogenen Osborne zu verführen, was sich als äußerst kompliziert erweist. Natürlich fehlen auch nicht die Frauenfiguren in diesem Roman; so treten die ominöse Eileen St. Claire, die bezaubernde Cynthia Pendragon und die toughe Lene Kretzsch in Erscheinung. Hier prallen drei völlig unterschiedliche Frauentypen aufeinander, die sich Antal Szerb wahrlich meisterhaft ausgedacht hat.
Szerbs Erzählweise ist gemächlich, aber unheimlich sympathisch, in vielen Sätzen verstecken sich sensibler Humor und feine Ironie, die uns nicht vor lauter Lachen vom Sofa fallen lassen, aber immer wieder zum Schmunzeln bringen. Der besondere Reiz liegt hier in den Feinheiten, die am Rande fallen und auf die man genau Acht geben sollte. „Die Pendragon-Legende“ sollte daher mit etwas erhöhter Aufmerksamkeit gelesen werden, da Szerb viel zu sagen hat und dem Leser zahlreiche Informationen mit auf den Weg gibt. So erfährt der Leser während Bátkys ausführlicher Literatursichtung vor seiner Reise nach Wales einiges aus der Familiengeschichte der Pendragons, die eng verwoben ist mit der Geschichte der Rosenkreuzer. Stein um Stein baut Szerb dadurch seine Geschichte auf. Oftmals wird die eigentliche Erzählung ein wenig unterbrochen durch diverse Einschübe, wenn beispielsweise eine neue Person auftaucht, die János Bátky zunächst vorstellen möchte, oder wenn aus der Historie der Pendragons berichtet wird. Obwohl ich derlei Einschübe sonst eher lästig finde, muss ich zugeben, dass sie hier in die Geschichte passen, zumal die eingeschobenen Szenen meist interessant oder auch amüsant sind.
Allmählich wird fast schon unmerklich Spannung aufgebaut durch kleine Hinweise auf mysteriöses Treiben im Hause Pendragon. Bátky kommt im Schloss kaum zum Schlafen, da nächtens die merkwürdigsten Dinge geschehen, darüber hinaus schwebt der Earl of Pendragon in Lebensgefahr, da er bereits drei Mordanschlägen durch schicksalhafte Mithilfe entkommen konnte. In Pendragons Labor entdeckt Bátky unglaubliche Dinge, die mit der Geschichte der Rosenkreuzer zusammenzuhängen scheinen. Doch bleibt lange unklar, worauf das Buch eigentlich hinauslaufen möchte.
Eine Einteilung in ein Genre ist bei der „Pendragon-Legende“ äußerst schwierig, da Szerb auf der einen Seite eine Geistergeschichte schreibt, auf der anderen aber auch ein Familienbild der Pendragons entwirft. Beide Handlungszweige sind eng verwoben und werden gleichberechtigt weitergeführt. Obwohl die Rosenkreuzer auftauchen und eine nicht unwesentliche Rolle spielen, darf man keinen Verschwörungsthriller im Stile eines Dan Brown erwarten, denn Szerb lässt seine „Pendragon-Legende“ in eine völlig andere Richtung gehen. Im Grunde genommen kann man das Buch als eine Gruselgeschichte mit ausführlichen Charakterzeichnungen und sympathisch erzählter Rahmengeschichte bezeichnen.
Die „Pendragon-Legende“ reißt nicht durch übergroße Spannung mit, sondern hat ihren ganz eigenen Charme, das Buch ist eine kleine literarische Perle, die man aufmerksam lesen sollte, um alle Feinheiten aufzunehmen. Antal Szerb lässt herrliche Charaktere entstehen, die allesamt irgendwo sympathisch werden, allen voran der philosophisch interessierte, schüchterne und ängstliche Ich-Erzähler Bátky, der auch den Reizen einer schönen Frau nicht widerstehen kann. Die eigentliche Gruselgeschichte passiert fast schon am Rande, obwohl sie doch eigentlich Anlass gegeben hat zu Bátkys Erzählung. Doch der besondere Reiz dieses Buches liegt in den Geschichten, die drumherum erzählt werden. Der Leser sollte sich allerdings auf Szerbs Erzählweise und die manchmal etwas schwerfällig anmutende Sprache einlassen, dann wird die „Pendragon-Legende“ für einige sehr unterhaltsame und interessante Stunden sorgen.
Hennig von Lange, Alexa – Woher ich komme
Alexa Hennig von Lange ist die wohl schillerndste unter den jungen Autorinnen Deutschlands. So jung ist die 1973 in Hannover geborene, ehemalige „Bim Bam Bino“-Moderatorin aber auch nicht mehr. Inzwischen lebt sie nach langem Aufenthalt in Berlin mit ihrem Mann und den zwei Kindern wieder in Hannover.
Literarisch ist man 1997 auf sie aufmerksam geworden, ihr Debüt „Relax“ hielt sich lange in den Bestsellerlisten und bestach durch die authentische und schonungslose Jugendsprache der Autorin. Wie es so häufig ist, wurden die folgenden Romane „Ich bin’s“ und der Tagebuchroman „Mai 3D“ zu echten Enttäuschungen und ließen am Talent des Rotschopfes zweifeln. Zurück zu alter Stärke hatte sie zum Glück mit dem Jugendbuch „Ich habe einfach Glück“ im Jahre 2001 gefunden, für das sie schließlich mit dem Jugendliteratur-Preis ausgezeichnet wurde. Zuletzt erschienen „Erste Liebe“ und „Mira reicht’s“ 2004. Die Erstausgabe zu „Woher ich komme“ wurde 2003 veröffentlicht.
Die Handlung des 100 Seiten kurzen Romans ist gar keine. Die 30-jährige, namenlose Protagonistin fährt mit ihrem Vater ans Meer, wie es die Familie jeden Sommer getan hat. In der Gegenwart hält man sich aber nicht lange auf, auf den gesamten Text bezogen nur wenige Seiten. Es ist ein stiller und träger Ausflug, den Vater und Tochter hier unternehmen. Das Meer, der Ort, zu dem es die Beiden gezogen hat, ist der Ort der Erinnerungen, die wie Schatten immer wieder, meist nur kurz, an der Oberfläche erscheinen.
Jede Erinnerung ist nur wenige Sätze lang, bricht so unvermittelt, wie sie aufgetaucht ist, ab und wird von einer anderen abgelöst. Die Protagonistin geht in Gedankensprüngen ihre Kindheit durch. Diese ist auf den ersten Blick eine glückliche. Man erfährt, dass sie einen kleinen Bruder hatte, der im Sommer, immer wenn die Familie zum Urlaub ans Meer gefahren ist, Geburtstag hatte. Liebevoll, fast poetisch werden Situationen dieser Sommertage geschildert, aber es klingt auch viel Wehmut darin an. Eines Sommers wird die Familie während des geliebten Sommerurlaubs für immer auseinander gerissen. Bei einem Spaziergang im Watt wird man von der Flut überrascht. Die Protagonistin kann sich an den Strand retten und muss zusehen, wie nur ihr Vater aus dem Wasser zurückkehrt.
Es tun sich inmitten dieser tragischen Gegebenheit und Schilderungen einer oberflächlich normalen und glücklichen Kindheit aber auch noch weitere düstere Abgründe auf. So zum Beispiel die Affäre der Mutter mit dem Nachbarn.
„Woher ich komme“ ist ein ruhiges und schlichtes, so zerbrechlich wie die Erinnerungen der Protagonistin wirkendes Buch. Es ist ebenfalls eine authentische Erzählung. Die Erinnerungen wurden ausgezeichnet von der Autorin gestaltet und angeordnet. Die von der Protagonisten erinnerten Dinge liegen schon mehr als ein Jahrzehnt zurück. Durch diesen Umstand wirken sie auf den Leser oft unklar und schemenhaft, an einigen Stellen aber bemerkenswert detailliert. Es sind meist die schönen Erinnerungen, wie die tiefe Verbundenheit mit dem Bruder oder Gesten der Mutter, die sich in das Gedächtnis eingebrannt haben, die präzise und emotional berührend wiedergegeben werden.
Angesichts der letztendlich mehr als tragischen Kindheit verbergen sich viele Dinge im Kopf der Protagonistin, die sie scheinbar noch nicht für sich abschließen konnte. Durch die räumliche Nähe zu diesen Erinnerungen (das Meer) brechen sie unweigerlich und geballt hervor. So wird es für den Leser schwierig, diese in einen Kontext einzuordnen, denn sobald sich Klarheit anbahnt, wird eine Erinnerung von der anderen abgelöst. Zeitliche und räumliche Sprünge folgen dabei aufeinander, bis sich das Angedeutete gegen Ende des Romans mehr und mehr entblättert, aber immer noch viel Raum für die Fantasie des Lesers lässt.
„Woher ich komme“ ist kein Buch, das sich mit der dramaturgischen Entwicklung einer Handlung oder der von Charakteren aufhält. Die Handlung ist die Vergangenheit, und die muss sich der Leser schon selbst erarbeiten. Wer sich darauf einlässt, kann einige gute Stunden mit einem höchst interessanten und für die Autorin außerordentlich erwachsenem Buch verbringen.
|Leseprobe| aus der Taschenbuchausgabe Februar 2005, Seiten 9/10.
»Meine Mutter und ich sahen, wie sich der Priel mit Wasser füllte, und der Sand war nicht mehr da, und mein Vater war weit draußen, hörte unsere Rufe nicht, und der Himmel war blau. „Lauf so schnell du kannst!“ Meine Mutter schubst mich in die Richtung, in der sie den Strand vermutet, und das ist die richtige Richtung, und ich renne so gut es geht, im feuchten Sand, und Mama versinkt in die andere Richtung, in Richtung meines Vaters, meines Bruders. Der war klein und wusste von nichts. Ging an Papas Hand und hatte uns zugewinkt. Die Sonne stand über uns, flirrend, keine Wolken, einfach nur Himmel und sehr viel Raum. Zwischen Mama und mir, zwischen mir und meiner Familie wurde der Abstand immer größer.
Mein Vater kam allein zurück.«
Fraser, Ian (Kilmister, Lemmy) / Garza, Janiss – Lemmy – White Line Fever
Ian Fraser Kilmister, besser bekannt als „Lemmy“, ist ein (wenn nicht sogar DAS) Urgestein der Rock- und Metalszene. Er wurde am Heiligabend 1945 in Burslem, England geboren und sammelte bereits in jungen Jahren musikalische Erfahrungen bei Bands wie den ROCKING VICARS, OPAL BUTTERFLY und HAWKWIND, bevor er sich ab 1975 als Frontmann von MOTÖRHEAD maßgeblich an der Erfindung des Metal beteiligte. Vielleicht kennt ja der eine oder andere unter euch noch den Gag aus dem Film „Airheads“:
„Wer würde beim Wrestling gewinnen: Lemmy oder Gott?“
„Lemmy?“
„Möööp!“
„Äh, Gott!“
„Falsch! Fangfrage. Lemmy IST Gott.“
Man muss nicht unbedingt ein Fan von MOTÖRHEAD sein, um das Lebenswerk von Lemmy Kilmister würdigen zu können. Ich persönlich habe ein paar Favoriten wie „Born To Raise Hell“, „Killed By Death“ oder das grandiosen Cover von „God Save The Queen“, aber für den entsprechenden Nostalgie-Faktor bin ich wahrscheinlich zu spät geboren worden, und bei den meisten MOTÖRHEAD-Songs fehlt mir einfach die Härte. Nichtsdestotrotz hat Lemmy Musikgeschichte geschrieben, wobei er stets bodenständig geblieben ist und trotz seines exzessiven Lebensstils so manchen Rockstar überlebt hat. Zudem haben sich MOTÖRHEAD niemals dazu verleiten lassen, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen (wie etwa GUNS N‘ ROSES) oder einfach nur aus finanziellen Gründen weiterzumachen (wie etwa die ROLLING STONES), sondern bis heute mit kontinuierlicher Frische ein neues Album nach dem anderen eingezimmert. Das ist an sich schon eine Leistung, die zumindest Respekt, wenn nicht sogar Hochachtung verdient. Dank Lemmy haben wir auch heute noch (z. B. auf dem diesjährigen „With Full Force“) die Möglichkeit, ein |lebendiges| Stück Rock-’n‘-Roll-Geschichte live zu erleben. Ich hoffe, dass uns dieses Privileg noch ein paar Jahre erhalten bleibt. Grund genug für mich, mir die kürzlich bei |Iron Pages| auf Deutsch erschienene Lemmy-Autobiographie „White Line Fever“ zu Gemüte zu führen.
Wie diese „Autobiographie“ zustande gekommen ist, hat Lemmy im Gespräch mit Götz Kühnemund (nachzulesen in der Ausgabe 6/04 des |RockHard|-Magazins) erläutert:
„Ja, ich habe alles auf Band gesprochen, und Janiss Garza hat die Tapes abgehört. Die abgetippte Version habe ich dann noch einmal Korrektur gelesen und stellenweise abgeändert.“
Will heißen: „White Line Fever“ wurde nicht von Lemmy selbst, sondern von seiner Ghostwriterin geschrieben. Das Buch orientiert sich an den freien Assoziationen, welche Lemmy auf Band gesprochen hat, und das merkt man der Struktur des Textes auch an. Streng genommen handelt es sich hier also mitnichten um eine echte Autobiographie, wie es der Untertitel auf dem Cover des Buches suggeriert. Das tut aber dem Lesevergnügen keinen Abbruch – im Gegenteil. Janiss Garzas Schreibe kommt frisch und unverbraucht rüber und außerdem versteht sie es, die Pointen richtig zu setzen. Sie scheint bei der Niederschrift des Textes mindestens genauso viel Spaß wie Lemmy gehabt zu haben. Da er sich selbst mit dem Endprodukt identifizieren kann, dürften die MOTÖRHEAD-Fans m. E. erst recht nichts dagegen einzuwenden haben.
Das Buch folgt keiner streng chronologischen Zeitlinie, obwohl es sich natürlich grob an Lemmys Werdegang orientiert. Lemmy springt in seiner Erzählung immer dann in der Zeit, wenn er den geschichtlichen Kontext einer bestimmten Situation verdeutlichen, oder – was wohl ausschlaggebender sein dürfte – eine amüsante Anekdote zum Besten geben will. Was wir dabei erfahren, ist Lemmys ganz persönliche Sicht der Dinge, aber nicht zwingend eine möglichst „objektive“ Darstellungsweise. Aber das wäre vermutlich auch bedeutend langweiliger als Lemmys erzählerisches Spiel mit Klischees und Übertreibungen. Wenn ein alter Seemann sein „Seemannsgarn“ spinnt, lebt die Geschichte schließlich auch von den Übertreibungen. (Wer eine möglichst realitätsnahe Wiedergabe der mit Lemmy verbundenen Ereignisse haben möchte, sei an dieser Stelle auf „Over the Top – Das Motörhead-Fanbuch“ von Matthias Mader (ebenfalls erschienen bei |Iron Pages|) verwiesen.) Abgesehen davon habe ich aber den Eindruck, dass in Lemmys Schilderungen immer zumindest ein Körnchen Wahrheit enthalten ist. Der Mann hat in seinen (zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung von „White Line Fever“) 57 Lebensjahren mehr skurrile Dinge erlebt als fünf „normale“ Menschen zusammen.
Wir erfahren etwas von Lemmys problematischer, aber dennoch lebensfrohen Kindheit, welche er in Armut und ohne leiblichen Vater durchleben muss. Da seine Mutter samt Stiefvater nach Wales zieht, ist das Schulkind Lemmy von Anfang an ein Exot. Schon früh entdeckt er, dass man mit einer Gitarre Mädchen beeindrucken kann. Als er zusätzlich registriert, dass dies noch besser funktioniert, wenn man sein Instrument auch noch beherrscht, findet er in der Musik schnell eine Alternative zum ungeliebten Schulbesuch. Der damalige Arbeitsmarkt bietet auch keine wirkliche Alternative, so dass er den Entschluss, Musiker zu werden, sicherlich nicht bereut hat. Andere britische Bands wie BLACK SABBATH oder VENOM standen ja vor einer ähnlichen Problematik, und auch jüngere Bands wie RAGING SPEEDHORN zeigen, dass sich daran bis heute nicht viel geändert hat.
Die Liebe zum Rock entdeckt Lemmy, als er zum ersten mal mit BILL HALEY, BUDDY HOLLY, ELVIS PRESLEY und den BEATLES in Berührung kommt. Mit 16 verlässt er Wales, und die 60er verbringt er im Umkreis verschiedener Musiker (u. a. als Roadie von JIMMY HENDRIX) in London. Eine anschaulichere Beschreibung der damaligen Szene wird wohl schwer zu finden sein. Ich habe lange überlegt, ob ich hier ein paar beispielhafte Anekdoten zu seinen Exzessen um Musik, Drogen, Sex und abgefahrenem Zeitgeschehen zitieren sollte, bin aber letztlich zu dem Schluß gekommen, dass es weitaus spaßiger ist, sich selbst von Lemmys Humor überraschen zu lassen.
Damit komme ich zu einem entscheidenden Punkt: Das Buch ist absolut selbsterklärend. Wer erfahren will, welche Schwerpunkte Lemmy aus seinem Werdegang als prägend empfunden hat, kann dies hier aus erster Hand tun. Wir erfahren, wie Lemmy nach und nach in verschiedenen Bands Erfahrungen sammelt, bis er mit MOTÖRHEAD sein eigenes Projekt aufzieht. Wir werden Zeugen, wie die junge Band langsam zu einer eigenen Identität findet, wie sie sich im Business durchschlägt, und wie die Besetzung immer wieder wechselt. Die einzige Konstante bleibt Lemmy, obwohl sich MOTÖRHEAD natürlich nicht auf Lemmy reduzieren lässt. Besonders interessant finde ich persönlich, wie anhand von Lemmys Entwicklung auch der langsame Übergang vom Hardrock in den 70ern zum Metal in den 80ern mitzuverfolgen ist. Später, als MOTÖRHEAD zu einer festen Instanz geworden ist, folgen junge Metalbands nach, die nun ihrerseits zu Lemmy als altem Heroen aufblicken. Wer von euch hat z. B. gewusst, das Lars Ulrich der Leiter des US-Fanclubs von MOTÖRHEAD war, bevor er selbst mit METALLICA durchstartete?
Interesant ist es natürlich auch zu entdecken, mit welchen sonstigen Persönlichkeiten aus Musik und Medien Lemmy noch verkehrt hat und verkehrt. Viele seiner engsten Freunde sind seit längerer Zeit verstorben, so dass seine vergnüglichen Schilderungen auch oftmals einen melancholischen Anstrich bekommen. Zugleich setzt er damit auch hier und da ein kleines Denkmal. Auch dies im Einzelnen zu entdecken, möchte ich dem geneigten Leser überlassen. Das Buch mag zwar ein paar Lücken aufweisen (Wer kann sich schon an alle Einzelheiten seines Lebens erinnern?) aber es ist insofern „vollständig“, als dass es einen überzeugenden Bogen vom Beginn in den 50ern bis zur Gegenwart spannt. Das Ganze wird mit ein paar schönen Fotos veredelt.
Als deutliches Manko empfinde ich allerdings die äußere Aufmachung des Buches: Der Einband besteht aus dünner Pappe, und das Papier der Seiten (ebenfalls dünn und glatt) hätte auch in einem Magazin Verwendung finden können. Für rund 20 Euro muss da m. E. einfach mehr drin sein. Die Die-hard-Fans sollten daher eine zusätzliche Einbindung in Erwägung ziehen, wenn sie auch ihren Enkeln noch Lemmys Eskapaden vermitteln wollen.
Abgesehen davon kann ich „White Line Fever“ aber ohne Einschränkung empfehlen. Es macht einfach Spaß, die Welt einmal aus Lemmys Perspektive zu betrachten. Eine Frage bleibt aber auch nach der Lektüre weiterhin offen: Wie zum Henker ist Lemmy an diese monströsen Warzen gekommen?!?
Ian Rankin – Verborgene Muster (John Rebus 1)
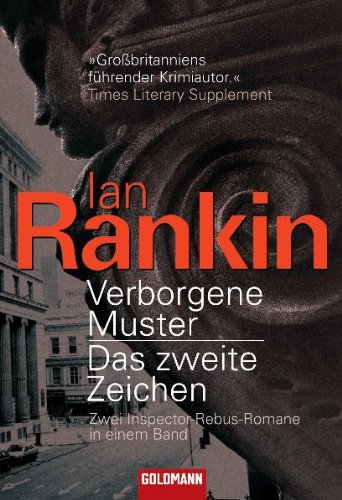
Bujold, Lois McMaster – Barrayar – Der junge Miles
Für den Sohn des ehemaligen Regenten des Kaiserreichs Barrayar sollte es kein Problem sein, an der Offiziersakademie aufgenommen zu werden. Doch nicht an Beziehungen oder gar Geist mangelt es Miles Vorkosigan, nein, er ist ein eineinhalb Meter großer, eher hässlicher, verkrüppelter Zwerg mit brüchigen Knochen, die keiner Belastung standhalten – die Folge eines Soltoxin-Attentats auf seine Mutter während der Schwangerschaft.
Beim knallharten Hindernislauf, Voraussetzung für die Aufnahme, bricht sich Miles wie schon so oft mehrere Knochen – damit ist seine militärische Laufbahn beendet, noch bevor sie begonnen hat. Seinem ultrakonservativen Großvater Piotr bricht er damit das Herz, der alte Mann stirbt kurze Zeit später.
Doch Miles Stunde ist noch nicht gekommen – dieses Buch ist die Geschichte seines Aufstiegs vom gescheiterten Offiziersanwärter zum gewitzten Söldnerführer Admiral Naismith.
_Klein, hässlich, charmant, erfolgreich …_
Mit Miles Vorkosigan führt Lois McMaster Bujold die schillerndste Figur ihres preisgekrönten Barrayar-Zyklus ein, der in komplett überarbeiteter Neuauflage bei |Heyne| erscheint. Der erste Sammelband der Neuauflage, [„Barrayar – Cordelias Ehre“, 865 enthielt bereits den mit dem |Hugo Award| ausgezeichneten Roman „Barrayar“ sowie „Scherben der Ehre“, in dem die Vorgeschichte dieser für eine Space-Opera ungewöhnlichen Heldenfigur geschildert wird.
„Der junge Miles“ enthält die Romane „Der Kadett“ und „Der Prinz und der Söldner“ – Letzterer wurde 1990 mit dem |Hugo Award| ausgezeichnet. Desweiteren ist die Novelle „Die Berge der Trauer“ enthalten, die im selben Jahr mit dem Kritikerpreis |Nebula| ausgezeichnet wurde!
Damit orientiert sich |Heyne| an der tatsächlichen Chronologie des Handlungsverlaufes, nicht an den Erscheinungsdaten der Romane. Insbesondere die Aufnahme der Novelle „Die Berge der Trauer“ in diesen Sammelband ist lobenswert, bisher konnte man sie nur außerhalb der Reihe in einem Sammelband erhalten. Damit stellt die Neuauflage die perfekte Gelegenheit dar, den kompletten Barrayar-Zyklus zu lesen – chronologisch geordnet und vollständig.
_Was macht den Barrayar-Zyklus besser als andere Space-Operas?_
Barrayar spielt in ferner Zukunft, die Menschheit beherrscht bereits die überlichtschnelle Raumfahrt, Wurmlöcher dienen als Sprungtore in ferne Sonnensysteme. Viele kleine Sternenreiche stehen im permanenten Konflikt, insbesondere um strategisch und wirtschaftlich bedeutsame Systeme mit vielen Wurmlöchern. Die Gesellschaft des technologisch und kulturell leicht rückständigen Kaiserreichs Barrayar erinnert an einen Mix aus dem Zarentum der Romanovs (die Adelskaste der „Vor“ stellt Offiziere und Regierung, der Kaisertitel ist erblich) und Stalinismus, dank Politoffizieren und ausgeprägtem Geheimdienstapparat. Der berechtigte Ruf der Grausamkeit eilt den Barrayanern voraus, insbesondere mit dem Nachbarreich Cetaganda und der kleineren Beta-Kolonie kommt es schon nahezu traditionell zu blutigen Gefechten.
Miles ist der lebende Gegensatz zu der militaristischen, konservativen und traditionellen Gesellschaft Barrayars, in der für ihn kein Platz ist – dabei braucht gerade sie seinen Witz, um in einer Zeit des Umbruchs und der Reformen zu bestehen.
_“Der Kadett“_ zeigt uns Miles freche, witzige Art. Thomas Manns Hochstapler Felix Krull könnte es nicht besser, gegen Miles Eskapaden sind seine Gaunereien kleine Fische. Als Söldner Miles‘ mit einer illustren Crew bemanntes Raumschiff, die vom psychopathischen Leibwächter bis hin zum barrayanischen Deserteur reicht, überprüfen, beschließen sie anstelle des Piloten wie sonst üblich doch eher die schöne Elena Bothari als Faustpfand an Bord zu nehmen …
Nun möchte ich nicht zu viel verraten, aber nicht nur werden diese Söldner überwältigt, nein, Miles gibt sich selbst als Söldnerhauptmann aus, „Admiral Naismith“ von den „Dendarii-Söldnern“ ist geboren. Diese nicht-existente Truppe wird bis zum Ende des Romans auf über 3.000 Mann anschwellen, gestandene Söldnergeneräle treten in die Dienste der Dendarii und ordnen sich Admiral Naismith unter. Zuhause auf Barrayar sorgt dies für Aufruhr, man will Miles Vater vorwerfen, sein Sohn stelle eine Söldnerarmee auf, was dem Gesetze nach nicht erlaubt ist und mit dem Tode bestraft werden muss.
Für Unterhaltung ist gesorgt. Gibt es mit Miles‘ Freund, Ivan Vorpatril, dem Offizier und Sunnyboy, sowie anderen Charakteren viel zu lachen und zu schmunzeln, mischen sich auch tragische Elemente in dieses Drama. Elena weiß nichts von ihrer Herkunft, sie ist das Produkt einer Vergewaltigung, die ihr Vater damals im Krieg gegen Escobar begangen hat. In diesem Band kommt es zur Konfrontation Elenas mit der Wahrheit – und der ihres Vaters, Sergeant Bothari, mit ihrer Mutter, die er auf eine absurde und abartige Weise liebt. Diese Zusammenhänge werden zwar erwähnt, jedoch erschließen sie sich nur Kennern des ersten Barrayar-Sammelbandes zur Gänze.
In _“Die Berge der Trauer“_ muss sich Miles seinen ganz persönlichen Problemen stellen. In den rückständigen Gebieten Barrayars werden missgebildete Kinder nach wie vor getötet (Barrayar erlebte einen Atomkrieg, mutierte Neugeborene wurden in der Vergangenheit bereits bei der Geburt beseitigt). Eine junge Mutter bittet Graf Vorkosigan um Gerechtigkeit, sie vermutet, ihr Mann habe ihr Kind wegen seiner Hasenscharte getötet. Miles soll Gerechtigkeit sprechen und den Täter finden.
Diese Novelle wurde mit dem |Nebula Award| ausgezeichnet. Was mich etwas verwundert, denn außer ein Schlaglicht auf die dunklen Seiten des sonst so tragisch-komischen Lebens von Miles zu werfen, konnte ich in ihr keine Moral, keinerlei Lösungsvorschlag oder dergleichen erkennen. Auch hat sich die Amerikanerin Bujold um ein Thema gedrückt, welches in den USA ziemlich heikel ist: Aberglaube darf vorkommen, aber Kritik an kirchlichen Dogmen oder jeglicher Hinweis auf Religion fehlen interessanterweise. Das betrifft nicht nur diesen Roman, in der Zukunft des Barrayar-Universums wird wohl keinerlei Gottheit mehr angebetet. So umgeht man Probleme und bleibt politisch korrekt. Die Geschichte ist tragisch und rührend, charakterisiert Miles und seine Probleme mit einer Gesellschaft, die bereits leicht Behinderte als minderwertig erachtet und ablehnt. Ich hätte mir dennoch etwas mehr erhofft.
In _“Der Prinz und der Söldner“_ wird Miles als Absolvent der Offiziersakademie zum Dienst auf einer in arktischer Ödnis gelegenen Station verdonnert, er soll lernen, sich unterzuordnen. Doch natürlich kommt es zum Eklat mit dem kommandierenden Offizier, Miles gerät in die Bredouille und wird nur dank des Einflusses seines Vaters vor dem Militärgericht gerettet. Seine Karriere in der Flotte ist damit so gut wie ruiniert – doch man sieht eine Chance beim Geheimdienst für Miles …
Die Dendarii-Söldner wurden mittlerweile von einem der alten Söldneroffiziere übernommen, die Miles lange Abwesenheit ausgenutzt haben. Zusammen mit einem vorgesetzten Offizier des Sicherheitsdienstes soll Miles sich der Sache annehmen. Doch wie soll man es anders erwarten – bald überschlagen sich die Ereignisse: Ein Krieg zwischen Vervain, Cetaganda und Barrayar droht, eine gewitzte Söldnerkommandeurin verursacht Miles einiges Kopfzerbrechen und der Kaiser Barrayars, Miles Jugendfreund Gregor, ist ebenfalls „abhanden“ gekommen und wird von seinem eigenen Sicherheitsdienst gesucht.
Eine komplizierte, vertrackte Geschichte, in der Miles ein ums andere Mal seine Schlagfertigkeit und Gewitztheit unter Beweis stellen kann. Die sich entwickelnde Handlung ist einfach atemberaubend und wurde demzufolge zu Recht auch mit dem |Hugo Award| ausgezeichnet. Action, Romantik, Humor – diese Geschichte hat alles.
_Ein Muss für Fans leichter SciFi-Lektüre_
Obwohl die |Barrayar|-Romane in erster Linie auf Unterhaltung ausgelegt sind, enthalten sie doch viele tragisch-komische Elemente, die sie von anderen, bierernsten und klischeehaften Space-Operas oder billig-kitschigen Persiflagen abhebt. Diese Ausgabe ist sehr empfehlenswert, Übersetzungsfehler früherer Ausgaben wurden weitgehend korrigiert, eine Karte sowie ein recht aufschlussreiches Nachwort der Autorin, die zentrale Figur ihrer Romane, Miles, betreffend, wurden beigefügt.
Vielleicht ist es die bittere Note der Komödie, die Miles so sympathisch macht. Er ist von vorneherein ein Loser, eine ganze Welt steht gegen ihn, und dennoch setzt er sich mit Witz und Finesse durch, und wir freuen uns mit ihm. Aber nicht alles gelingt Miles, in der Liebe zu der wunderschönen Elena muss er die bittere Pille des „besten Freundes“ schlucken, und wir fühlen mit ihm. Seinen Großvater enttäuscht er wahrlich tödlich, sein Traum von einer Karriere in der Flotte geht nicht in Erfüllung – aber er findet eine neue Perspektive bei „seinen“ erfundenen Dendarii – Söldnern, die ihn geradezu verehren und sich aus einer Lüge zur Realität entwickeln.
Ich kann diesen Roman jeden SciFi-Fan nur ans Herz legen, möchte aber dennoch zum besseren Verständnis des komplexen Universums den Einstieg mit dem ersten Sammelband, [„Barrayar – Cordelias Ehre“, 865 empfehlen.
Die offizielle Homepage der Autorin:
http://www.dendarii.com/
Bastian Sick – Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod

Bastian Sick – Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod weiterlesen
Borsch, Frank – Sternenarche, Die (Perry Rhodan – Lemuria 1)
In den Ochent-Sektor verirren sich seit jeher nur galaktische Glücksritter der besonders hoffnungsvollen (oder verzweifelten) Art. Er bildet eine Pufferzone zwischen den Machtbereichen der tellerköpfigen Blues und der hominiden Akonen, droht jedoch diese Funktion zu verlieren: Seit einiger Zeit mehren sich die Zeichen dafür, dass sich etwas anbahnt in diesem Winkel des Weltraums.
Um Terras Interessen zu wahren, begibt sich Perry Rhodan, seit Jahrtausenden Terras Mann für kosmische Verwicklungen, auf eine diplomatische Mission. Er möchte mit den Akonen verhandeln und sie auf der Seite der Menschheit wissen, sollte um den Ochent-Sektor ein Konflikt ausbrechen. Mit dem Prospektorenraumer „Palenque“ reist er unauffällig an, kommt aber nicht weit: Unter dramatischen Umständen stößt man auf ein riesiges Raumschiff, das erkennbar seit Jahrtausenden unterwegs ist.
Die Überraschung ist komplett, als man im Inneren auf – Menschen stößt! Eigentlich sind es Lemurer, d. h. Angehörige der „Ersten Menschheit“, die vor 50.000 Jahren von der Erde aus ein riesiges Imperium errichteten, Siedlerschiffe in die Galaxis schickten und nach einer Invasion der sechsgliedrigen „Bestien“ die Erde fluchtartig verließen.
Seit Äonen ist die „Nethack Achton“ also unterwegs. Das Wissen um die Herkunft oder den Grund der Reise ist in Vergessenheit geraten. An Bord hat sich ein eigener Mikrokosmos herausgebildet. Das Leben steht im Zeichen der stets begrenzten Ressourcen. Ein strenges Kastensystem mit quasi religiösen Zügen hat sich entwickelt. An der Spitze der Gesellschaftspyramide steht der „Naahk“ – zur Zeit Lemal Netwar -, der mit Hilfe einer Wach- und Schutztruppe – den „Tenoy“ – ein strenges Regime über sein Volk – die „Metach“ – führt. Dabei unterstützt ihn das „Netz“, eine künstliche Intelligenz, deren unsichtbare Fühler fast jeden Winkel der „Nethack Achton“ kontrollieren.
Allerdings nagt der Zahn der Zeit an der Technik. Außerdem mehrt sich unter den Metach der Unwillen über die Beschränkungen, die ihnen Naahk und Netz auferlegen. Was geht jenseits der Schiffsmauern vor, das wollen junge Männer und Frauen erfahren, die solchen Fragen Taten folgen lassen. Die Schiffsführung schlägt hart zurück, fordert Gegenreaktionen heraus. Der Konflikt schaukelt sich stetig hoch. In dieser Situation tritt Perry Rhodan auf den Plan. Um die Lage endgültig eskalieren zu lassen, nähert sich außerdem ein nicht zu Verhandlungen aufgelegtes akonisches Kommando …
Mehr als vier reale Jahrzehnte bringt Perry Rhodan nun schon Zucht & Ordnung ins Universum. Mal glückt ihm das, meist nur halbwegs und oft gar nicht. Unverdrossen versucht es stets aufs Neue. Das ist der Stoff, aus dem „seine“ Serie gestrickt ist, die sich zur „größten Science-Fiction-Serie der Welt“ gemausert hat.
Wobei „größte“ nicht „beste“ bedeutet. Spannende Unterhaltung möchte man den Lesern bieten, nicht mehr, nicht weniger. So lange die Latte auf diesem Niveau liegt, klappt das hervorragend. Übel wird’s dann, wenn „kosmisches Gedankengut“ sich im Geschehen breit macht; es scheint sich stets aus der legendären Schwurbelschaum-Materiequelle zu speisen …
Die „Lemuria“-Miniserie – bereits die dritte, die nach „Andromeda“ und „Odyssee“ im |Heyne|-Verlag läuft – lässt die großen universalen Mysterien außen vor. Stattdessen beackert man ein Feld, das seine Fruchtbarkeit bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. Der Zyklus um die „Meister der Insel“ (PR-Bände 200-299) gehört zu den ganz großen Favoriten der Serie. Noch in deren Sturm-und-Drang-Phase entstanden, gelang die beinahe perfekte Mischung aus Science-Fiction und Abenteuer. Praktisch sämtliche Elemente des Genres kamen zum Einsatz, wurden unbekümmert mit Horror, Krimi, Krieg und allem, was die Welt der trivialen Unterhaltung sonst zu bieten hatte, verquickt. Gleichzeitig entstand zum ersten Mal in Vollendung jene „alternative“ Geschichte der Menschheit, für die PR mit Recht gerühmt wird.
Der „MdI-Zyklus“ hat – obwohl bejahrt – seine Faszination behalten. Hier war PR noch jung, bildete das Universum einen Spielplatz, auf dem sich die Autoren tummeln konnten. Sie sprudelten über vor Ideen, die nur zum Teil oder gar nicht bis zum Ende durchgespielt wurden und werden konnten. Viele rote Fäden fransten ins Leere aus – diese Lücken und angerissenen Episoden bildeten ein Futter, von dem die Saga vom „Erben des Universums“ bis heute zehren kann.
Immer wieder forderten die Fans die Rückkehr nach Andromeda. Mehrfach wurde ihnen dieser Wunsch erfüllt, denn PR mit MdI-Touch geht mit einem Bonus ins Rennen um die Gunst der Leser, was deren Griff um die Geldbörse lockert. Auf den Glanz der Vergangenheit setzt nun auch „Lemuria“ – oder möchte setzen, denn in „Die Sternenarche“ ist von dem alten, ins reale 21. Jahrhundert transponierten Zauber nur wenig zu spüren.
Sechs Bände sind zu wenig, um einen „richtigen“ Zyklus mit MdI-Patina zu schaffen. Für einen Episodenzyklus um die „Nethack Achton“ sind es möglicherweise zu viele. Grundsätzlich ist die Idee gut, an Bord eines Generationsraumschiffs zu reisen. Seit die Meister ihr Zepter schwangen, ist viel Zeit vergangen. „Neuigkeiten“ aus Andromeda können dosiert ins Geschehen eingebracht werden. Gleichzeitig kann man sich auf Bekanntes stützen – „Lemuria“ ist auch eine „Nacherzählung“ dessen, was das PR-Team um K. H. Scheer Anfang der 1960er Jahre schuf.
Leider ist so ein Generationsraumschiff auf der anderen Seite ein limitierter Ort für eine spannende, an überraschenden Wendungen reiche Story. In einem Anhang zur „Sternenarche“ gibt Hartmut Kaspar einen Überblick über das „Generationsraumschiff in der Science Fiction“, wo es eine eigene Nische besetzt – eine enge Nische, denn in solchen Dosenraumern geht es in der Regel recht ähnlich zu. Immer ist man schon so lange unterwegs, dass die ursprüngliche Mission in einem mythischen Nebel verschwunden ist. Religiöse Fanatiker und/oder der durchgedrehte Bordcomputer haben die Macht übernommen und knechten ihre „Untertanen“, die ihrerseits vergessen haben, dass sie in ihrer privaten Welt durchs All rasen. Im Schiff selbst gibt die Technik ihren Geist auf; allerlei Improvisationen müssen das ausgleichen.
Diese Melodie erklingt auch in der „Sternenarche“. Frank Borsch gelingt es nie, dem Thema etwas Neues abzugewinnen. Wenn man ihn für etwas rühmen kann, dann ist es u. a. die handwerklich saubere Umsetzung des Plots, die das Bekannte erzählerisch dicht und angenehm lesbar präsentiert. Die pseudodramatische Hast, die schlampig-saloppe, angeblich zeitgemäße und von der jugendlichen Leserschaft gewünschte Sprache (der sog. „Maddrax-Sprech“), welche beispielsweise die Lektüre der aktuellen „Atlan“-Miniserien (zu) oft zur Qual werden lassen, geht diesem ersten „Lemuria“-Band zu seinem Vorteil ab.
Viel geschieht also nicht – im Auftaktband zu einer Serie muss das Terrain halt erst vorbereitet werden für das, was noch folgt. Dies kann dem Verfasser leicht zum Korsett werden. Zudem muss der Nicht-PR-Insider bedacht werden, den man nicht durch die geballte Wucht der Serienfakten vom Buchkauf abschrecken will. Borsch versucht diese kaufmännische Intention wie gesagt nicht zu verschleiern, sondern erzählt ruhig und solide seine Story. PR-Interna streut er nebenbei ein. Der Hardcore-Fan wird sie registrieren.
Man kann folglich nicht Borsch vorwerfen, er ruhe sich auf den MdI/Lemuria-Lorbeeren aus. Er muss mit angezogener Bremse schreiben. Erst die folgenden Bände werden zeigen, ob die Verschmelzung der glorreichen PR-Vergangenheit mit der Gegenwart wirklich gelingt und womöglich etwas für die PR-Chronik Neues, Eigenständiges schafft.
Nichts Neues ebenfalls in Sachen Figurenzeichnung. Perry Rhodan ist ein schwieriger Charakter. Einerseits muss er als „normaler Mensch“ gezeigt werden, an dessen Denken und Handeln man Anteil nimmt. Andererseits ist er wahrlich steinalt und hat so viel Außergewöhnliches erlebt, dass er womöglich ein „kosmischer“ Mensch geworden ist, der in ganz anderen Sphären beheimatet ist als der Rest der Menschheit, deren Vertreter er durch seine bloße Ausstrahlung sprachlos werden lässt. Frank Borsch versucht dieses Problem zu thematisieren, indem er Rhodan quasi stellvertretend durch die Augen der „Palenque“-Besatzung beobachtet. Sie verkörpern den „Normalterraner“, der Rhodan mit einer Mischung aus (Ehr-)Furcht und betonter Kumpelhaftigkeit begegnet. Das funktioniert gut in dem begrenzten Rahmen, der in der PR-Serie die Grenze zwischen überzeugender Charakterdarstellung und hölzern-lächerlicher Gefühlsduselei markiert, denn Borsch bleibt klug innerhalb der Bildränder. (Die „Luftgitarren-Episode“ hätte er sich und uns freilich ersparen sollen.)
Natürlich kann die Rhodansche Dualität nie durchgehalten werden. Die ehernen Gesetze des auf Bewegung und Unterhaltung getrimmten Trivialromans (ein Begriff, der übrigens zunächst keinerlei negative Wertung beinhaltet) fordern ihren Tribut. Wieso ausgerechnet Perry Rhodan in das Geschehen verwickelt ist, darüber denke man lieber nicht nach. Was hat dieser Mann auf einer unwichtigen Mission in einem unwichtigen Sternensektor verloren? Für solchen diplomatischen Kleinkram dürfte Rhodan seine Leute haben. Aber wider alle Logik muss er immer wieder an einen Ort gebracht werden, wo es gefährlich und turbulent zugeht. Als weisen Ratgeber im Hintergrund mögen die Fans ihren Perry nicht sehen; er muss auch – bildhaft gesprochen – die Fäuste schwingen.
Warum hat man nicht einen seiner (Kampf-)Gefährten mit auf die Ochent-Mission geschickt? Fast durchweg agieren nur Rhodan oder Atlan an der Front. Es gibt durchaus andere, farbenfrohe, von der Leserschaft geliebte Figuren, von denen man viel zu wenig hört. Die Besatzung der „Palenque“ bietet da kein Ersatz. Allzu austauschbar wirken die Charaktere. Die Kommandantin soll eine starke Nebenfigur darstellen. Borsch fällt dazu nur ein, ihr cholerische Züge und ein exaltiertes Verhalten aufzuprägen. Immerhin übertreibt er es nicht wie so viele seiner PR-Teamkollegen und degeneriert sie zur peinlichen, eindimensionalen Karikatur einer Figur.
Ähnlich ergeht es dem Tenoy der „Nethack Achton“. Schon wieder einer dieser absolutistischen Fundamentalisten, die sich im Besitz der „einzigen Wahrheit“ wähnen, ihre Schäflein für die „gute Sache“ unterdrücken und Abweichler unbarmherzig jagen lassen! Allerdings arbeitet Borsch auch hier mit Licht und Schatten. Tenoy ist kein tumber Bösewicht, sondern ein Mensch, der unter seinem Amt leidet, sein Tun hinterfragt und neuem Gedankengut gegenüber aufgeschlossen ist.
Selbstverständlich spielen die Gegner des Tenoy ebenfalls ihre bekannten Rollen. Jung und idealistisch sind sie, neugierig und nicht gewillt, sich länger dem System frag- und klaglos zu beugen. (Seltsam, dass Rhodan stets pünktlich dort auftaucht, wo’s gerade kritisch wird …) Dazu kommen eine zarte Liebesgeschichte plus viel persönliche Tragik, denn Helden und Heldinnen müssen schließlich leiden.
Solina Tormas schließlich fällt die Aufgabe zu, die in der PR-Chronik seit langer Zeit aus dem Blickfeld geratenen Akonen wieder in die Handlung zu führen. Als Historikerin und Spezialistin für lemurische Geschichte steht sie zwischen Akonen und Terranern – eine gut gewählte Figur, um die Differenzen und Ähnlichkeiten zwischen den Völkern (die ja beide von den Lemurern abstammen) plastisch zu machen. Man bemerkt hier die Fortschritte, die PR in mehr als vier Jahrzehnten gelungen sind: Die einst eindimensionalen, arroganten und hinterlistigen Akonen gliedern sich in Gruppen und Individuen mit eigenen, durchaus nicht chronisch unredlichen Zielen, ohne gleichzeitig jene Züge zu verlieren, die sie „akonisch“ wirken lassen.
Frank Borsch (geb. 1966 in Pforzheim) studierte bis 1996 Englisch und Geschichte in Freiburg. Um sich zu finanzieren, nahm er eine lange Reihe von Jobs an, arbeitete aber auch an einem Umwelthandbuch für Osteuropa mit und war Webmeister seiner Universität. 1996 saß er unter den Teilnehmern eines Science-Fiction-Seminars, das die Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel ausrichtete. Hier wurde er „entdeckt“: Wolfgang Jeschke, der langjährige Chefredakteur von Heynes SF-Reihe, heuerte ihn als Übersetzer an; ausgedehnte Auslandsaufenthalte und ein Intermezzo als Deutschlehrer im irischen Belfast hatten ihn mit der englischen Sprache vertraut werden lassen.
Zusätzlich übersetzte Borsch Comics für |Marvel Deutschland|. Gleichzeitig begann er zu schreiben, verfasste Romane und Kurzgeschichten, aber auch Artikel vor allem zum Thema Internet. 1998 stieg er mit „Der Preis der Freiheit“, seinem Beitrag zur „Atlan“-Miniserie „Traversan“ ins PR-Universum ein. Ab 2001 gehörte er als Redakteur dem PR-Team in Rastatt an. Seit 2004 ist er Stammautor der „Perry Rhodan“-Heftserie.
Frank Borsch lebt und arbeitet in Freiburg.
Der „Lemuria“-Zyklus …
erscheint im |Heyne|-Verlag:
1. Frank Borsch: Die Sternenarche
2. Hans Kneifel: Der Schläfer der Zeiten
3. Andreas Brandhorst: Exodus der Generationen
4. Leo Lukas: Der erste Unsterbliche
5. Thomas Ziegler: Die letzten Tage Lemurias
6. Hubert Haensel: Die längste Nacht
Leo Lukas – Der erste Unsterbliche (Perry Rhodan. Lemuria 4)
Mit diesem vierten Band des sechsbändigen „Lemuria“-Zyklus‘ leistet Leo Lukas seinen Beitrag zu der bisher außerordentlich spannenden und unterhaltsamen Geschichte um Zukunft und Vergangenheit der Menschheit. Das Wiener Multitalent wurde innerhalb der Perry-Rhodan-Fangemeinde schnell zu einem der beliebtesten Autoren, da er mit seiner überschwänglichen Art alte und festgefahrene Strukturen in der Serie öffnete und ihr nach langer Zeit wieder humorvolle Romane bescherte und immer noch beschert. Mit seiner zweiten Leidenschaft, seiner Arbeit als Kabarettist, ist er auch längst kein Unbekannter mehr. Und trotz dieses Hangs zur Verbreitung seines Lachens bringt er immer wieder hochkarätige Romane ein, deren Humor hintergründig ist.
Perry Rhodan trifft mit den beiden Forschungs- und Prospektorraumschiffen vor dem Akon-System ein, dem Heimatsystem der Akonen. Die dritte entdeckte Sternenarche steht unter dem Hoheitsanspruch der Akonen, Rhodan ist der Zutritt ohne diplomatische Schwierigkeiten verwehrt. Über einen geheimen terranischen Stützpunkt dringt er unerkannt in das System ein und erkauft sich eine Transmitterpassage zur Arche. Zeitgleich verschaffen ihm die kaltgestellten Akonen des zweiten Raumschiffs mit erpresserischen Methoden einen semioffiziellen Zugang, so dass es bei Rhodans Entdeckung einige Verwirrung gibt, die er mit gutmütiger Geschicklichkeit zur allgemeinen Zufriedenheit auflöst.
An Bord der Arche findet sich eine relativ fortschrittliche Lemurerzivilisation – kein Wunder, da der „Verkünder“ Levian Paronn Kommandant dieses Schiffes ist. Doch ist er offensichtlich abwesend. Währenddessen wurde eine vierte Arche aufgebracht, deren Bewohner unterentwickelte Klone der unsterblichen Kommandantin sind, immun gegen jene unbekannte Seuche, der schon die anderen Archenbewohner zum Opfer fielen. Dem Anführer der Klongesellschaft gelang mit parapsychischer Kraft die Ermordung der Kommandantin, seither trägt er ihren Zellaktivator.
In Zwischenspielen erhält der Leser Einblicke in Levian Paronns persönliches Tagebuch und erfährt dadurch, dass der „Verkünder“ sich in unmittelbarer Nähe befindet und die ganze Sache geplant hat, dabei seiner Ansicht nach sogar die Freundschaft des „Hüters“ Icho Tolot ausgenutzt hat, um die Menschheit vor der angeblich drohenden Vernichtung zu bewahren – was ja auch schon der Sinn des Archen-Projekts war.
Während also Rhodan die dritte Arche nach Paronn absucht, trifft dieser unerkannt mit anderen Akonen auf der vierten Arche ein und verängstigt den unsterblichen Mutanten derart, dass dieser sein Heil in der Flucht sucht. Dabei bringt er durch seine geistige Macht auch das Tagebuch Paronns an sich, der sich später voller Eifer an der Jagd nach dem Mutanten beteiligt – vorgeblich wegen der von ihm ausgehenden Seuchengefahr für die Akonen. Denn wenn das Buch in Rhodans Hände fallen sollte, geriete sein gesamter Plan in Gefahr, schließlich ließe sich niemand, und schon gar nicht Rhodan, gern manipulieren.
Zu einem vorläufigen Showdown kommt es auf einem nahe gelegenen Planeten, auf dem neben mehreren Tausend echten „Bestien“ auch eine Zeitmaschine steht, durch die Paronn eine ultimate Waffe in die Vergangenheit schaffen und damit ein gigantisches Zeitparadoxon herbeiführen will, um den Exodus der Lemurer vor fünfzig Jahrtausenden zu verhindern. Er offenbart sich Rhodan, doch nicht nur dieser will ihn an der Tat hindern. Auch Tolots Doppelgänger taucht auf und lüftet sein Geheimnis …
»Sehr groß und weit ist das Universum und vorwiegend schrecklich leer, aber auch voll der Wunder.
Ich habe Tage benötigt, um diesen Satz auszuformulieren. […] Sehr groß und weit ist das Universum und vorwiegend schrecklich. Leer, aber auch voll der Wunder…« (Seite 11)
In diesem Beispiel wird Lukas‘ Wortgewandtheit auf Anhieb deutlich. Er spielt mit den Worten, würfelt sie durcheinander. In diesem kurzen Abschnitt skizziert er den Charakter Paronns aus dessen eigener Sicht, nachdem Andreas Brandhorst sich in seinem Roman an die Außenansicht durch den Chronisten gehalten hat, und vertieft diese Studie im Laufe des Romans durch weitere Tagebucheinträge, bringt Paronns Motivation näher, so dass man endlich seine Borniertheit nicht tolerieren, aber verstehen kann, da es ihm um sein quasi ausgestorbenes Volk geht. Er kann sich nach diesen Jahrtausenden nicht mit Terranern, Akonen oder anderen Lemurerabkömmlingen identifizieren und setzt deren Existenz aufs Spiel, ja sogar dem sicheren Untergang liefert er sie aus mit der Planung des gravierenden Paradoxons.
Anfangs erscheint die Einführung der vierten Arche um die zwergenhaften Klone überflüssig in ihrer Ausführlichkeit, scheint nur eine weitere Facette der unterschiedlichen Entwicklungen auf den Generationenschiffen zu sein. Der Ausbruch des infizierten Mutanten in die akonische Gesellschaft schien eigens der Rechtfertigung dieser Geschichte zu dienen, doch im Finale findet auch er seine wirkliche, nachvollziehbare und befriedigende Berechtigung, so dass man Lukas fast keine Wortschinderei vorwerfen kann. Fast.
In zwei Handlungssträngen findet sich rhodantypisches Beiwerk: Starke, ausführliche Beschreibungen von technischen Details wie die seitenlange Erläuterung zu verschiedenen Hyperkristallarten, wo es auch ein schlichtes „notwendig für die Technik“ getan hätte; oder seriengeschichtliche Hintergrundinformationen zu den so genannten Bestien, ihrer Entstehung und schließlichen Vernichtung. Bisher konnten die Autoren des Minizyklus‘ sehr wohl auf diese typischen Ausschmückungen, die in der Heftserie einen wichtigen Teil übernehmen, verzichten, was sich wohltuend auf die Geschichte ausgewirkt hat und meines Erachtens in dieser Zyklusform nur unnötiger Ballast ist, der serienfremde Leser wahrscheinlich mehr verwirrt als erleuchtet.
Man stößt hin und wieder auf „Austriazismen“, die Lukas (wahrscheinlich unbewusst) aus seiner Heimatsprache übernimmt, die aber leider nicht immer selbsterklärend sind. So konnte ich zum Beispiel in einem informativen Internetforum herausfinden, dass „Steht das dafür?“ so viel bedeutet wie „Ist es das wert?“.
Mit Hubert Haensel als Exposéredakteur geht man bei diesem Zyklus tatsächlich neue Wege: Schon nach vier Romanen gibt es die Auflösung einer der großen Fragen, die sich so angesammelt haben. Man schindet nicht mehr Platz und Zeit mit belanglosem Nebengeplänkel, um alle Kracher ganz zum Schluss bringen zu können. Das hält die Spannung durch jeden Band. Jetzt sind nur noch wenige „große“ Fragen offen: Wer Levian Paronn ist, wissen wir noch immer nicht. Also wo er herkommt, wie er an den Zellaktivator kam und was für eine Rolle er in einem größeren Spiel spielt. Immerhin ist jetzt klar, dass ein gewisser Haluter ihn mit den Informationen über die Zukunft versorgt hat.
Insgesamt bietet dieser Roman wieder entspannenden Lesegenuss und bringt mehr Antworten als neue Fragen. Trotzdem ist er entgegen meiner Erwartungen der bisher schwächste Roman des Zyklus, was aber eine relative Aussage bleibt, da die ersten Bände und vor allem der direkte Vorgänger von Brandhorst einfach hervorragend sind.
Der Autor vergibt: 



Hearn, Lian – Schwert in der Stille, Das (Der Clan der Otori – Band 1)
Bisher hatte der junge Tomasu noch keine Vorstellung davon, was Menschen einander antun können – bis zu dem Tag, als die Reiter vom Tohanclan sein Dorf dem Erdboden gleichmachen, alle Menschen töten und auch seine Familie nicht verschonen. Von diesem Tag an nimmt das Leben des 15-Jährigen eine dramatische Wendung – Auf der Flucht vor den Mitgliedern des Tohanclans, denen er in jener schrecklichen Nacht noch begegnet ist, trifft er auf Lord Shigeru Otori, den Anführer der Otori, der sich seiner annimmt. Als Dank dafür, dass Shigeru ihm das Leben gerettet hat, legt Tomasu sein Schicksal vollständig in die Hände des Clans und entdeckt mit dem Leben im Schloss des Lords eine völlig neue Sichtweise auf die Dinge. Aus dem schlauen Jüngling Tomasu wird der intelligente Takeo, ein junger Schüler, der unter seinen Lehrmeistern die Bräuche des Clans, die Malerei und die Kampfkunst erlernt und darüber hinaus Fähigkeiten entdeckt, von denen er bislang noch nichts wusste.
So erlernt Takeo die Fähigkeit, für eine kurze Zeit unsichtbar zu sein oder aber an zwei Stellen zur gleichen Zeit zu erscheinen, eine Methode, die ihm an mancher späteren Stelle noch als lebensnotwendig erscheinen soll. Gleichzeitig findet Takeo aber auch vieles über seine Vergangenheit und die Geschichte seiner Familie heraus und stellt dabei fest, dass er gar nicht so zufällig auf Lord Shigeru getroffen ist.
Zur gleichen Zeit aber wird an anderer Stelle das Schicksal der jungen Kaede erzählt, die von ihren Eltern als Geisel an die Kriegsherren abgegeben worden ist und dort bis aufs Äußerste verachtet wird. Nach einigen tödlichen Zwischenfällen sagt man ihr nach, dass ihre Anwesenheit den Tod bringe. Eines Tages ändert sich auch ihr Schicksal, denn um das Bündnis zwischen den beiden Clans zu beschließen, soll Kaede den Lord des Otori-Clans ehelichen. Gegen ihren Willen tritt sie die Reise an, lernt dabei ebenfalls den mittlerweile herangereiften Takeo kennen und verliebt sich in ihn. Auch Takeo ist von der jungen Dame angetan, darf sich aber aus Respekt nicht dementsprechend verhalten.
Mit der Zeit bekommt Takeo jedoch immer mehr zu spüren, was eigentlich hinter der Geschichte der einzelnen Clans steht, welchen Zweck er in dieser ganzen Sache erfüllt und welche politischen Intrigen und Lügen sich aus den ganzen Ränkespielen seines Lords ergeben. Schließlich gerät Takeo in eine Welt der Geheimnisse, der Lüge, aber vor allem der Rache.
Liebe und Rache, Treue und Verrat, Schönheit und Tod, um all jenes geht es im ersten Teil der Reihe um den Clan der Otori, und es ist schon sehr beeindruckend, wie die Oxford-Studentin Lian Hearn all diese Werte miteinander verknüpft, ohne dass dabei auch nur annähernd Verwirrung entsteht. Im Gegenteil, von der ersten Zeile an hat die Wahl-Australiern eine fesselnde, fiktive Geschichte entwickelt, die ganz klar an die japanischen Traditionen des Mittelalters angelehnt ist, in dieser Form aber indirekt auch an aktuelle Themen anknüpft. Sehr imponierend ist, wie detailliert sie die vielen Charaktere beschreibt, ihre Verhältnisse und Beziehungen zueinander erläutert, dabei aber überhaupt nicht ausschweifen muss. Schon sehr bald hat man sich so in die Welt der Otori und ganz besonders in den Körper des Takeo, der hier aus der Ich-Perspektive beschrieben wird, versetzt und verspürt den Drang, immer weiter in die verlogene Welt der Lords und ihrer Mitstreiter einzudringen.
Dabei schafft es Hearn immer wieder, den Leser aufs Neue mit plötzlichen Wendungen und Überraschungen zu konfrontieren; Spannung ist jedenfalls von Anfang an garantiert. Lediglich die Tatsache, dass die beiden Protagonisten Kaede und Tomasu alias Takeo eines Tages aufeinandertreffen, war vorhersehbar, macht die Geschichte aber nur noch interessanter, da sich hierdurch ganz neue Verknüpfungen und Spannungsmomente ergeben, die man dringend erforschen möchte.
Trotz ihrer einfachen Schreibweise – prinzipiell konzentriert sich Lian Hearn abgesehen von einzelnen Landschaftsbeschreibungen nur auf das Wesentliche – hat die Autorin so einen Roman erschaffen, der nicht nur fasziniert, sondern auch zum Nachdenken anregt. Und noch einmal muss ich erwähnen, wie toll Hearn die Figur des Takeo lebendig werden lässt; um dies erneut zu verdeutlichen: ein Junge, der sein ganzes Hab und Gut, seine Familie, seinen ganzen Besitz, ja seine ganze Welt verliert und dennoch die einzig sich bietende Chance ergreift, um ein neues sinnvolles Leben zu starten, in dem er zur Hauptfigur eines politischen Machtspiels wird. Ebenso gelungen ist es, wie die Schriftstellerin auf geheimnisvolle Weise von den Kriegen der Clans erzählt, vom mysteriösen ‚Stamm‘ berichtet und immer wieder Hinweise zu Takeos Vergangenheit ins Spiel bringt, diese aber erst einmal offen lässt – all das zeugt von ganz großer Klasse und macht dieses Buch zu einem dringenden Lesetipp. Ganz gleich, welche Art von Belletristik man privat bevorzugt, „Das Schwert der Stille“ enthält von allen Stilelementen ein wenig und legt sich so im Hinblick auf die Zielgruppe keine Beschränkungen auf. Ich denke, genau dass ist es, was die Arbeit einer hervorragenden Autorin auszeichnet.
|Empfohlen ab 14 Jahren
Peter Pan Prize 2004 (IBBY Schweden)
Deutscher Jugendliteraturpreis 2004 (Jugendjury)
„Die besten 7 Bücher für junge Leser“, Deutschlandfunk / FOCUS: September 2003|
Deutsche Webseite: http://www.otori.de
Hughart, Barry – Insel der Mandarine, Die (Meister Li Band 3)
Band 1: [„Die Brücke der Vögel“ 914
Band 2: [„Der Stein des Himmels“ 927
Meister Li und Nummer Zehn der Ochse wohnen als Zeugen der Hinrichtung eines Verbrechers bei, den sie unter vielen Mühen dingfest gemacht haben. Nur leider kommt ihnen ein Leichenfresser dazwischen, der von Grabräubern aufgestört wurde. Er trägt einen angefressenen Kopf mit sich herum, der allerdings noch frisch ist. Die dazugehörige Leiche war ein hoher Mandarin und liegt in der Nähe seiner Klause auf der Magnolieninsel im Nördlichen See Pekings. Neben ihm findet Meister Li einen seltsamen Käfig, der ihm eine Menge Kopfzerbrechen bereitet, und außerdem in einiger Entfernung einen Tunnel, der zu einer Schmugglerhöhle führt. Aber ging es bei dieser ganzen Angelegenheit wirklich nur um Schmuggel? Warum hat jemand das alte Relief im Tunnel zerschlagen? Warum stiehlt ein Mandrill Käfige, die genauso aussehen wie jener neben dem toten Mandarin? Und was sind das für seltsame Wesen, die auf die unglaublichsten Arten die vormaligen Besitzer der gestohlenen Käfige ums Leben bringen?
Um das herauszufinden, muß Meister Li unbedingt das Rätsel der Käfige lösen. Zusammen mit Ochse, dem Puppenspieler Yen Shih und dessen Tochter Yu Lan, einer Schamanin, macht Meister Li sich auf die Suche nach den Käfigen, die noch nicht gestohlen wurden.
„Die Insel der Mandarine“ ist der dritte Band von Barry Hugharts Meister-Li-Romanen. Diesmal geht es gleich um zwei Aspekte chinesischer Kultur.
Der Teeschmuggel der hohen Mandarine beleuchtet die Machenschaften der Eunuchen hinter dem Rücken des Kaisers, der zwar theoretisch als Sohn des Himmels absolute Macht besitzt, jedoch praktisch gesehen vollkommen von seinen Beamten abhängig ist, da er in seiner verbotenen Stadt vom „normalen“ Leben und den Menschen seines Volkes komplett abgeschottet ist. Dieser Umstand wird weidlich ausgenutzt, Korruption ist ohnehin selbstverständlich und die Bereicherung ungeheuerlich.
Die Käfige, die von den Schmugglern benutzt werden, bilden das Bindeglied zum Schamanismus und der Urreligion der Völker, die das Land bewohnten, ehe die Chinesen kamen. Die Urreligion wurde größtenteils ausgemerzt. Einige Götter, die zu mächtig waren, wurden in die Gruppe der taoistischen Götter aufgenommen, Götterdämonen und Ähnliches sind aus dieser Zeit übrig geblieben und auch das Ritual des Drachenbootrennens, das den Höhepunkt des Buches bildet.
Natürlich muß Meister Li erst in einigen fast vergessenen Schriften und Volkssagen kramen, ehe er die Zusammenhänge herausfindet.
Das Krimirätsel ist wieder interessant aufgebaut, allerdings ist es nur Kennern der chinesischen Kultur möglich, die Lösung allein zu finden. Der kulturelle Teil ist diesmal am stärksten gewichtet, auf Kosten anderer Elemente.
Es ist relativ rasch klar, welche Person hinter all den Verwicklungen steckt. Nach dem aufregenden Anfang hängt der Spannungsbogen deshalb zunächst etwas durch und strafft sich erst zum Finale hin. Die beteiligten Personen sind weniger skurril als bisher, die Handlung weniger turbulent. Was ich allerdings am meisten vermisste, war der Wortwitz der Vorgängerbände. Er fehlt bei diesem Buch fast völlig. Der bisher so gelungenen Mischung aus Krimi, Fantasy und chinesischer Kultur geht dadurch der Pfiff verloren. Wie überaus schade!
Das Lektorat dagegen wurde gegen Ende immer besser. Enthielt der erst Band noch einige Schnitzer, waren es beim zweiten schon weniger und beim dritten ist mir überhaupt nichts aufgefallen.
Auch die Coverentwürfe gefallen mir gut. Die Darstellungen haben zwar nicht unbedingt etwas mit dem Inhalt zu tun, passen aber zum Flair des Schauplatzes.
Insgesamt gesehen sind die Meister-Li-Krimis eine angenehme und äußerst lesenswerte Abwechslung im Fantasy-Genre. Mit ihren gut dreihundert Seiten sind die einzelnen Bände überschaubar. Sie sind inhaltlich abgeschlossen und nicht voneinander abhängig, sodass sie nicht unbedingt am Stück gelesen werden müssen, sondern auch mal etwas anderes dazwischen geschoben werden kann. Sie sind witzig, unterhaltsam und interessant. Zwar schwächelt der letzte Teil gegenüber den vorhergehenden ein wenig, trotzdem ist er immer noch ideenreich und bunt und nicht wirklich schlecht.
In diesem Schwächeln liegt aber möglicherweise der Grund dafür, dass es keine weiteren Meister-Li-Bände gibt. Nun, nicht nur das Fortsetzen einer Serie, auch das rechtzeitige Aufhören ist eine Kunst.
Barry Hughart wurde 1934 in Illinois geboren. Seine Kenntnisse über die chinesische Kultur schöpfte er aus Büchern über Religion und Kultur, Land und Leute, als er im Rahmen seiner Militärzeit bei der US Airforce in Fernost stationiert war, das Festland aber nicht betreten durfte. Die Faszination für dieses Land war so stark, dass er schließlich, zwanzig Jahre später, die Meister-Li-Romane verfasste. Außer seinen Romanen schrieb er auch Filmdialoge, unter anderem für „Devil´s Bridge“, „Man on the Move“ und „The Other Side of Hell“. Heute lebt er in Tucson, Arizona.
http://www.barryhughart.org/
David Morrell – Totem
Potter’s Field ist eine kleine Gemeinde im US-Staat Wyoming. Farmer stellen hier die Mehrheit der Bürgerschaft. Das Leben ist hart und schlicht, die Verbrechensrate niedrig. Das gefällt vor allem dem Polizeichef Nathan Slaughter. Nachdem er, der Star der Detroiter Mordkommission, versehentlich zwei minderjährige Diebe niederschoss, ist sein Nervenkostüm angegriffen. In der Provinz möchte er wieder zu sich finden.
Leider hat er sich keinen idealen Ort für den Neuanfang ausgesucht. Potter’s Field war vor sechs Jahren Zentrum einer bizarren Tragödie. Der Sektenguru Quiller hatte sich mit 200 Hippie-Gläubigen in der ‚unverdorbenen‘ Wildnis ein neues Utopia schaffen wollen. Im strengen Winter von Wyoming hatte der Traum im Desaster geendet; zu Dutzenden waren die Unglücklichen erfroren. Der Journalist Gordon Dunlap hatte damals einen bemerkenswerten Bericht über diese Ereignisse verfasst. Das Grauen hatte ihn niemals losgelassen. Er ist zum Säufer geworden, der wie Slaughter in Potter’s Field sein Leben wieder in den Griff zu bekommen versucht. David Morrell – Totem weiterlesen