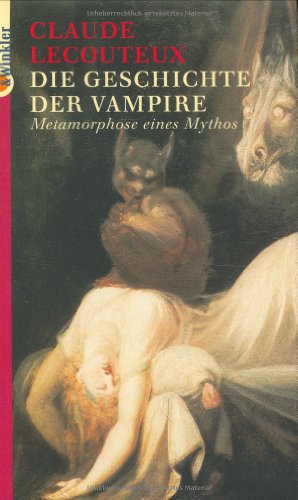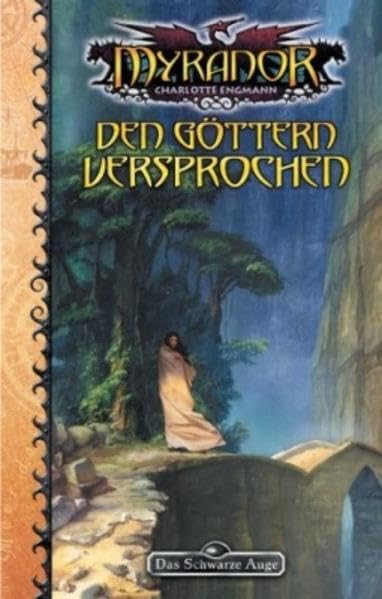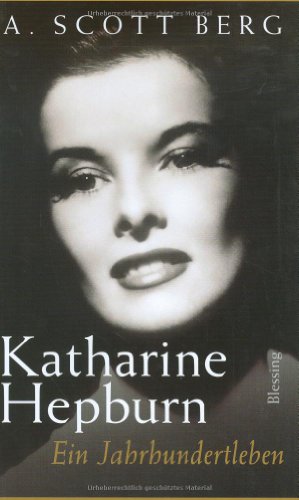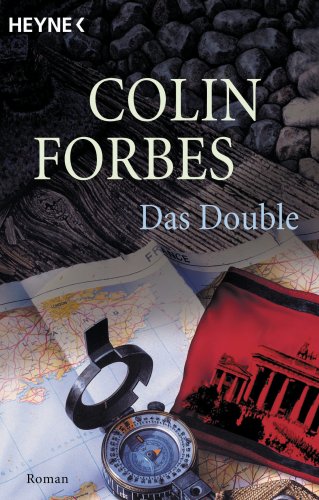Archiv der Kategorie: Rezensionen
Jonathan Neale – Schneetiger. Sherpas: Die wahren Bezwinger des Himalaya
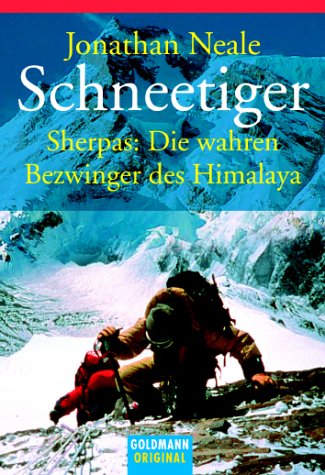
Richard Parry: Die Männer der Polaris. Die wahre Geschichte der tragischen Arktis-Expedition von 1871

Das Jahr ist 1871. Der Große Bürgerkrieg ist vorüber, die Blauen & die Grauen schlagen sich nicht mehr die Köpfe ein; Zeit für die immer noch jungen, jetzt wieder Vereinigten Staaten von Amerika, sich darauf zu besinnen, der Restwelt das Heil zu bringen, was sie bereits zu diesem Zeitpunkt als ihren von Gott (oder Gandalf) erteilten Auftrag erkannt haben.
Damit stehen sie nicht allein. Imperialismus politisch schwer im Kommen. Auf dem gesamten Globus machen sich mächtig aufgerüstete Nationen daran, ihrem Herrschaftsgebiet möglichst viele und lukrative Kolonien einzuverleiben. Die Filetstücke sind schon vergeben, als sich nun auch die USA an diesem Run beteiligen möchten. Wenn‘s nichts mehr zu erobern gibt, dann lässt sich immerhin einiger Ruhm damit ernten, unbekannte Länder zu entdecken (die dann womöglich doch das Ausbeuten lohnen). Richard Parry: Die Männer der Polaris. Die wahre Geschichte der tragischen Arktis-Expedition von 1871 weiterlesen
MacKinlay Kantor – Signal 32

Schwindt, Peter – Justin Time – Zeitsprung
Die Eltern von Justin Time verschwanden vor einigen Jahren bei einem Zeitreiseexperiment spurlos, als Justin noch klein war. Als der Junge in den Sommerferien des Jahres 2385 im Internat die Einladung seines Onkels erhält, ihn zu besuchen, ist Justin sehr froh, denn bis dato hatte sein Onkel ihn nie eingeladen und die Ferien allein im Internat waren immer langweilig gewesen.
Doch bei seinem Onkel angekommen, stellt Justin fest, dass dieser ihn scheinbar gar nicht eingeladen hat. Im Gegenteil ist der Onkel damit beschäftigt, eine eigene Zeitreiseagentur aufzubauen. Gerade hat er den ersten Reisenden in die Vergangenheit geschickt, als alles schief zu gehen scheint. Der Reisende kommt in der falschen Zeit und am falschen Ort an, verursacht dort zudem noch einen verhängnisvollen Unfall, der Charles Darwin, den Entdecker der Evolutionstheorie, töten würde, bevor dieser seine Schriften veröffentlichen konnte.
Leider reicht die Energie nur dazu aus, eine leichtgewichtige und schmächtige Person in die Vergangenheit zu schicken, um den Fehler zu korrigieren. Da Justin als einziger diese Kriterien erfüllt, reist er zurück in die Zeit, um die Abweichung zu beheben …
Um es gleich vorweg zu nehmen: Das vorliegende Buch ist der größte Schwachsinn, der dem Rezensenten in den letzten Jahren unter die Augen gekommen ist (was bei meinem hohen jährlichen „Leseaufkommen“ wirklich etwas heißen will!).
Die Geschichte wimmelt vor Peinlichkeiten, Löchern und Unmöglichkeiten. Am Ende der Geschichte bedankt sich Autor Peter Schwindt bei allen Leuten, die sich durch die verschiedenen Manuskriptfassungen gekämpft hatten. Leider scheint niemand mit auch nur leidlicher Kompetenz unter den Lektoren gewesen zu sein und der Leser fragt sich händeringend, wie dem renommierten Loewe-Verlag ein dermaßen missratenes Machwerk unterkommen konnte.
Dabei hat der Verlag sich offensichtlich Mühe gegeben, hat dem Buch für die Presse noch ein kleines Extramäppchen beigefügt, in der, zwar wenig umfassend, aber doch leidlich kenntnisreich, über Zeitreisetheorien oder literarische bzw. filmische Vorlagen referiert wird.
Dies verschlimmert die unsägliche Tat der Veröffentlichung eines dermaßen unausgegorenen Werkes aber nur noch, kann man entschuldigend für den Verlag deshalb nicht anführen, man habe von der Zeitreisethematik nie irgendwelche Ahnung gehabt.
„Justin Time – Zeitsprung“ zeigt dagegen auf, dass oberflächlicher Konsum einiger Fernsehserien (der Autor ist Jahrgang 1964 und berichtet, durch „Star Trek“, „The Avengers“ und ähnliche Fernsehserien sozialisiert worden zu sein) nicht reicht, um sich auch nur ansatzweise kompetent zu zeigen bei einem dermaßen komplexen Thema, wie es Zeitparadoxa darstellen.
Der Verdruß beginnt schon mit der Ausgangslage von Justins erstem Zeitabenteuer. Dass der Autor hier eine fadenscheinige Begründung heranzieht, warum ausgerechnet der Junge reisen muss, mag man dem unbedarften Peter Schwindt noch nachsehen. Auch die blödsinnigen Namen der Protagonisten (heißt doch der Held und seine Familie ausgerechnet „Zeit“ mit Nachnamen, der Name selbst ist ein Wortspielchen zu „just in time“ und der Assistent hört auf den sinnreichen Namen Rupert Bontempi!) sind wohl eher Geschmackssache.
Absoluter und eindeutiger Unfug ist dagegen die Entsendung eines grenzdebilen Touristen in die Vergangenheit, ohne die Methode vorher ausreichend getestet zu haben und ohne Absicherungen gegen Manipulationen in der Zeitlinie getroffen zu haben. Zum Schreien dämlich wird es dann jedoch, als der trottelige Tourist Charles Darwin durch eine unbedachte Tat tötet. Dies wird auf völlig unerklärliche Weise in der Zukunft registriert, woraufhin man sofort korrigierend eingreifen kann. Wie soll dies funktionieren, Herr Schwindt? Wenn jemand in der Vergangenheit etwas Gravierendes verändert, würden alle Protagonisten mit dieser veränderten Vergangenheit aufwachsen, ohne diese Abweichung auch nur entfernt registrieren zu können! Genau dies schildert z. B. der SF-Autor R. A. Lafferty in seiner genialen Kurzgeschichte „Thus we frustrate Charlemagne“ (dt. „So frustrieren wir Karl den Großen“), in der mehrfach Änderungen der Zeitlinie vorgenommen werden, die Protagonisten aber immer wieder von Neuem der festen Überzeugung sind, sie seien die ersten, die diesen Versuch unternähmen.
In dem SF-TV-Film „Zeitreise in die Katastrophe“ bedient man sich deshalb eines Zeitabschirmfeldes, welches zumindest scheinbar einige Leute in einem zukünftigen Bunker sich an die ursprüngliche Vergangenheit erinnern lässt, so dass man bei Abweichungen in der Zeitlinie rekorrigierend in der Vergangenheit eingreifen kann. In diesem Film (der inhaltlich verdammt an das vorliegende Buch erinnert, jedoch eindeutig niveauvoller ausfällt!) ist es eine kriminelle Organisation in der Zukunft, die illegal Zeitreisen zu berühmten Katastrophenvorfällen anbietet und die durch ihr Einwirken die Zeitlinie schließlich irreparabel beschädigt.
Doch was hat sich der Autor Peter Schwindt in seiner dürftigen Hervorbringung zurechtgebastelt: Ein unerprobter, aber staatlich genehmigter Zeittourist der völlig unbedarften Art, der in der Vergangenheit wütet wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen, ohne dass die Änderungen sofort wirksam werden.
Welch merkwürdige surreale Zeittheorie mag im Kopf des Autors dabei herumspuken? Herr Schwindt, geben Sie es zu, Sie haben keine Ahnung! Denn der frühe Tod Charles Darwins würde alle Protagonisten mit dem Wissen aufwachsen lassen, dass ein anderer zu einem späteren Zeitpunkt die Evolutionstheorie begründet hat! Der Name Charles Darwin wäre einfach aus den Gechichtsbüchern getilgt gewesen, weil er nämlich nie drin war, und niemand würde sich mehr an ihn erinnern, vor allem nicht Ihr schlauer Protagonist und seine Helfer!
Auch über die Eigenschaft der Zeitmaschine, die Zeitreisenden nicht nur zeitlich, sondern offensichtlich auch örtlich zu versetzen (landen der Tourist und Justin doch irgendwo im Atlantik auf einem Expeditionsschiff, der Touri dabei sensationell viele Meter über dem Boden im Krähennest, einfach so!), verliert der Autor weder eine Silbe noch einen einzigen Gedanken.
Nebenbei führt der Autor zudem die Motivation der Protagonisten aus, sich an Zeitreisen zu beteiligen. Dabei ist dann Folgendes zu lesen (S. 54 unten): „Wenn er ehrlich war, konnte er verstehen, warum seine Eltern an diesem Projekt gearbeitet hatten. Die Welt des Jahres 2385 war alles andere als ein spannender Ort. Die Luft war sauber und roch nach Veilchen. Naturkatastrophen hatte die Wissenschaft seit der Erfindung des Terraforming einfach abgeschafft. Innerhalb weniger Minuten konnte man an jeden Ort der Welt reisen. Die Meere waren restlos erforscht, der Weltraum erobert. (sic!) Kurz: Es gab keine Überraschungen mehr, die die Menschen aus ihrer betulichen Ruhe reißen konnten …“
Wie, Herr Schwindt? Der Weltraum ist erobert? Vollständig? All die Milliarden und Abermilliarden Sonnensysteme, welche alleine in unserer Milchstraße zu finden sind, und zudem alle Abermilliarden von fremden Galaxien auch? Haben Sie überhaupt auch nur annähernd eine Vorstellung davon, wie groß das Universum wirklich ist (was natürlich kein Mensch je wirklich begreifen kann!)? Keine Überraschungen mehr? In welcher hohlen Luftblase seines Kopfes lebt der Autor eigentlich? Peinlicher geht es aber wirklich gar nicht mehr!!!
Abgesehen von diesen gravierenden, völlig irreparablen und katastrophalen formalen Fehlern überzeugt das Buch auch bezüglich der Charakterisierungen nicht. Die Figur des Justin Time ist so flach wie eine Briefmarke, nicht einmal sein Alter teilt der Autor dem Leser einigermaßen nachvollziehbar mit (man erfährt nur, er sei seit sieben Jahren im gymnasialen Internat; ist er damit in der siebten Klasse oder in der elften nach vier Jahren Grundschule?).
Auch sonst bleiben die Protagonisten und deren Umgebung blass.
Justin, obwohl als Sohn zweier berühmter Forscher und als Gymnasiast doch hoffentlich wenigstens durchschnittlich intelligent, entblödet sich zudem nicht, kaum bei Charles Darwin angekommen, mit diesem dessen berühmte Theorie zu diskutieren. Was wenn dieser die Evolutionstheorie noch gar nicht richtig entwickelt gehabt hätte zu dieser Zeit? Oder weiß Justin aus dem Kopf genau, wann dies der Fall war? Was wenn Justins Eingriff erst die berühmte Theorie erschaffen würde? Wer wäre dann deren wahrer Schöpfer gewesen? Wer hätte den genialen Gedanken dann wirklich zuerst gehabt?
Weder Justin noch sein Schöpfer verschwenden auch nur einen Gedanken daran. Kann man da von zumindest durchschnittlicher Intelligenz beim Protagonisten sprechen? Doch sicherlich nicht!
Der Auftakt einer neuen Serie soll das vorliegende Buch sein, doch leider ist nichts als grober Unfug daraus geworden, hanebüchener Quatsch.
Und dies, obwohl gerade der Loewe-Verlag in den letzten Jahren durch hervorragende Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Phantastik auf sich aufmerksam gemacht hat (z. B. zwei tolle Trilogien von Kai Meyer und Nancy Farmers hervorragenden SF-Roman „Das Skorpionenhaus“).
Wie konnte den Lektoren dort nur dieser Lapsus unterlaufen? Man wünscht dem Verlag den Mut, diesen Rohrkrepierer möglichst schnell wieder vom Markt zu nehmen und einzustampfen, die restlichen Folgen der Serie unter beschämtem Schweigen zu begraben, um sich damit nicht vollständig der Lächerlichkeit preiszugeben und sich auf Werke zu konzentrieren, die nicht komplett alogisch, an den Haaren herbeigezogen und unreflektiert sind, wie dies leider bei „Justin Time – Zeitsprung“ der Fall ist.
_Gunther Barnewald_ ©2004
Lothar-Günther Buchheim – Der Abschied

Der Autor
Gentle, Mary – blaue Löwe, Der (Die Legende von Ash 1)
Die Söldnerin Ash verteidigt Burgund vor einer karthagischen Invasion Europas durch die Westgoten. Golems und eine tagelange Sonnenfinsternis über Deutschland inklusive. Mittelalter paradox – Dr. Pierce Ratcliff kann es kaum fassen, sein Manuskript, eine Biographie des Lebens von Ash, widerspricht allem, was bisher über diese Zeit bekannt war. Für ihn noch unverständlicher: Was vor wenigen Monaten als wissenschaftlich gesicherte Historie angesehen wurde, findet sich plötzlich als Heldenepos unter Fiktion einsortiert… und vor Tunis werden Reste seiner Golems bei einer Ausgrabung entdeckt.
Mary Gentle’s DIE LEGENDE VON ASH („Ash: A Secret History“) ist im englischen Original ein Buch von 1120 Seiten – die deutsche und amerikanische Ausgabe wurden jeweils auf vier Bände verteilt. Das britische Original muss sehr kleingedruckt sein, denn auch die amerikanische Fassung kommt auf 1728 Seiten – die deutsche Übersetzung hat 2326 Seiten zu bieten, insofern ist die Entscheidung des Lübbe-Verlags, den Roman aufzuteilen, durchaus nachvollziehbar.
Die Autorin hat einen ungewöhnlichen und vielseitigen Werdegang aufzuweisen; die 1956 in Sussex geborene Mary Gentle arbeite unter anderem in Kinos, für Essen-auf-Rädern und begann erst 1981 mit ihren Studien (kombinierter Bachelor-Studiengang Politik/Englisch/Geographie) – zweifellos gekrönt mit ihren Master-Abschlüssen in Kriegsgeschichte und Geschichte des 17. Jahrhunderts im Jahr 1995. Ihren ersten Roman, „A Hawk in Silver“, schrieb sie schon im Alter von fünfzehn Jahren. Gentle’s Lebensgefährte ist passenderweise Lehrer mittelalterlicher Schwertkampftechniken.
Beste Voraussetzungen für einen Roman über diese Zeit, „Ash“ war ungewöhnlicherweise sogar der Grund für ihr Studium der Kriegsgeschichte, nicht umgekehrt. Mary Gentle hat jedoch weit mehr geschaffen als einen historischen oder Fantasy-Roman: Ash ist ein ungewöhnlicher Mix aus beidem, mit einer Prise Science-Fiction und schwerlich einem bestimmten Genre zuzuordnen – ein perfekter Kandidat für Lübbe’s „Bibliothek der Phantastischen Literatur“. Die Legende von Ash ist in Stil und Inhalt innovativ und nahezu einzigartig.
BAND 1: DER BLAUE LÖWE
Das düstere Mittelalter hatte seine Lichtgestalten: Jeanne d’Arc, die Jungfrau von Orleans, ist noch heute eine französische Nationalheldin.
Umso erfreulicher für Dr. Pierce Ratcliff, dass er einen alten Text über einen der seltenen weiblichen Condottiere (Anführer von Söldnerarmeen) entdeckt hat, der im späten 15. Jahrhundert nur unwesentliche Zeit nach der heiligen Johanna seine Schlachten schlug. Ash oder Esche ist jedoch keinesfalls eine Heilige oder Jungfrau: Schon im zarten Alter von acht Jahren ihrer Unschuld beraubt, schlug sie sich in einem Söldnerhaufen durch, bis sie mit Vierzehn selbst das Kommando über eine eigene Truppe übernahm. Dabei war ihr außerordentlich behilflich, dass sie wie Johanna eine „Stimme“ hört, wobei sich Ash’s Heiligenstimme allerdings auf sehr konkrete taktische Ratschläge im Kampf beschränkt. In Kombination mit ihren Führungsqualitäten ist Ash’s Truppe mit der Standarte eines azurblauen Löwen eine der begehrtesten Söldnereinheiten Europas.
Kaiser Friedrich sieht eine hervorragende Gelegenheit, sich die Dienste der nach Land statt Gold dürstenden Hauptfrau zu versichern: Er vermählt sie mit Fernando del Guiz, natürlich mit dem Hintergedanken, dass ihre Kompanie damit in seinen Besitz übergeht – Guiz ist ein Vasall des Kaisers, und damit auch dessen Ehefrau…
Ratcliff will ein Buch darüber veröffentlichen – doch während der Korrespondenz mit seiner Lektorin Anna Longman wird ihm erst das ganze Ausmaß seines Fundes bewusst: Erst hält er es für Dichtung und Übertreibung, als von einem westgotischen Reich in Karthago, einem „Leeren“ statt „Heiligen“ Stuhl in Rom, einer tagelangen Sonnenfinsternis über Deutschland und lebendigen Golems, Maschinen aus Stein, die Kurierdienste zwischen den karthagischen Truppenverbänden übernehmen, die Rede ist.
Spätestens nachdem er von einer karthagischen Invasion Westeuropas liest, zweifelt auch er: Mailand und Venedig wurden niedergebrannt, während westgotische Truppen unaufhaltsam auf ihr Endziel vormarschieren: Burgund, dem reichsten Herzogtum mit dem größten Ritterheer der Christenheit. Aber warum gerade Burgund? Was interessiert die Karthager so sehr in Burgund, dass sie die reichen Handelsstädte Venedig und Mailand ignorant niederbrennen? Reichtum und Macht scheiden aus – das ist kein gewöhnlicher Krieg, eher ein Kreuzzug, dessen Motivation nach wie vor schleierhaft ist.
Mit dichterischer Freiheit, Übertreibung und ungenauen Zeitangaben kann Ratcliff sich solche Diskrepanzen nicht mehr erklären, auch seine Lektorin Anna meint, so etwas kann man nicht veröffentlichen. Bis Dr. Napier-Grant, eine alte Bekannte von Ratcliff, in Tunesien etwas ausgräbt, das exakt seiner Beschreibung der karthagischen Golems entspricht – mehr noch, Abnutzungsspuren an den Metallgelenken und den steinernen Fußsohlen zeigen, dass diese Maschine sich bewegt haben muss.
Ratcliff bricht sofort nach Afrika auf und übersetzt so schnell er kann weiter seine lateinischen Quelltexte. In diesen ist von Ash’s Widerstand gegen die Heirat mit Fernando die Rede, den sie allerdings sehr attraktiv findet. Ihre Flitterwochen sind jedoch kurz – beide werden getrennt, als sie mitten in den Aufmarsch der Westgoten geraten. Der feige Fernando wird gefangengenommen und schwört seinen neuen Herren Treue, während Ash sich in das deutsche Reich zurückziehen kann, das seit Tagen unter einer an das ewige Zwielicht Karthagos erinnernden Dunkelheit leidet, die für Entsetzen unter der Bevölkerung sorgt. Sie nimmt Kontakt zu der „Faris“, dem kommandierenden General der Westgoten, auf, um eine „Condotta“ (Söldnerkontrakt) auszuhandeln. Die Gerüchte über die karthagische Heerführerin sind befremdend, angeblich hört sie die Stimme einer „machina rei militaris“ aus Karthago, die von ihren Soldaten als der „Steingolem“ bezeichnet wird. Das Aufeinandertreffen der beiden Frauen ist für beide ein Schock: Die Faris ist äußerlich eine vollkommene Kopie von Ash, sie könnte ihre Zwillingsschwester sein, und Ash beginnt zu ahnen, dass sie nicht die Stimme eines Heiligen, sondern die des Steingolems hört… und das wird für Ash zum Problem: Die Faris glaubt ihr nicht, dass sie eine Stimme hört – sie selbst ist das Ergebnis jahrhunderterlanger „Zucht“, eine Sklavin des Hauses Leofric, einem der mächtigsten karthagischen Emire, und nur sie sollte den Steingolem hören können.
Man will Ash in Karthago sehen, aber diese ist nicht gewillt – es kommt zum offenen Bruch und zum Gefecht, der azurblaue Löwe schlägt sich nach Burgund durch und erhält von John de Vere, dem Earl of Oxford, einen neuen Kontrakt. Doch anstatt Ash in England im Konflikt zwischen den Häusern Lancaster und York (Rosenkrieg!) einzusetzen, sieht er sich gezwungen, seine europäischen Besitzungen in Flandern, die dem bedrohten Burgund anhängig sind, zu verteidigen. Herzog Karl (der Kühne) von Burgund zögert nicht, Ash für die geplante Feldschlacht bei Auxonne aufzustellen – erst danach soll sie mit de Vere ihren Plan, Karthago anzugreifen und den Steingolem zu vernichten, durchführen.
Ein echter Knüller – aber zu Ratcliffs Entsetzen teilt ihm Anna mit, dass alle seine Quelltexte unter mittelalterlicher Dichtung eingeordnet sind, ähnlich dem Nibelungenlied – Ratcliff kann das nicht verstehen, vor wenigen Wochen waren sie noch unter realer Geschichte katalogisiert. Nur die Golemfunde in Tunesien stützen noch seine These über eine westgotische Siedlung auf dem Gebiet des alten Karthago…
Die Geschichte als phantastisch zu bezeichnen, wäre schmeichelhaft – absurd, schlicht und ergreifend falsch bringt es auf den Punkt. Karthago wurde schon vor knapp tausend Jahren vollständig zerstört, ebenso gab es zwar kurze Zeit ein Reich der Wandalen in Nordafrika, aber keine Westgoten unter einem König-Kalifen Theoderich, ebenso fehlen Hinweise auf Rom und bemerkenswerterweise existiert ein deutsches Reich, das sich weder heilig noch römisch noch reich nennt, auch der Papst glänzt mit Abwesenheit – man kann Dr. Ratcliffs Unglauben nachvollziehen.
Die Geschichte von Ash wird auf zwei Ebenen erzählt: E-Mail-Dialoge zwischen Dr. Ratcliff und seiner Lektorin Anna Longman sind meist Dispute über die in der Übersetzung von „Fraxinus me fecit“ („Esche/Ash hat mich gemacht“, ihre vermutliche Autobiographie) auftauchenden historischen Ungereimtheiten. Der Leser wird in diesen Dialogen auch auf neue Entwicklungen wie den Golem-Fund und die plötzlich anders klassifizierten Texte hingewiesen.
Die eigentliche Geschichte ist das jeweils anhängende Kapitel, das über die Erlebnisse von Ash berichtet. Interessanterweise nicht aus der Ich-Perspektive, obwohl es sich um eine Autobiographie handeln soll – ein kleiner Lapsus, andererseits liest sich meiner Meinung nach der historische Part so wesentlich besser. Da der Text das Mittelalter wie es war vermittelt, hat Mary Gentle einen gelungenen Kunstgriff angewendet: Begriffe und Zusammenhänge werden von Dr. Ratcliff sehr häufig als Fußnote kommentiert, was auch notwendig ist, denn wer kann schon von sich behaupten, einen Gesamtüberblick über das Europa des späten 15. Jahrhunderts zu besitzen? Die zahlreichen Kommentare Ratcliffs sind nicht nur informativ und lehrreich, sondern auch interessant. Sie vermitteln ein wenig den wissenschaftlichen Umgang mit literarischen Texten des Mittelalters.
Die Welt des Mittelalters wird ungeschminkt und humorvoll betrachtet: Lustige Zitate wie „Der Herr schickte uns Fleisch, und der Teufel einen englischen Koch“ sowie der derbe Humor der Söldner sorgen für Unterhaltung. Von Bewaffnung bis hin zu Sitten und Gebräuchen schöpft Mary Gentle aus ihrem großen Fundus des Wissens über diese Zeit. Einen gefallenen Ritter rammte man einen Panzerstecher durch die Lücken der Panzerung, oder einen Dolch durchs Visier in das Auge, einen hollywoodtypischen Ritter, der sich trotz Plattenharnisch von einem Schwertstreich sofort niederstrecken lässt, wird man hier nicht finden. In der Tat kann Mary Gentle für sich beanspruchen, Expertin auf diesem Gebiet zu sein – welch anderer Autor kann das schon in diesem Umfang von sich behaupten?
Da „Der Blaue Löwe“ nur das erste Viertel der Geschichte darstellt, kommt einiges leider zu kurz: Die Fülle an Daten und Handlungen sorgt dafür, dass die Nebencharaktere wie Ash’s Stellvertreter Robert Anselm, Kanonier Angelotti, ihr begabter Schützling Rickard, sowie ihr Kompaniepriester Godfrey oder ihre lesbische Ärztin Floria(n), die zudem auch noch mit ihrem feigen Möchtegern-Ehemann Fernando verwandt ist und mit ihren „Coming Out“ in einer von Intoleranz geprägten Welt erhebliche Probleme hat, einfach zu kurz kommen. Ash selbst wird sich erst im Folgeband profilieren können, dafür fällt unangenehm auf, wie oft sie zu insbesondere zwei Kraftausdrücken greift: Egal ob Stimmungs-, Situations- oder Zustandsbeschreibung, ein dutzendmal „Scheiße“, „ficken“ oder „gefickte Scheiße“ oder als Ausdruck höchster Wut „Scheiße, Scheiße, Scheiße“ sind für ihr lästerliches Mundwerk Standardrepertoire. Zum Glück legt sich das in den Folgebänden auf ein erträgliches Maß, ich empfand es im „Blauen Löwen“ übertrieben, unnötig und störend.
Die Übersetzung von Rainer Schumacher ist tadellos gelungen, die Gestaltung ist im gehobenen Stil der Bände von Lübbe’s Bibliothek der Phantastischen Literatur. Alle vier Bände haben inhaltlich perfekt passende Titelbilder, die zudem noch sehr schön anzusehen sind. Einzig bei Ash’s Abbildung auf Band 1 hat sich der Künstler Arndt Drechsler eine kleine Freiheit herausgenommen und ihr silberfarbenes Haar in der Farbe ihres Wappentieres, dem azurblauen Löwen, gehalten. Ebenso gelungen ist die Entscheidung, den Einband in einem dazu passenden marmorierten dunklen Blau zu halten – Band 3 „Der steinere Golem“ hat treffenderweise einen steingrauen Einband. Bis auf wenige kleinere Fehler und ein völlig verdrehtes und entstelltes lateinisches Zitat sind Übersetzung und Lektorat von hoher Qualität und nur zu loben.
Die Geschichte ist komplex und durchaus anspruchsvoll, trotzdem für nahezu jedermann geeignet, dank der häufig eingestreuten Kommentare Ratcliffs. Der Beginn ist jedoch relativ holprig und verwirrend, bis man wirklich mit der fantastischen Handlung vertraut ist und diese sich entwickelt. Denn so richtig los geht es trotz aller Schlachten, Belagerungen und Ashs kurioser Hochzeit erst im Folgeband „DER AUFSTIEG KARTHAGOS“. Neben Erkenntnissen über den Schöpfer der Golems, den Rabbi von Prag, und dem heiligen Gundobad wird man mehr über das Zwielicht über Karthago, das sich über Europa ausbreitet, und über die Ziele des karthagischen Kreuzzuges erfahren, ebenso über die Frage, warum „Burgundia est delenda!“ („Burgund muss zerstört werden!“ in Anlehnung an den berühmten Satz des Römers Cato „Im Übrigen bin ich der Meinung, Karthago müsse zerstört werden!“) für den Steingolem in Karthago von so großer Bedeutung ist – und wie es mit der Glaubwürdigkeit von Dr. Ratcliffs Entdeckungen weitergehen wird.
„Der Blaue Löwe“ macht Lust auf mehr – wer ein Faible für das Mittelalter und nichts gegen den ungewöhnlichen Genremix einzuwenden hat, wird mit einem wirklich herausragenden Romanzyklus belohnt. Wer seine Bücher bevorzugt im englischen Original liest, kann übrigens sehr viel sparen: Einmal 16,63 EUR anstelle von viermal 14,90 EUR für die deutschen Bände.
DIE LEGENDE VON ASH
Band 1: DER BLAUE LÖWE (ISBN 3404283384)
Band 2: Der Aufstieg Karthagos (ISBN 3404283406)
Band 3: Der steinerne Golem (ISBN 3404283430)
Band 4: Der Untergang Burgunds (ISBN 3404283457)
Das englische Original:
Ash – A Secret History (ISBN 1857987446)
Ein Interview mit Mary Gentle:
http://www.sfsite.com/10b/mg91.htm
Ihre (Mai 2004) noch nicht vollendete Homepage:
http://www.marygentle.org/
Sylvian Hamilton – Der Knochenhändler
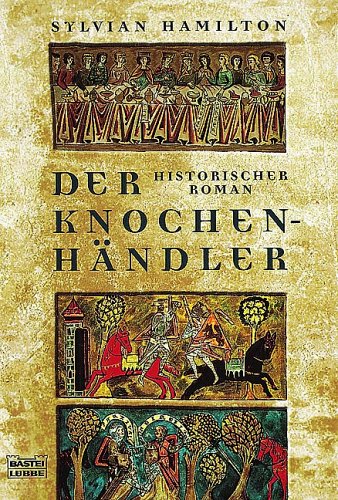
Sylvian Hamilton – Der Knochenhändler weiterlesen
Autorenkollektiv – AHA April/Mai 2004
Seit nunmehr sechzehn Jahren erscheint das Magazin _AHA_ im deutschsprachigen Raum, das ich seit einiger Zeit zu meinen Schmökerfavoriten zähle und euch mit der Ausgabe April/Mai 2004 aus zwei besonderen Gründen gerade jetzt vorstellen möchte: Zum einen halte ich eine der in vielerlei Hinsicht besten Ausgaben der letzten Zeit in Händen, und zum anderen war im April der hundertste Jahrestag der Niederschrift des „Liber AL vel Legis“ durch [Aleister Crowley]http://de.wikipedia.org/wiki/Aleister__Crowley.
Warum ist das für die AHA bedeutsam? Dies ist ein Magazin rund um Themen der Spiritualität, Philosophie, Magie/Magick sowie Kunst und versteht sich als ein Wegbereiter des Neuen Aeons/Zeitalters, in esoterischen Kreisen auch „Zeitalter des Horus“ oder „Wassermann-Zeitalter“ genannt. Da die Macher vom Tiphareth-Verlag diesen Weg in thelemitischer Tradition beschreiten und für diese wiederum das „Liber AL vel Legis“ von zentraler Bedeutung ist, wird klar, dass das hundertjährige Jubiläum auch für die AHA einen besonderes Zeitpunkt markiert. Im Gegensatz zum ähnlich ausgerichten Magazin „Der Golem“, das sich ebenfalls als Publikation für [Magick,]http://de.wikipedia.org/wiki/Magie Gnosis und Metaphysik versteht, kreisen die Artikel dieser Ausgabe allerdings nicht um dieses Ereignis, um das „Liber AL“ oder Crowley, sind dafür aber thematisch wie stets sehr breit gefächert und von besonderer Güte. (Interessierten sei die erwähnte aktuelle Ausgabe des „Golem“, mit einigen sehr kritischen Betrachtungen, übrigens wärmstens empfohlen: http://www.golem-net.de/ )
In der AHA geht es also um Magick, gnostische Erkenntnisprozesse und Metaphysisches, um Thelema natürlich, aber auch um Kunst und Psychologie, um Systemtheorien, Neurolinguistische Programmierung (NLP), Konstruktivismus, Rhizome, Kabbalah oder diverse philosophische sowie zeitkritische Betrachtungen. Die Auswahl ist breit genug gefächert, um in jeder Ausgabe für jeden Leser so manchen Volltreffer bereit zu halten. Die AHA versteht sich dabei als offenes Forum, in dem die unterschiedlichsten Autoren zu Worte kommen können (auch mit kontroversen Beiträgen und Kritik) und das umfassend informieren und diskutiert werden möchte. Unter den hier regelmäßiger publizierenden Autoren findet man den Philosophen und „Versucher“ Michael D. Eschner, den Allround-Künstler Voenix (siehe dazu unsere Rezensionen zu [„Dantes Inferno“]http://www.powermetal.de/book/anzeigen.php?id__book=134 und „Tolkiens Wurzeln“), den Verleger W. H. Müller, den Geisterbarden Dominik Irtenkauf, den Weltenbummler Claas vom Mars (immer noch mein Lieblingsname in der Liste), den psychopolitischen Aktivisten und Buchmarktkenner Berthold Röth (der als Gastautor auch in unserer Bücherecke einige Rezensionen beisteuerte), den Magicker Stephen Mace, den Verleger Georg Dehn, Tula von Irminsul, und und und… Außerdem werden die Hefte mit allerlei Gastbeiträgen, die nicht selten zu überraschen wissen, bereichert.
Das Magazin hat inzwischen einiges zugelegt, was die Güte der Gestaltung (die letzten Coverbilder sind schlichtweg Zucker für die Netzhaut und die Bebilderung der vorliegenden Ausgabe ist phantastisch im doppelten Wortsinne), des Layouts sowie die textliche Zusammenstellung anbelangt. Und der inhaltlichen Güte von Ausgabe 02/2004 will ich mich nunmehr im Einzelnen zuwenden, die vermutlich besser als alle allgemeinen Ausführungen, die vorangingen, darstellen kann, was so zwischen Cover und Rückblatt in der AHA vor sich geht…
_Aufstieg zur Heilehütte_
…von Tula von Irminsul ist abseits des recht kuschlig-esoterisch anmutenden Titels ein herausragender, tiefsinniger und gleichsam wissenschaftlich, spirituell wie künstlerisch geprägter Essay von geradezu ausufernder Ausführlichkeit (20 Magazinseiten mit übrigens fabelhafter Illustrierung). Tula beschreibt hier anhand einer praktischen Erfahrung – die bereits für sich faszinierend genug geschildert wird, aber auch mit vielfältigen theoretischen Überlegungen angereichert ist – ein Fernclearing in schamanischer Tradition, verbunden mit modernerer Magietheorie und Metaphysik. Muss man schlicht gelesen haben.
_Die Passion eines Films_
Der Theologe und einstige katholische Priester spectator (dessen Vorträge man sich übrigens dringend mal geben sollte, das war das erste Mal, dass mich ein katholischer Priester nicht zum Lachen oder Einschlafen brachte) kratzt sich verwundert am Kopf ob des neuen Gibson-Filmes über die Passion Christi.
_Blick auf ein neues Europa_
Berthold Röth gibt einen historischen Überblick und betrachtet die Eingliederung der neuen Ostländer in die EU skeptisch. Dabei orientiert er sich an Hannes Hofbauers Buch „Osterweiterung. Vom Drang nach Osten zur peripheren EU-Integration“. Ein ganz wesentliches Thema, zu dem man sich ernsthaft Gedanken machen sollte. Als ergänzenden Artikelfundus kann ich dazu übrigens die Onlinepublikation [German Foreign Policy]http://www.german-foreign-policy.com empfehlen.
_Paranoisches Denken_
Frater Poincare 9°=2° setzt seinen Artikel über „Paradoxes Denken“ fort, in dem es um Denkmuster und -prozesse geht. Verwirrend und erhellend. Wen das verwirrt – lesen! Vielleicht lieber gleich zwei Mal.
_Pazuzu und Lamaschtu_
A. Hellmuth und Soror Hel widmen sich eingehend den Dämonenvorstellungen im alten Orient babylonischer Zeit. Wer sich für Kulturgeschichte und Ärchäologie interessiert, wird in diesem sehr gründlich recherchierten, mit Bild- und Quellmaterial bestückten Artikel fündig werden.
_Magie – Der Pfad der inneren Transformation_
Dr. Paul A. Clark von der Fraternitas L.V.X. Occulta versucht eine definitorische Standortbestimmung des Suchenden auf dem Pfade der Magie/Magick. Sehr empfehlenswerter Einstiegsartikel.
_Das Schweigen der Lämmer_
oder auch: Hannibal Lecter – das Raubtier im Menschenpark. Die Nomaden der Thelema Society haben das cineastische Meisterwerk ausführlich analytisch und psychologisch seziert und geschaut, was der Film über unser Menschsein, über Einsamkeit und Kommunikation aussagt. Sehr ungewöhnlich, lehrreich und bedenkens-wert.
_Sprachmagie VI: Stille Finsternis_
Die Fortsetzung einer – tja, Geschichte? Erzählung? Informationsreihe? von Dominik Irtenkauf.
_The Time and Space Society proudly presents: Die Botschaft vom anderen Stern_
„Eine erleuchtende Beleuchtung des Siegels vom silbernen Stern“
Fürst Claas vom Mars lässt sich detailliert und nicht gerade simpel nachvollziehbar über einige Ungewöhnlichkeiten im Tarot und speziell der crowleyschen Variante aus. Etwas für eingefleischte Kabbalisten.
_Thelema und Hexentum_
„Denkanstöße für die Leser vom Steinkreis und der AHA“
Heinz Bama übt ein assoziativ-sprunghaftes Brainstorming zum obigen Thema, das von einem erfrischend naiv wirkenden Charme lebt und trotz der spielerischen Herangehensweise zum Nachdenken anzuregen weiß.
_Interview mit W.H. Müller_
Knut Gierdahl und Dominik Irtenkauf entlocken dem Autoren und Verleger allerhand tiefgründige Überlegungen und Ansichten zu Alchimie, Hermetik, Magie und Weltsicht. Faszinierend und von einigem Anspruch getragen. Den zweiten Teil des ausführlichen Gespräches gibt es in der nachfolgenden AHA.
_Neues vom Buchmarkt_
Berthold Röth hat wie stets ein sorgsam kritisches Auge auf die Buchmarktentwicklungen geworfen und berichtet von Veröffentlichungen, Verlagen und Veranstaltungen.
_Olds & News_
Schlaglichter zum Zeitgeschehen, diesmal etwas kürzer geraten als sonst und auch die Leserbriefsparte musste diesmal aus Platzgründen entfallen.
_Rezensionen_
Eine Vielzahl von Buch- und CD-Kritiken.
Bei Interesse könnt ihr euch an dieser Stelle über das Magazin informieren:
http://www.aha-zeitschrift.de
Kontaktmöglichkeit:
Tiphareth Verlag
Redaktion AHA
Breite Str. 65
29468 Bergen
Fon: (05845) 988 957
Fax: (05845) 988 956
E-Mail: redaktion@aha-zeitschrift.de
[Bestellmöglichkeit]http://www.aha-zeitschrift.de/index.php?bestellen
Neal Asher – Skinner – Der blaue Tod
In der Zukunft – auf dem Wasserplaneten Spatterjay: Das Leben ist hart, teuer und gefährlich. Die Bewohner verdienen ihr Geld mit dem Fang merkwürdiger Meeresbewohner, die alle sehr tödlich sind. Die Fauna hat sich vollständig dem Lebenszyklus angepasst – und so kann man gefressen werden und trotzdem überleben. Das hat auch Auswirkungen auf die Menschen, die hier leben. Sie sind unsterblich, flicken sich bei schweren Verletzungen einfach zusammen und müssen massiv verletzt werden, um überhaupt ausgeschaltet zu werden. Der Preis: Der Körper eines Unsterblichen mutiert, falls man nicht höllisch aufpasst.
Dieser merkwürdige Planet ist Ziel dreier Personen. Janer, Erlin und Keech. Obwohl sie alle verschiedene Motivationen vorantreiben, haben sie ein gemeinsames Ziel: den Skinner. Ehemals Sklaventreiber, Mörder und an einem Stück. Scheinbar war er tot, doch nun ist er wohl zurück – oder nicht?
Anlässlich von Filmen wie „Fluch der Karibik“ und „Master and Commander“ erfreuen sich Piratenstücke derzeit großer Beliebtheit. Wie passend, dass es sich bei „Skinner – Der blaue Tod“ um ein Piratenstück handelt. Zwar ist es in der Zukunft und auf einem fremden Planeten angesiedelt, aber dennoch spannend zu lesen und voller Überraschungen.
Moderne Technologie ist für Spatterjay kaum erschwinglich und so fahren hölzerne Kutter über das Meer. An Bord die unsterblichen Einheimischen, ausgestattet mit einem großen Waffenarsenal. Damit erwehren sie sich der bedrohlichen Tierwelt. Fortwährend gibt es kleine Einschübe des Autoren, die sich mit genau dieser Tierwelt beschäftigen und den Kreislauf des „Fressen und Gefressen werden“ behandeln. Recht anschaulich und faszinierend geschrieben. Neal Asher zeigt hier sein kreatives Talent und entwickelt eine einzigartige Umgebung für seine Geschichte.
In dieser Umgebung agieren dann künstliche Intelligenzen, semiintelligente Segel, Drohnen, Schnecken, die sich Menschen als Nahrungsmittel halten, ein seit siebenhundert Jahren toter Keech und andere Wesen.
Das Protagonisten-Trio ist Asher besonders gut gelungen. Am normalsten erscheint vielleicht Erlin. Die jugendliche Wissenschaftlerin hat bereits einige Jahrhunderte auf dem Buckel und entpuppt sich als knallharter Brocken. Auch Janer erscheint Anfangs normal, allerdings gehörte er zu einem Schwarmbewusstsein. Die Hornissen stellten sich im Laufe der Geschichte als intelligent heraus und wurden ziemlich mächtig. Durch Janer versuchen sie ihre Macht nun zu stärken. Am auffälligsten scheint jedoch Keech. Er ist seit Jahrhunderten ein wandelnder Leichnam, wird durch Elektronik eines Kults am Leben gehalten und von Rachegelüsten geleitet. Damit ergibt sich eine Sammlung verschiedener Charaktere, die alle gut zusammenpassen und miteinander harmonieren.
Unterm Strich
Das Charakterspiel der Hauptcharaktere, ihre Entwicklung und ihre Motivation, reizen den Leser, zwingen ihn zum Weiterlesen. Man wird vom Schicksal der Personen berührt, nimmt Anteil an ihrem Leben. Neal Ashers Roman ist im sozialen Bereich erstklassig geschrieben und auch die Übersetzung von Thomas Schichtel steht dem in nichts nach.
„Skinner – Der blaue Tod“ ist ein spannender Roman, flüssig zu lesen und gut aufgebaut. Zwar wechseln häufig Schauplätze, Personen und auch mal die Zeit, aber man behält stets den Überblick. Eine gelungene Piratengeschichte, tolles Seemansgarn und faszinierende Science-Fiction.
_Günther Lietz_ © 2004
Lecouteux, Claude – Geschichte der Vampire, Die
Vampire sind vielseitig. Das ist an sich noch keine neue Erkenntnis. Man kann sie in der Literatur finden und auch im Film. Mit ein wenig genauem Hinschauen kann man ihnen auch im wahren Leben begegnen – als real vampyres. Doch das hier zu besprechende Buch widmet sich keinem dieser Themenbereiche, sondern packt das vampirische Übel an der Wurzel. Der Franzose Claude Lecouteux befasst sich in seinem Buch „Die Geschichte der Vampire – Metamorphose eines Mythos“ mit der Kulturgeschichte des Vampirs und versucht zu erhellen, welche Mythen an der Entstehung des Vampirs beteiligt waren und welche Ausprägungen des Vampirmythos man wo findet. Dabei beschränkt er sich, wie andere Studien vor ihm auch, hauptsächlich auf das Europa von circa 1700 bis 1900. Das heißt keineswegs, dass man nur hier und zu dieser Zeit Vampirmythen finden kann, doch sind die Entwicklungen in diesem Zeitraum entscheidend für die Entstehung des Vampirs, wie wir ihn heute kennen: Als einen wiedergekehrten Toten, der sein Grab verlässt, um das Blut der Lebenden zu trinken.
Dabei startet Lecouteux eher überraschend in seine Analyse, nämlich mit einer kurzen Einführung in die Gründerväter des literarischen Vampirs (er wählt hier exemplarisch Polidori, Le Fanu, Stoker und Tolstoi) und die Weiterverbreitung des Mythos durch Enzyklopädien. Erst mit dem zweiten Kapitel widmet er sich der Kulturgeschichte und fängt hier an, den Vampirmythos Europas weiträumig zu umkreisen. Als Einstieg beschäftigt er sich mit der Wahrnehmung des Todes ab dem 18. Jahrhundert. Hier unterscheidet er klar zwischen einem „guten“ und einem „schlechten“ Tod, um zu illustrieren, dass Sterben keine einfache Angelegenheit war. Beim und nach dem Tode konnte einiges schiefgehen, was dazu führte, dass der Tote keine Ruhe fand und dadurch eventuell als Vampir wiederkehrte. Hatte der Tote kein vorbildliches Leben geführt (handelte es sich beispielsweise um eine Hexe, einen Exkommunizierten, einen Mörder etc.) gehörte er zur Gefahrengruppe, sprang ein Tier über die Leiche oder ließen sich die Augen des Toten nicht schließen, so galt dies als schlechtes Omen. Folglich umgaben Tod und Begräbnis zahlreiche strenge Rituale, die es einzuhalten galt, wollte man Wiedergängertum verhindern.
Doch ein Wiedergänger ist nicht unbedingt mit einem Vampir gleichzusetzen, stellt Lecouteux in einem folgenden Kapitel fest. Der Volksglauben war in ständigem Wandel begriffen und zusätzlich auch immer lokal geprägt. Das führt dazu, dass verschiedene Mythen einander beeinflussen oder gar zusammenfließen. So lief eine Hexe immer Gefahr zum Vampir zu werden. Und die in Dalmatien für den Vampir gebräuchliche Bezeichnung „vukodlak“ bildet sich aus dem Wortstamm für Wolf – eine eindeutige Verbindung zum Werwolf. Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, versucht Lecouteux daher, verschiedene wiederkehrende Tote zu identifizieren: So den Rufer (jemand, der wiederkehrt und von draußen nach seinen Angehörigen ruft), den Aufhocker (ein Toter, der sich einem Schlafenden auf den Brustkorb setzt und ihm die Lebenskraft raubt) oder den Nachzehrer (ein Toter, der im Grab sein Totenhemd isst). Auch hier sind Überschneidungn zwischen verschiedenen Mythen unvermeidlich. Im Folgenden werden dann einige Bezeichnungen für den Vampir angeführt und erklärt, so der griechische broukolakos, die rumänischen strigoi oder walachische murony. Da die jeweiligen Bezeichnungen unterschiedlichen Nationen zuzuordnen sind, erwachsen auch hier wieder Unterschiede im eigentlich Vampirmythos: Wer wird zum Vampir und wie kann man ihn vernichten? Diese Dinge variieren von Land zu Land. Lecouteux geht daher sehr ausführlich darauf ein, wer nach dem Tode als Vampir wiederkehrt und wie selbiger vernichtet wurde. Erst 1755 verbot beispielsweise Maria Theresia die Hinrichtung von Verstorbenen, was darauf schließen lässt, dass das Exhumieren und Pfählen bzw. Köpfen bei Verdacht auf Vampirismus eine gängige Praxis war. Dies lässt sich auch durch archäologische Funde stützen, bei denen man immer wieder Leichen findet, die förmlich am Sarg festgenagelt wurden oder deren Kopf zwischen den Beinen niedergelegt wurde, damit der Vampir ihn nicht finde.
Erst im letzten Kapitel beleuchtet Lecouteux etwas genauer verschiedene Erklärungsversuche für das Phänomen des Vampirismus. Warum gab es ab 1700 eine derartige Blüte des Glaubens an Vampire? Ganze Scharen von Wissenschaftlern setzten sich zu damaliger Zeit (vollkommen ernsthaft) mit dem Phänomen auseinander und versuchten, bluttrinkende Tote logisch zu erklären. Erklärungen, die sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreuen, finden sich ebenfalls hier wieder: So die Seuchentheorie, die erklären könnte, warum ganze Dörfer Vampiren zum Opfer fielen. Hierbei nimmt man an, dass der vermeintliche Vampir tatsächlich ein Cholera-, Tollwut- oder Typhusopfer war und dass das Ausgraben der Leiche die Seuche daher nicht eindämmte, sondern im Gegenteil noch verschlimmerte.
Claude Lecouteux hat ein umfassendes Buch geschrieben für all jene, die sich für die historischen Facetten des Vampirs interessieren. Er liefert zahlreiche Quellen und historische Berichte und beleuchtet den Volksglauben in Europa durchaus tief, sodass man sich nach der Lektüre exzellent informiert fühlt. Dennoch muss angefügt werden, dass Lecouteux keineswegs Pionierarbeit leistet. Wer sich ein wenig mit dem Vampirmythos beschäftigt hat, wird vieles schon kennen, was in „Die Geschichte der Vampire“ besprochen wird. Schon 1926 hat Montague Summers mit „The Vampire in Lore and Legend“ ein Standardwerk geschrieben, das auch Lecouteux mit seinem siebzig Jahre später erschienenen Buch nicht überflügeln kann. Er liefert stattdessen eine abgespeckte und lesbarere Version des Buches von Summers und ist daher für Einsteiger besonders zu empfehlen.
Allerdings finden sich in „Die Geschichte der Vampire“ auch einige Fehler, die entweder Lecouteux selbst oder seinem deutschen Übersetzer unterlaufen sind. So basiert der Film „Interview mit einem Vampir“ natürlich nicht auf dem Roman „Der Fürst der Finsternis“ und die deutsche Abhandlung „Tractatus von dem Kauen und Schmatzen der Todten in den Gräbern“ wird in der Rückübersetzung aus dem Französischen ganz modern in „Die Kaubewegungen der Toten in ihren Gräbern“ umbenannt. Solche Kleinigkeiten schmälern die Zuverlässigkeit des Werkes, wenn sie auch den meisten Lesern in der Regel nicht auffallen werden.
Davon abgesehen, ist Lecouteuxs Rundumschlag durchaus für all jene zu empfehlen, die sich für die Wurzeln des europäischen Vampirs interessieren. Denn der Vampir war zu jener Zeit eine durchaus reale Erscheinung, deren Existenz zumindest auf dem Lande keineswegs angezweifelt wurde. Und die zahlreichen wissenschaftlichen Traktate aus jener Zeit zeigen, dass trotz Aufklärung auch die gebildeten Schichten nicht gefeit waren vor der Angst vor den Toten!
Engmann, Charlotte – Myranor – Den Göttern versprochen
„Myranor“ ist der neueste Ableger des Rollenspiele-Klassikers DAS SCHWARZE AUGE: ein weiterer Fantasy-Kontinent, in dem es vor Völkern, Abenteuern und Magie wimmelt, und Charlotte Engniann hat in ihrem Roman einerseits das Vergnügen, andererseits aber auch die nicht sonderlich beneidenswerte Aufgabe, die Grundlagen vorzustellen. Sehr viel Verantwortung also, die auf ihren Schultern lastete, eigentlich konnte es nur schief gehen, sollte man meinen.
Um es vorweg zu nehmen: Das Gegenteil ist der Fall!
Erzählt wird die Geschichte von Lycadia, deren Vergangenheit im Dunkeln liegt. Sie wächst bei Dha’veru, einer Heilzauberin auf, die ihre Ziehtochter in die Künste des Heilens einweist. Doch Lycadia hat eine ganz besondere Beziehung zur Magie: Sobald sie einen Patienten berührt, erkennt sie, wodurch er seine Verletzungen erlitten hat, sei es durch einen Schwertstreich bei einem verbotenen Gladiatorenkampf oder durch die Berührung eines Albschmeichlers, der niedlich aussieht, jedoch über ein hochwirksames Kontaktgift verfügt. Plötzlich erleidet Lycadia die Vision eines schrecklichen Wesens, das sie zutiefst erschüttert. Ein Wesen, das sich als Erijschu herausstellt, einst ein legendäres Tiefseewesen, heute nur noch ein Kinderschreck aus Märchen.
Regiert werden das Imperium und der Moloch Stadt von den Optimaten, einigen Familien, in denen die Magie besonders stark wirkt; sie zeichnen sich durch ihr drittes Auge auf der Stirn aus. Die Metropolitin aus einer der Familien herrscht mit religiös-diktatorischen Befugnissen.
Zusammen mit einigen Freunden und deren Freunden versucht Lycadia die Herkunft ihrer Vision zu ergründen und stellt dabei fest: Sie ist eng mit ihrer eigenen verknüpft. Zur Seite stehen ihr unter anderem Valorian, ein desertierter Myrmidone (Soldat), der einen Shingwa (Chamäleonid) aus den Händen seiner Truppe befreit hatte. Dann RaoRi, Lycadias katzenhafte Freundin vom Volk der Amaunir; sie ist Schamanin, Geistwesen können sich in ihr manifestierten. Rishuran hingegen ist Dha-verus dunkelhäutiger, väterlicher Freund und Leibwächter eines Optimatenhauses, sowie Shiniope, eine Kriegerin, und Groarhach, ein junger Löwe-Mensch-Hybrid vom Stamin der Leonir.
Mehr und mehr versinken Lycania und ihre Gefährten in einem Netz aus Lügen und Intrigen, und bei verlustreichen Ermittlungen stellt die junge Heilerin fest: Ihr Leben ist viel enger mit den Optimaten, Erijschu und nicht zuletzt auch einem verbotenen, archaischen Blutkult verknüpft, als sie anfangs annahm: Sie wurde nur geboren, um der Göttin des kalten Lichts, Madharya, geopfert zu werden, wurde als Baby jedoch in letzter Sekunde gerettet. Jetzt fordert Madharya ihr Recht…
Charlotte Engmanns Myranor-Debütroman besticht durch eine babylonisch zu nennende Völkervielfalt. Besonders Hybrid-Rassen aus Menschen und verschiedenen Tierarten herrschen vor, andererseits gibt es aber auch beispielsweise die vierarmigen, nachtaktiven Neristu und die Loualil, Meereswesen, die mit nichts zu vergleichen sind. Sehr farbenprächtig und facettenreich geschildert, dekoriert mit einigen amüsanten Details (z.B. werden kleine Hunde zwecks Nahrung gezüchtet, und es gibt – man höre und staune! – sogar eine Schwulen-Bar).
Dabei legt die Autorin einen ausgesprochen flüssigen Erzählstil zutage, der routiniert wirkt und sich dennoch extrem positiv von dem mancher Akkordschreiber unterscheidet. „Holperer“ beim Lesen habe ich beim besten Willen nicht finden können, was für sehr viel Sorgfalt spricht. Eine Investition, die sich gelohnt hat.
Einziger Kritikpunkt: Zu Beginn des Romans wirken die zahlreichen verschiedenen Völker und Protagonisten ein wenig verwirrend, man braucht einige Seiten, um sich einzulesen. Nicht jedem Volk wird der Platz zugestanden, den es eigentlich bräuchte, um Profil zu gewinnen. Doch dies ist entschuldbar und wohl eines der zwangsläufig auftretenden Probleme, wenn eine Welt „eingeführt“ wird, auf der spätere Romane basieren sollen. Dennoch: Diese Aufgabe wurde hervorragend gemeistert. Denn hat man sich erst eingelesen, springt der sogenannte „magische Funke“ mühelos über, sofort versinkt man in dem faszinierenden Ambiente. Und da die Handlung ausgesprochen spannend ist, möchte man das Buch am liebsten gar nicht aus der Hand legen.
Einige Rezensenten sollen behauptet haben, einen Schwarze-Auge-Roman könne im Prinzip ja jeder schreiben… Nun, bei einigen Werken der Reihe mag das möglicherweise zutreffen, nicht jedoch bei „Den Göttern versprochen“.
Ein mehr als empfehlenswerter Roman, nicht nur für eingefleischte Rollenspiel- und Fantasy-Fans!
_Markus Kastenholz_ © 2004
mit freundlicher Unterstützung von [Buchrezicenter.de]http://www.buchrezicenter.de/
Berg, A. Scott – Katharine Hepburn. Ein Jahrhundertleben
1983 war Katharine Hepburn längst eine lebende Legende: fünf Jahrzehnte Film und Theater, dazu ein Lebensstil, der seiner – oder besser: ihrer – Zeit weit voraus war. Mit unvergleichlicher Energie waren Karriere und Privatleben gemeistert worden, als ein schwerer Autounfall die scheinbar unverwüstliche „Kate of Arrogance“ zeitweise zum Kürzertreten zwang.
Die ungewohnte Ruhe führte zu einigen Umwälzungen im Hepburnschen Alltag. So gab sie der Langeweile nach und empfing gnädig einen jungen Mann, der einen biografischen Zeitschriftenartikel über sie verfassen wollte. A. Scott Berg war kein Journalist, sondern Buchautor mit gutem Ruf, als er sich der berühmten, als exzentrisch bekannten Schauspielerin vorsichtig näherte.
Siehe da: Die Chemie stimmte, aus Interviewpartnern wurden rasch echte Freunde. Zwei Jahrzehnte gehörte Berg nun zum Hepburn-Haushalt. Wie wenige andere Menschen lernte er diese ungewöhnliche Frau kennen, verfolgte ihren hartnäckigen Weg zurück ins Berufsleben, die späten Triumphe, aber auch den erst allmählichen und dann immer rascheren Verfall, der die bitteren letzten Jahre bis zum Tod Katharine Hepburns im Alter von 96 Jahren nicht ausspart.
A. Scott Berg hat auf Wunsch der Künstlerin stets Augen und Ohren offen und den Stift gespitzt gehalten. Wenn man ihm Glauben schenkt, hat Hepburn ihn als Gesprächspartner mit beinahe therapeutischer Bedeutung geschätzt, mit dem sie über ihr keineswegs einfaches Leben reden konnte. Dabei kamen viele Details zur Sprache, die sehr privat waren und folglich die Gier der Medien erregten. Primär war dies die ebenso legendäre wie komplexe Liebesgeschichte zwischen Hepburn und Spencer Tracy, über deren alltäglicher Realität noch Jahrzehnte später Unklarheit herrscht.
In ihrer Autobiografie drückte sich Hepburn 1988 um viele für sie unbequeme oder belastende Aspekte ihres Privatlebens. Laut Berg hat sie diese ihm mehr oder weniger in die Feder diktiert, damit er – allerdings erst nach ihrem Tod – auch diese Geheimnisse offenbare. Diesen Auftrag erfüllt er mit dem vorliegenden Buch, das Biografie und Erinnerung an eine wertvolle Freundschaft gleichzeitig ist.
Wobei sich formal gegen beides keine Einwände erheben lässt. Die Mischung ist reizvoll, denn sie durchbricht das oft dröge Muster biografischer Beschreibungen: Sie wurde geboren, sie lebte, sie starb. Berg durchsetzt die Lebensbeschreibung immer wieder mit Erinnerungen an die „alte Kate“, was ihm u. a. die Möglichkeit gibt, diese vielen vergangenen Ereignisse quasi persönlich zu kommentieren.
Dabei betont Berg, dass er sich hauptsächlich auf die Wiedergabe von Fakten beschränkt. Seine übliche Arbeitsweise als Biograf bedinge normalerweise eine intensivere Beschäftigung mit dem vorgefundenen Quellenmaterial. Vor allem analysiere er dieses, um zwischen den Zeilen verborgene Wahrheiten zu entdecken. Dies unterbleibe hier, was an der Nähe zum Objekt seiner Beschreibung – einer wirklich engen Freundin – liege, welche die dafür erforderliche Distanz unmöglich mache. (Ein wichtige Rolle mag zudem der Zeitfaktor gespielt haben – der frühe Vogel fängt den Wurm; eine Hepburn-Biografie, die Berg-typisch mehrere Jahre der Archiv- und Schreibarbeit in Anspruch genommen hätte, wäre wohl kaum mehr auf das Interesse einer breiten Öffentlichkeit gestoßen.)
Berg überspringt die allzu oft für Künstler- und besonders Schauspieler-Biografien übliche Grenze naiver Staranbetung. Er profitiert natürlich von der erwähnten Freundschaft. Dennoch kann zumindest der nüchtern interessierte Leser keine „Skandale“ offengelegt finden. Es stellt sich insgesamt die Frage, ob sich für ein nach Sensationen dürstendes Publikum die Lektüre lohnt. Trotz ihrer beneidensweiten Offenheit, die es Wert ist festgehalten zu werden, war Katharine Hepburn „nur“ ein Mensch. Insofern gibt es keine Schmutzwäsche ans Tageslicht zu zerren; was vor Jahrzehnten sicherlich für Aufsehen gesorgt hätte, lässt den privatfernsehgestählten Zeitgenossen der Jetztzeit nur noch müde abwinken.
So schreibt Berg die Hepburn-Geschichte nicht neu, sondern ergänzt sie höchstens um Details, korrigiert sie hier und da und entkleidet sie vor allem ihrer Legenden. Ob er dabei alle Klippen umschiffen konnten, weiß er selbst nicht recht; es ist in der Tat nicht einfach, nach dunklen Flecken auf der Weste eines Menschen zu fahnden, den man ehrlich schätzt.
Schwer fällt es zu entscheiden, wie tief die Freundschaft zwischen Hepburn und Berg denn nun wirklich gewesen ist. Zumindest in den ersten Jahren hat er lange Zeiträume unter ihrem Dach gewohnt und am Familienleben teilgenommen. Ob es dabei wirklich so US-amerikanisch-sentimental zugegangen ist, wie Berg es manchmal schildert, muss offen bleiben. Es ist auf der anderen Seite genug Offenheit in der Beschreibung der sehr alten Katharine Hepburn, die keine Ähnlichkeit mit der verehrten unabhängigen Persönlichkeit aufweist, sondern nur mehr eine kranke, senile, kaum mehr ansprechbare Frau ist. Auch große Künstler holt das Alter ein; was den meisten Biografen höchstens einige Zeilen Wert ist, beschreibt Berg in aller Ausführlichkeit. Dies liest sich oft traurig, ist aber kein Gazettenschwein-Wühlen im Medienschmutz, sondern eine ehrliche und auch notwendige Ergänzung. Schließlich ist Katharine Hepburn nach ihren letzten Filmen Mitte der 1990er Jahre nicht als unwürdige Greisin außer Dienst in ein Künstler-Nirvana verzogen, sondern hat noch bis 2003 gelebt.
Weil Berg über die Jahre notierte, was er bei oder mit seiner Freundin erlebte (diese wusste das übrigens und billigte es), ist sein Buch kein Schnellschuss, um den Hepburn-Fans das Geld aus der Tasche zu ziehen. Er kann auf echtes Material zurückgreifen, statt den bekannten Wust aus Fakten und Legenden noch einmal aufzukochen. Außerdem verfügt Berg über die Gabe zu schreiben. Knapp vierhundert Seiten lesen sich (auch in der Übersetzung) außerordentlich flüssig. Zeit- und Themensprünge lassen sich als Stilmittel erkennen, statt den unterbezahlten, von Terminen gehetzten Schreiberling zu verraten. In die Reihe von Scotts grundlegenden Biografien über den Herausgeber Max Perkins, den Filmmogul Sam Goldwyn oder die Fliegerlegende Charles Lindbergh reiht sich dieses Buch sicherlich nicht. Es ist eher eine Fingerübung, aber eine, die der Leser mit Freude und Gewinn zur Kenntnis nimmt.
A. Scott Berg wurde 1950 geboren, studierte an der Elite-Universität Princeton und beschloss bereits dort, sich seinen Lebensunterhalt als Biograf zu verdienen. Seine Abschlussarbeit über den Herausgeber Max Perkins baute er später zu seinem ersten Buch und Bucherfolg aus. Seither hat er drei weitere Werke veröffentlicht. Bergs nächstes Projekt – über US-Präsident Woodrov Wilson – besitzt wieder den für ihn üblichen Rahmen, er selbst hofft, es 2009 abschließen zu können …
Hohlbein, Wolfgang – u.a. – Vermächtnis der Feuervögel, Das
Einen Hohlbein kann man eigentlich (fast) immer lesen, ohne enttäuscht zu werden; und einige Bücher sind richtig spannend („Drachenfeuer“ oder „Spiegelzeit“ z.B.). Nicht dass wir besonders raffinierte oder gar innovative Genre-Stückchen vor uns hätten, aber der „deutsche Stephen King“ kann routiniert und flüssig schreiben, so wie halt King oder Koontz auch. Seine schlechtesten Bücher sind nicht schlechter als deren schlechteste Bücher, seine besten können manchmal gar (fast) mithalten und toppen die Durchschnittsware der Amerikaner, auch die gehobene. Wenn ich für diesen Band dennoch keinen Tipp ausspreche, so hat das drei Gründe, der erste ist bereits genannt: Routine, Handwerk, vom Hocker reißt nichts wirklich, vieles ist vorhersehbar. Der zweite und dritte haben zu tun mit der Verlagspolitik (kaum vorstellbar allerdings, dass Hohlbein keinen Einfluss darauf hat, er ist immerhin Hohlbein).
Hier wird nämlich – zweiter Grund – Irreführung betrieben. Das beginnt beim Untertitel „Fantasy-Stories“; davon enthält der Band eigentlich nur eine waschechte. Der Rest entstammt SF, Horror und dem, was man mitunter „Phantastik“ nennt (weil es weder Horror noch SF usw. ist). Ausschließlich auf Fantasy fixierte Leser (die gibt es!) dürften hier also weitgehend enttäuscht werden. Doch die Täuschung geht noch weiter; man ist gut beraten, sich vor Kauf das Inhaltsverzeichnis anzusehen: Drei der Geschichten, ein knappes Drittel des Textes, stammen gar nicht von Hohlbein, er hat nur die Vorworte geschrieben – und dann ist es vermessen zu titeln „Wohlgang Hohlbein und andere“, „Wolfgang Hohlbein und Dieter Winkler“ etc.
Dritter Grund: Piper recycelt kräftig. Ja, Hohlbein soll künftig stärker in den Verlag eingebunden werden – mindestens mit einer neuen Staffel ENWOR-Romane, die ab 2004 erscheinen wird. Und es ist nur verständlich, dass man möglichst viele Bücher eines unbestrittenen Erfolgsautors herausbringen will. Doch der potenzielle Käufer sollte seine WH-Sammlung durchsehen – falls diese Hohlbeins Fantasy-Selections der Jahre 1999 bis 2001 enthält (erschienen bei Weitbrecht Verlag in K. Thienemanns Verlag), dann besitzt er knapp 180 der 270 Seiten schon. Und von den restlichen 90 Seiten stammen nur 25 von Hohlbein. Anders gesagt: Der Band enthält nur eine (!) bisher nicht veröffentlichte Geschichte des Meisters … und diese, „Das Relief“, ist eine zugegeben schnell und sicher erzählte Horrorstory, aber nichts wirklich Neues. Harvard-Studenten suchen sich für einen Schabernack einen Friedhof aus, aber am Ende sind nicht die anvisierten Kommilitonen die Leidtragenden. Durchschnitt – lieber wieder einmal „Pickman’s Modell“ von Lovecraft lesen (dessen Grundidee hier variiert wird, doch auf nicht unbedingt überzeugende Art und Weise).
Alles Wesentliche zum Band wäre hiermit eigentlich gesagt; für Neugierigere folgt nun die Besprechung der Einzeltexte im Schnelldurchlauf:
„Das Vermächtnis der Feuervögel“, die Titel- und längste Geschichte, bringt einen Drehbuchautor, dessen Agenten und ihre beiden Freundinnen in das übliche alte, fast ruinierte Herrenhaus, dessen letzter Besitzer ein Vogelnarr war. Er vermachte die Immobilie denn auch seinen gefiederten Freunden, und man darf weder das Haus renovieren, noch die Vögel vertreiben, noch die Zimmer bewohnen, in denen sie nisten. Durchschaubar spätestens ab Seite 28, Ende inklusive. Horror Kingscher Machart, Dutzende Male gelesen.
„In Namen der Menschlichkeit“ gehört in die Rubrik „SF“, Unterabteilung „Alternative Geschichte“, Regal „häufig gebrauchte Grundideen“: Das Römische Imperium ist 1500 n. Chr. eine Weltmacht, die im Kampf mit dem Toltekenreich liegt – weltkriegsartige Zustände, Millionen Tote usw. Die Römer schicken eine Zeitkapsel mit 4 Mann und 2 Bomben in die Vergangenheit, um das Problem zu lösen, bevor es entsteht. Die Tolteken torpedieren das Unternehmen (im wahrsten Wortsinn); die Legionäre stranden irgendwo, irgendwann. Auf der ersten Seite fällt der Familienname der Hauptfigur: Cyrene, was beim leidlich bibelfesten Leser einen Verdacht weckt; drei Seiten später verdichtet der volle Name Simon Cyrene diesen zur Gewissheit (na? wer hat die passende Bibelstelle parat oder wenigstens die entsprechende Szene aus „Leben des Brian“??). Zum Glück gibt es immer weniger bibelfeste Leser, der immer größere Rest wird daher etwas später (vielleicht) überrascht. – Nee, ich muss hier mal die Katze aus dem Sack lassen: Natürlich ist der Ort der Handlung Jerusalem, die Zeit kurz vor dem Passahfest 33 n. Chr., und gewiss haben wir hier wieder einmal eine Jesus-Geschichte zu lesen. Originell daran sind Hohlbeins Entwurf der Ideologie des Römischen Imperiums – die Symbole Christi: Schwert und Lasergewehr -, die Idee der Gegner – Tolteken unter dem Banner Quetzalcoatls – und sein alternativer Geschichtsverlauf: Das Volk widersetzt sich der Kreuzigung, rebelliert, metzelt Römer, das Imperium wandelt sich, die Apostel werden Kaiser und Könige … Klar kommt es am Ende zu unserer Geschichte, doch wie, ist wieder schwach: Cyrene überlegt sich, wie viele Kriege im Namen Christi geführt werden und wie viele Menschen sterben – und gibt Judas Ischarioth dreißig Silberlinge. Eine fragwürdige Entscheidung, denn Cyrene macht einen ganz intelligenten Eindruck und müsste sich auch fragen, ob es ohne den Namen Christi wirklich weniger Kriege und weniger Tote wären. Ich behaupte mal: Nein. Wir hätten auch ohne die Religion einen Grund gefunden, das fortschrittliche Arabien zu überfallen oder die Indianer niederzumetzeln. Außerdem: Warum sollten die Leute nicht auch gegen die Kreuzigung rebellieren? – Schade, aus der Geschichte hätte sich mehr machen lassen; so jedoch weckt sie die meisten Erwartungen und enttäuscht daher am meisten.
„Das zweite Gesicht“ ist SF, verbunden mit Horror-Elementen, soll vor dem Missbrauch der Medizin warnen und die Frage stellen, ob wir alles dürfen, was wir können. Aber abgesehen davon, dass die Geschichte am Ende eigentümlich unentschieden bleibt, was diese Frage betrifft – sie geht auch unentschieden aus, ist in Teilen vorhersehbar und hat kein überzeugendes Ende.
„Im Schatten der Sonne“ wurde im Internet als Fortsetzungsgeschichte von 14 AutorInnen geschrieben. Macht pro Frau/Mann gut 1 Seite. Das merkt man. Nicht einmal C. L. Moore, Abraham Merritt, Robert E. Howard, Frank Belknap Long und Howard Phillips Lovecraft bekamen 1935 unter dem Titel „The Challenge from Beyond“ eine mehr als nur durchschnittliche Story zusammen (wobei Howards Schluss mit seiner ironischen Howard-Parodie wenigstens ein echter Brüller ist). Doch dieser 14-Mensch-Eintopf hier bleibt fade, verdorben im Sinne des Sprichworts von den vielen Köchen und enthält alles Mögliche, nur nix Nahrhaftes.
„Malicia“ aus der Feder Dieter Winklers, die allererste und bisher nicht veröffentlichte ENWOR-Geschichte, ist dann endlich einmal richtige Fantasy, gewürzt mit Horror-Elementen. Sie kann Howards „Conan“-Geschichten durchaus das Wasser reichen. In den Augen mancher Leser mag das freilich kein Kompliment sein, doch ich habe eine leise Schwäche für den Cymmerier, sofern er von Howard selbst zum Leben erweckt wird, bekenne mich fröhlich dazu und zu dieser Geschichte und empfehle den Puristen, es doch besser zu machen, wenn es so einfach ist, „Trivialliteratur“ zu schreiben. Eine akzeptable, spannende Story, die beste des Bandes – nur eben nicht von Hohlbein.
Esmee Weisleders „Engel laufen nicht!“ beschließt das Buch und ist laut WH die Siegergeschichte eines Schreibwettbewerbs des Hohlbein-Internet-Fanclubs. „Die Anzahl der Storys … war überwältigend, und die Qualität übertraf meine kühnsten Erwartungen (in jeder Hinsicht)“ schreibt der Meister doppelbödig. Je nun. Die Geschichte ist nicht schlecht, dennoch: Wenn sie die beste war, überbietet die Qualität der anderen die Erwartungen nur in einer Hinsicht, nach unten nämlich. Immerhin: konsequent komponiert, straff erzählt, die Hauptfigur lebendig gezeichnet, der Schluss in seinen Grundzügen erahnbar, aber gut ausgestaltet – eine Story auf besserem Fanzine-Niveau. Nicht mehr, nicht weniger.
Fazit dieser langen Rezension? Ein Buch mit wenigen Höhen und etlichen Tiefen, das mehr verspricht, als es hält; für Hohlbein- und/oder ENWOR-Freaks ein Muss, für alle anderen Leser eher fraglich. Nicht allzu enttäuschend freilich, aber das nimmt nicht Wunder – man erwartete ja auch nicht allzu viel …
© 2004 by _Peter Schünemann_
mit freundlicher Unterstützung von [Buchrezicenter.de]http://www.buchrezicenter.de/
Bionda, Alisha (Hg.) / Borlik, Michael (Hg.) – Wellensang
Mit der Anthologie „Wellensang“ haben Alisha Bionda und Michael Borlik eine Sammlung von Kurzgeschichten zusammengetragen, die „nicht im Einheitsbrei der Masse untergehen sollte“.
Die Anthologie umfasst achtzehn Geschichten mit einem breit gefächerten Spektrum in der Thematik, es reicht von alten Kulturen über Märchen und Futuristisches bis zu typischen Fantasy-Motiven wie Zwergen und Drachen.
So erzählt „Das Lied der Krähe“ von einer geraubten und zur Ehe gezwungenen keltischen Fürstentochter, die grausame Rache an ihrem Entführer nimmt, die „Welt zwischen den Zeilen“ von einem Mädchen, das einen Weg aus seiner kalten und technisierten Welt sucht, „Wenn die Eiswölfe singen“ vom Kampf einer unvollständig ausgebildeten Hexe gegen die Eroberer ihrer Heimat, und „Dämonenbrut“ von einem Drachen, dessen Brut sich vom Angstschweiß der Menschen ernährt.
Einige Geschichten verknüpfen unsere alltägliche Welt mit einer Fantasiewelt, wie zum Beispiel „Mohnblumenkönigin“, andere spielen ganz in unserer, wie „Haus ohne Schlüssel“, oder ganz in einer Fantasy-Welt, wie „Heimkehr nach Kalipay“. Manche lassen uns schmunzeln, wie „La Belle et la Bête“, oder gruseln, wie „Zwischen 9 und 9“.
Zu den Schmunzel-Geschichten gehört „Die Tränen des blauen Gottes“. Zwei Gauner versuchen den Coup ihres Lebens: Sie wollen den Tempel des blauen Gottes berauben. Gläubige bringen dem Gott kostbare Opfer dar, Gold und Silberschmuck, mit Perlen und Juwelen verziert, um dafür mit seinen Tränen beschenkt zu werden, faustgroßen blauen Edelsteinen. Der kleinere der beiden Gauner hat ausgekundschaftet, dass diese Edelsteine keine echten Tränen sind, sondern von den Priestern durch die löchrigen Augenhöhlen der Götterstatue hindurchgereicht werden. Tatsächlich gelingt es den beiden, sich Edelsteine aus dem Tempel zu beschaffen….
Die Geschichte ist leicht und amüsant erzählt, trotz der Erzählkürze sind die beiden Gauner gut getroffen, auch wenn das Duo „klein und schlau“ gemeinsam mit „groß und eher langsam“ nicht ganz neu ist. Leider geht die eigentliche Ironie der Erzählung etwas verloren, weil das Ende zu früh absehbar ist, deshalb gehört diese Geschichte auch nicht zu den besten des Buches.
„Zolineks Geschichte“ ist eigentlich Erikas Geschichte, aber Zolinek ist derjenige, der sie erzählt. Zolinek ist ein Zwerg, der mit seiner Frau, einer Koboldin, als Kräuterverkäufer durchs Land zieht. Die beiden fanden Erika im Wald und päppelten das arme Wesen wieder auf. Erika fängt an, ihnen zu vertrauen, und erzählt ihnen, dass der für seine Grausamkeit berüchtigte Graf Sulak ihre ganze Familie ermorden ließ. Jetzt ist er hinter Erika her. Erika aber will nicht davonlaufen, sondern sich rächen, und macht sich auf die Suche nach jemandem, der ihr den Weg zu einem besonderen Berg zeigen kann. Dort wohnt ein Geist, den sie um Hilfe bitten will. Doch die Suche zieht sich in die Länge, und die Häscher kommen näher….
Was diese Erzählung auszeichnet, ist weniger die Handlung an sich als die liebevolle Erzählweise, in der die Geschichte vorgetragen wird. Zolinek erzählt mal drollig, mal ernst, und man kann beinahe die Kummerfalten auf seiner Stirn sehen, wenn er zum Ende kommt. Der Zwerg wird durch seine Worte richtig lebendig, was unter anderem daran liegt, dass er ebenso viel von sich und seiner Frau wie von Erika erzählt. Dieser Teil der Geschichte ist der interessantere, denn im Gegensatz zu der Handlung um Erika, die im Grunde nicht viel hergibt, sind die Beschreibungen des kuriosen Paares und seines Planwagens samt Mitbewohner einfallsreich und gelungen.
Zu meinen eindeutigen Favoriten gehört „Das Orakel“. Die junge Priesterin der Pinks, vogelähnlicher Wesen, sucht in jeder Vollmondnacht die Höhle ihres Gottes auf. In diesen Nächten öffnet sich die Tür zum Orakel, das vorhersagt, was in dieser Nacht geschehen wird. Denn in den Vollmondnächten passieren seit mehreren Mondzyklen jedes Mal irgendwelche Katastrophen…
Edgar Halverfeld wird seit mehreren Monaten von Albträumen geplagt, immer in den Vollmondnächten, und die ganze Nacht hindurch immer wieder. Alle Versuche wachzubleiben, sind gescheitert, schlag Zwölf schläft er ein und träumt jedesmal von entsetzlichen Katastrophen….
Hier lebt die ganze Geschichte voll von den beiden parallelen Handlungen, wobei der Teil um Edgar der kleinere ist. Die fremde Welt der Pinks ist nur knapp skizziert, gerade ausreichend, damit der Leser versteht, worum es geht, und doch fließen hier und da ein paar im Grunde völlig nebensächliche Details ein, mit der frappierenden Wirkung, dass man plötzlich das Gefühl hat, es ganz genau zu wissen. Tatsächliche Antworten erhält man aber kaum. Nur eine kurze Erklärung wird geliefert, warum die Welt der Pinks und die Edgars auf einmal durch eine Tür miteinander verbunden sind. Andere Fragen wie die nach dem Grund für Edgars Albträume und Ahnliches bleiben unbeantwortet. Die Geschichte erhält dadurch etwas Rätselhaftes. Gute Idee gut umgesetzt.
„Von Zähnen, Sternen und Feen“ hat zunächst überhaupt nichts Fantastisches an sich. Jeff verschluckt sich beim Frühstück an einem ausgebissenen Zahn. Sein letzter Milchzahn. Aber die Bemerkung seines Vaters über die Zahnfee bringt ein Fass zum überlaufen und es gibt Zoff. Was das Fass gefüllt hat, erfährt man allmählich, während Jeff die Schule schwänzt. Als er endlich abends im Bett liegt, erlebt er eine Überraschung.
Jeff hat offenbar nicht unbedingt das beste Zuhause, aber im Großen und Ganzen klingt das alles eigentlich ziemlich banal und alltäglich. Wenn da nicht das seltsame Verhalten von Jeffs Mutter wäre. Jeff grübelt darüber nach, ob sie wirklich trinkt, wie ein Klassenkamerad behauptet hat. Richtig gruselig wird es erst, als die Zahnfee auftaucht, und der Leser grübelt hinterher über etwas ganz Anderes nach: „War sie’s oder war sie’s nicht?“
Auch die Hauptfigur in „Die gläserne Stadt“ ist ein amerikanischer Durchschnittsjunge, und er läuft vor etwas davon, stürzt aber im Nebel und landet an einem unbekannten Ort. Er befindet sich an einem stillen, dunklen Fluss, und jenseits schimmert Licht. Dann taucht eine Gestalt auf, die eine Maske trägt. Sie ist gekommen, um Martin etwas zu zeigen, etwas jenseits des Flusses…
Die Geschichte hat große Ähnlichkeit mit einer Traumsequenz, ist aber nicht wirr und auch nicht beängstigend. Sie spiegelt eine Art Suche wieder, ein Verarbeiten von Verlust, eine Auseinandersetzung mit dem Tod. Auch hier bleiben Fragen offen, zum Beispiel, um wen es sich bei dem geheimnisvollen Maskierten handelt, aber die Botschaft ist eindeutig tröstlich.
Eine wirklich traurige Geschichte dagegen ist ein weiterer meiner Favoriten: „Heimkehr nach Kalipay“. Kalipay ist ein wunderbarer Ort, fast ein Paradies. Doch die Jungen werden mit zwölf Jahren aus Kalipay fortgeschickt, um in einer wüsten Ödnis nach seltenen Steinen zu graben. Für die Steine erhalten sie Punkte, und nur mit genügend Punkten dürfen sie nach Hause zurückkehren. Siebenundzwanzig Jahre schuftet Gashiah schon, und ist trotzdem noch unendlich weit vom Ziel entfernt. Nur weil er bereit ist, sich in tödliche Gefahr zu begeben, kann er schließlich seine Heimat wieder betreten. Doch das Paradies währt nur kurz…
Das Erstaunlichste an der Geschichte ist, dass Gashiah am Ende zufrieden ist so wie es ist, und das trotz all der Jahre des Schuftens und der Sehnsucht. Dieses Akzeptieren ohne jede Bitterkeit verleiht der Geschichte einen Hauch wehmütiger Melancholie und ihrem Helden innere Größe.
Auch wenn die angesprochenen Erzählungen nur ein Drittel des Buches ausmachen, dürfte die Vielfalt und Besonderheit der Sammlung deutlich geworden sein, und man darf den Herausgebern bescheinigen, dass sich diese Anthologie in der Tat von der Masse abhebt: Keine Abenteuerfahrten, kein Held, der als einziger die Welt retten kann, keine Schlachten, keine großen Zauberer. Alle Geschichten zeichnen sich durch ein begrenztes Umfeld aus, das sich mehr oder weniger stark auf die Hauptperson konzentriert. Es sind kleine Welten, die hier dargestellt sind, und kleine Geschehnisse, auch wenn sie große Folgen nach sich ziehen.
Der Grund dafür liegt sicher auch in der Erzählform der Kurzgeschichte. Im Vordergrund steht das Geschehen an sich, Landschaftsbeschreibungen oder detaillierte Charakterdarstellungen fehlen. Für epische Breite ist kein Platz. Kurzgeschichten sind Momentaufnahmen, sie neigen zur Unvollständigkeit, fangen mittendrin an und hören auch mehr oder weniger mittendrin auf. Im Gegensatz zum Roman, wo man ungeklärte Fragen als Manko empfindet, gehört dies hier durchaus dazu. Eine Kurzgeschichte macht sich nicht die Mühe zu erklären, sondern verlangt, dass der Leser selbst nach einer Erklärung sucht, Lücken ausfüllt, sich vielleicht ein eigenes Ende oder eine eigene Vorgeschichte ersinnt.
Das unterscheidet diese Anthologie auch von anderen wie zum Beispiel der Diebeswelt, die Robert Asprin ins Leben rief. Dort wurde eine gemeinsame Welt erschaffen, in der die Geschichten aller Autoren spielen, und die Geschichten wurden mehrfach fortgesetzt, wodurch die Diebeswelt schon wieder epische Ausmaße annimmt. In „Wellensang“ steht jede Geschichte und jede Welt für sich allein, und es gibt auch zu keiner eine Fortsetzung, sodass der Charakter der Kurzgeschichte erhalten geblieben ist. Dadurch kann man das Buch nicht einfach von vorne nach hinten durchlesen. Es empfiehlt sich, zwischen den einzelnen Geschichten Pausen einzulegen und das Gelesene nachwirken zu lassen.
Ich fand die Sammlung äußerst bemerkenswert. Im Allgemeinen liegen mir Kurzgeschichten nicht so sehr, ich ziehe Geschichten, die sich über längere Zeit entwickeln, den Anthologien vor. Diese war jedoch eine angenehme Abwechslung, sowohl in sich selbst als auch im Vergleich zu anderen Werken. Auch wenn ich vereinzelt Assoziationen zu bekannten Werken hatte, wie in „Das Lied der Krähe“ und „Zwischen 9 und 9“, ist der Großteil der Geschichten erfrischend unverbraucht und außergewöhnlich.
Bemerkenswert finde ich aber nicht nur die Geschichten, sondern auch die Illustrationen jeweils am Beginn der einzelnen Geschichten. Mal romantisch, mal als Karrikatur, geben sie wesentliche Teile der Geschichte wieder und fügen sich harmonisch ins Gesamtbild der Anthologie ein. Sehr gelungen.
Ebenfalls lobend erwähnen möchte ich das ausgezeichnete Lektorat des Buches, was leider immer weniger selbstverständlich wird.
„Wellensang“ trägt den Untertitel „Fantasy-Welten“.
Zu meiner Schulzeit unterschied man noch zwischen Fantastischer Literatur und Fantasy, wobei Fantasy als trivial galt und deshalb das Schmuddelkind war, das man bestenfalls nachsichtig belächelte. Literatur dagegen war, grob vereinfacht gesagt, interpretierbar.
„Wellensang“ zeigt, dass diese strenge Grenze offenbar durchlässig geworden ist. Viele der darin enthaltenen Geschichten zeigen deutliche Spuren fantastischer Literatur. Im Gegenzug hat der Begriff „Fantasy“ seinen abwertenden Beigeschmack verloren.
Stephanie Bense hat sich im letzten Kapitel des Buches die Mühe gemacht und versucht, den Bergen von Genres und Subgenres ein gewisses Maß an Ordnung und Erklärung zu geben. Es ist ihr gut gelungen, ich gestehe aber, dass es für mich persönlich nicht so wichtig ist, zu welchem Genre oder Subgenre eine Geschichte gehört. Wichtig ist, dass das Thema mich anspricht und die Geschichte gut erzählt ist. Von „Wellensang“ kann ich das fast ausnahmslos behaupten. Die Erzählungen kommen aus vielen verschiedenen Ecken, sodass für jede Vorliebe etwas Passendes dabei sein dürfte, und sie sind flüssig und gut erzählt. Was man jedoch vergeblich sucht, ist Action. Auch wer es gern monumental mag, wird hier nicht auf seine Kosten kommen.
Sowohl Alisha Bionda als auch Michael Borlik haben bereits mehrere Kurzgeschichten veröffentlicht und auch bei diversen Anthologien mitgewirkt. Von Alisha Bionda ist der Fantasyroman „Regenbogen-Welt“ in Vorbereitung. Michael Borlik schreibt außerdem an seinem zweiten Roman. Zu beiden sowie auch zu den Autoren der einzelnen Geschichten und dem Illustrator findet man im Anhang des Buches eine Art Ministeckbrief.
http://www.alisha-bionda.de
http://www.borlik.de
Barth, Claudia – Über alles in der Welt – Esoterik und Leitkultur
Wir kennen solche kritischen Bücher, wo alles Esoterische als tendenziell faschistisch diffamiert wird, und winken meist müde bis stark verärgert ab. Dieses Buch bildet keine Ausnahme und dennoch ist es anders als die einschlägig bekannten diffamierenden Texte.
Die junge Autorin greift in keinem Satz aggressiv unter der Gürtellinie an, sondern rezipiert im Detail, was man vorfindet, wenn man gut recherchiert. Und sie hat hervorragend recherchiert. {Der Lektor wackelt mit dem Koppe ein Naja, sacht aber nüschte.} Natürlich muss ihrer Grundannahme widersprochen werden, dass Esoterik grundsätzlich entpolitisiere und deswegen kein soziales Engagement mehr beinhalten könne, und natürlich auch, dass alles was an monotheistischer Religionskritik geäußert wird – vor allem jüdisch-christlicher Prägung – deswegen schon faschistisch infiziert sei. Sicher gibt es solche Bezüge – die man aber nicht so überzogen thematisieren und gleichsetzen muss mit menschenverachtenden Ideologien -, die jeder Esoteriker kennen und nicht einfach die Augen verschließen sollte. Claudia Barth liefert dafür die historischen Fakten und Zusammenhänge auf eine durchaus neue und interessante Art, die lesenswert erscheint. Sie steht in der Tradition der antifaschistischen Linken und untersucht Esoterik deswegen auf spezifisch deutsche Ausprägungen. Die Fakten aus der Zeit vor und während des 3. Reiches sollte man einfach kennen und im zweiten Teil vergleicht sie die damaligen Strömungen mit denen unserer heutigen Zeit.
Sie unterliegt dabei auch sehr merkwürdigen Annahmen, indem sie angesehene Wissenschaftler wie Fritjof Capra oder Rupert Sheldrake zu Sozialdarwinisten macht oder sogar einmal mehr das „Zentrum einer experimentellen Gesellschaftsgestaltung“ (ZEGG) bei Berlin zu einer „braun“ gefärbten Sekte abstempelt. Letztere Befürchtungen wären ganz einfach auszuräumen, wenn man diese sogenannte Sekte einfach mal besuchen würde und sich anschaut, was da real passiert, anstatt nur in Anschuldigungen nachzulesen.
Einige Kritiken erscheinen zutreffend: Zum Beispiel die Kritik an der hierarchischen Form und dem Geschichtsbild der „systemischen Familientherapie“, wie sie Bert Hellinger betreibt. Auch die Entmystifizierung von Tibet und seinem Buddhismus erscheint notwendig. Nicht, um den tibetischen Buddhismus zu diskreditieren, aber der Mythos eines friedlichen Volkes ist geschichtlich gesehen einfach unrichtig. Solche Fakten sollte man kennen, wenn man ernsthaft mitreden möchte.
Obwohl die Autorin also zu den Gegnern von Esoterik zählt und überall Faschismus wittert, bleibt das Buch spannend, informativ und kann empfohlen werden, da es sich nicht auf dem gewohnt platten Feindbild-Niveau des „Wir vernichten euch und schlagen euch die Fresse ein“ bewegt. {Nachtrag des Lektors: Ja, an die Sorte AntiFas kann ich mich noch vom letzten WGT erinnern, auf dem ich war. Die hatten sich ihre Meinung geBILDet und radikal wie gehabt „nachgeschlagen“, allerdings nicht in Büchern.}
|Ursprünglich erschienen im Magazin [AHA]http://www.aha-zeitschrift.de
Ausgabe 02/2004|
Colin Forbes – Das Double
Im März 1943 gelingt es deutschen Widerstandskämpfern, Adolf Hitler, Diktator des „Dritten Reiches“, zu töten, als dieser von der russischen Kriegsfront in sein geheimes Hauptquartier, die „Wolfsschanze“, fliegt. Reichsleiter Martin Bormann, skrupelloser Drahtzieher im Schatten seines „Führers“, kann das Attentat, das dem Nazi-Regime ein Ende bereiten würde, geheim halten. Vor Jahren hat er bereits ein Hitler-Double ausgebildet. Der ehemalige Schauspieler Heinz Kuby beherrscht die Rolle seines Lebens perfekt. Nun soll er den Krieg als Marionette Bormanns fortsetzen. Aber Kuby hat nicht nur Hitlers Aussehen und Auftreten, sondern auch seinen Größenwahn übernommen. Bormann steckt in der Klemme, denn er kann auf Kuby nicht verzichten.
Die Alliierten planen einen gewagten Agenteneinsatz gegen das Reich. Ein sorgfältig präparierter ‚Überläufer‘ wird in die „Wolfsschanze“ eingeschleust: Ian Lindsay ist ein Neffe des Herzogs von Dunkeith. Hitler hat ihn vor dem Krieg persönlich kennen und schätzen gelernt. Lindsay soll dem „Führer“ ein geheimes Friedensangebot unterbreiten. Hitler, dem wegen der deutschen Schwierigkeiten an der Ostfront eine Ruhepause im Westen sehr gelegen käme, müsste eigentlich anbeißen, doch Hitler ist nun Kuby, der Lindsay nie getroffen hat … Colin Forbes – Das Double weiterlesen
Brown, Dan – Sakrileg
Robert Langdon is back – drei Jahre lang hat Autor Dan Brown nach seinem Bestseller „Illuminati“ nun herumgeeiert, um der mit den Füßen scharrenden Leserschaft so etwas wie einen zweiten Teil aufs Auge zu schrauben und zu schreiben. Die deutsche Leserschar musste sogar bis zum 19. Februar 2004 warten, bis die Übersetzung erschien – womit wir wieder einmal bei einem leidigen Thema wären: Warum werden für die deutschen Ausgaben immer solch vollkommen birnige Titel verhunzt, anstatt den aussagekräftigen Originaltitel korrekt mit „Der Da-Vinci-Code“ zu übersetzen? Aber nööö, offenbar haben nichts sagende Buchtitel, die mit dem Inhalt nicht im Zusammenhang stehen, grade Hochkonjunktur. Der 600 Seiten starke Hardcover-Wälzer ist also recht druckfrisch auf dem Markt und sucht seine Käufer, die bereit sind 19,90 Euronen dafür hinzublättern und ich bin sicher, die wird er auch ganz bestimmt finden, denn die Fangemeinde Browns ist nicht gerade klein – zu Recht. Doch schauen wir mal, was der Nachleger zu bieten hat, die stehen ja meist im Schatten ihres Prequels.
_Auf der Flucht – Zur Story_
Nach dem Showdown im Vatikan (siehe „Illuminati“) ist nun ein knappes Jahr vergangen und Harvard-Symbolologe Robert Langdon ist ein wenig zur Ruhe gekommen. Derzeit gibt er in Paris einige Vorlesungen über religiöse Symbolik, wobei er auf einem Weg auch gleich mit einer Koryphäe zum Essen verabredet ist, mit dem er über das Manuskript seines geplanten Buches schwatzen will. Das neue Buch enthält einige Thesen, die kirchlichen Zündstoff bedeuten, daher möchte er die Meinung von Jacques Saunière – seines Zeichens Leiter der berühmten Pariser Kunstgalerie im Louvre und Experte auf diesem Gebiet – auf dessen Einladung hin einholen. Doch Saunière erscheint nicht – kann er auch nicht, denn er liegt (bereits im Prolog) erschossen im besagten Louvre. Dafür klingelt die französische Mordkommission ihn unsanft aus seinem Hotelbett. Diese hält ihm ein Polaroid der gefundenen Leiche vor die Augen und bittet ihn, sich den Tatort anzuschauen, denn die Verrenkungen, sprich: die Auffindesituation des Körpers ist nicht nur seltsam, sondern wurde vom Opfer auch offensichtlich selbst herbeigeführt und ist nicht dem Täter zuzuschreiben. Die Spuren und Hinweise, die der Sterbende mit letzter Kraft geliefert hat, sind überaus rätselhaft…
…was Langdon jedoch nicht ahnt, ist, dass er insgeheim beim leitenden Beamten als Haupttatverdächtiger gilt, denn der ermordete, umtriebige Kustus des Louvre war nicht nur ein Experte auf dem Gebiet der freimaurerischen Symbolik, sondern auch der Großmeister einer freimaurerischen Loge: Der berühmten „Prieuré de Sion“. Die Hüter des Geheimnisses über die wahre Natur und das derzeitige Versteck des heiligen Grals. Dumm für Langdon, dass der Sterbende, bevor er das Zeitliche segnete, eine ausgeklügelte Spur in die Vergangenheit gelegt hat, die nur Langdon in Zusammenarbeit mit der Enkelin (Sophie – ihres Zeichens ebenfalls Polizistin und zudem passionierte Kryptologin/Codeknackerin) des Opfers lösen kann, der Saunière auf perfide Weise auch eine verschlüsselte Botschaft hat zukommen lassen. Leider missinterpretiert die Pariser Polizei die Fingerzeige, da sie von der verwendeten und stark verschachtelten Symbolik nicht den blassesten Schimmer hat. So kommt es denn, dass die beiden – nach überhasteter Flucht vom Tatort – auf der Schnitzeljagd nach dem heiligen Gral nicht nur den wahren Killer, sondern auch die französische Polizei im Genick sitzen haben…
_Verschwörungstheorie – Kritik_
Das überaus bewährte Strickmuster Browns geht in die Zweite (wenn man „Meteor“ hinzurechnet, sogar in die dritte) Runde. Jedoch ist dies der zweite Roman mit Robert Langdon als Protagonisten, daher muss er sich als Nachleger direkt mit dem ersten Werk messen lassen… und die Messlatte liegt hoch. Wieder ist es das „alte Europa“, wieder ist es ein alter Geheimbund, um den sich alles dreht. Für Browns Geschichten halten stets reale Orte und ebenso reale Begleitumstände her, allerdings liegt es in der dichterischen Freiheit eines Belletristikers, Realität und Fiktion miteinander zu vermengen, im Idealfall springt dabei ein spannender Plot heraus. Das ist ihm hier auch ganz gut gelungen, obschon dem gut informierten Verschwörungstheoretiker vieles sehr bekannt, anderes allerdings hanebüchen und etwas verfälscht vorkommt.
Wie schon bei Illuminati, stehen die Kontrahenten bereits auf den ersten Seiten augenscheinlich fest, da hätten wir in der roten Ecke die Loge der „Prieuré de Sion“, die sich als Hüter und rechtmäßige Erben des heiligen Grals und Nachkommen des biblischen Stammes David sehen. In der blauen Ecke hockt – ob dieser Gotteslästerung hoch motiviert – der Hardliner-Flügel des Katholizismus, „Opus Dei“, die den klerikalen Status Quo liebend gern mit Zähnen und Klauen verteidigen wollen. Doch kann man bei Brown darauf vertrauen, dass die Loyalitäten und Absichten seiner Figuren im Laufe der Handlung nicht in Stein gemeißelt sind.
Wie gewohnt verquickt er Mystizismus und Symbolik in einem Kriminalroman, der wieder einmal in einem wilden Wettlauf gegen die Mächte der (weltlichen und kirchlichen) Finsternis gipfeln, diesmal jedoch ist sein Protagonist der Gejagte, dabei ist es nicht nur die französische Polizei, vor der sich Langdon in Acht nehmen muss, da er unter akutem Mordverdacht steht. Ein ganzer Tross mehr oder weniger zwielichtiger Gestalten mischt auch noch mit, und deren Motivationen sind bis zuletzt nicht ganz klar. Die intelligent – und in Teilen real nachvollziehbare – gemachte Schnitzeljagd erhält durch den Ständig-auf-der-Flucht-Faktor eine etwas andere Komponente, erscheint jedoch an mancher Stelle etwas durchschaubar, was den groben Handlungsverlauf angeht – richtig interessant sind aber die Lösungswege, die Brown wieder mal gekonnt inszeniert und herleitet.
Doch auch da waren mir einige Sachen ZU offensichtlich, als Beispiel sei hier die ominöse Fibonacci-Folge als Code für ein Bankschließfach genannt, da möchte man den Figuren eine schallende Ohrfeige verpassen, weil sie scheinbar zu blöd sind, solche Zusammenhänge zu erkennen und sich unnötigerweise Seiten schindend die Köpfe heiß rätseln, während der Leser von einem akuten Gähnanfall in den anderen fällt. Glücklicherweise sind solche Hänger in der Geschichte die Ausnahme und auch den Vorwurf des Eigenplagiats wegen einiger Parallelen zu „Illuminati“ muss sich Brown nicht vorwerfen lassen – Die Geschichte ist trotz mancher Ähnlichkeit eigenständig genug, um sich vom Erstlingswerk abzusetzen.
Die Thematik des heiligen Grals und die Zusammenhänge mit der Hochgradfreimaurerei sind alles andere als unumstritten und gerade die Prieuré de Sion ist für manchen Sachbuchautor heutiger Tage alles andere als ein harmloser, sektiererischer Haufen idealistischer Gutmenschen (allenfalls etwas spleenig, was ihre Rituale angeht), sondern immer noch einer der mächtigsten, freimaurerischen – und mithin gefährlichsten, sofern man daran glaubt – existenten Geheimbünde unserer Zeit. Ein verklärt-romantischer Eindruck entsteht jedoch beim Lesen von „Sakrileg“, und das fügt der Mythen- und Legendenbildung ein weiteres (fragwürdiges) Steinchen hinzu.
Dennoch steckt in dem verarbeiteten Material so manches Korn mehr Wahrheit und (anti-)klerikale Weltanschauung der Loge bzw. der erzkatholischen Falken-Sekte von Opus Dei, als dem unbelasteten Leser, der meint ’nur‘ einen Thriller zu konsumieren, bewusst sein dürfte. Auch Opus Dei ist als real existierende Vatikan-Splittergruppe kein unbeschriebenes Ruhmesblatt der Kirchengeschichte und einen aufmerksamen Blick in diverse Publikationen wert. Es lohnt sich also auf jeden Fall, vor oder nach der Lektüre Sekundärliteratur zum Thema Geheimbünde und Vatikan griffbereit zu haben, ohne Vorwissen macht der Roman nämlich nur halb so viel Spaß. Browns unfreiwillige (ist sie das wirklich?) Interpretation des Stoffes ist bärig interessant und nett verpackt.
Dem Kenner der Materie huscht des Öfteren ein wissendes Grinsen übers Gesicht, wenn beispielsweise vom „göttlichen Weiblichen“, sexual-okkulten Riten oder den „Merowingern“ die Rede ist, die Anspielungen selbst bis ins kleinste Detail (auch der Name des Mordopfers Saunière ist tatsächlich historisch und freimaurerisch vorbelastet) sind für gestandene Verschwörungstheoretiker ein gefundenes Fressen. Bleibt die Frage, ob Brown solch freimaurerisches Gedankengut absichtlich – hübsch verpackt – über das Transportmedium Thriller unters Volk bringen will, weil er der Bruderschaft bzw. ihrer Ideologie nahe steht (Ohne ihm hier etwas unterstellen zu wollen, aber das wäre eine Erklärung, warum die Prieuré de Sion hier relativ gut wegkommt, während die klerikale Seite – schon wieder mal – regelrecht abgewatscht wird) oder ob Sakrileg einfach nur das ist, was es vorgibt zu sein: Ein flotter Roman, der Fakten und Fiktion spannend miteinander verknüpft. Das ist bei Brown ja stets der Clou: Man kann auch vor Ort in der Realität tatsächlich vieles nachprüfen.
_Dr. Kimball-Langdon und der heilige Gral – Fazit_
Das Warten hat sich durchaus gelohnt, mit „Sakrileg“ hält man ein Buch in den Händen, das man so schnell nicht beiseite legt; wenn die rasante Geschichte erst einmal ins Rollen gekommen ist, möchte man trotz kleiner Unpässlichkeiten in der Originalität dann doch wissen, wie es weitergeht und in Erfahrung bringen, welcher Natur der heilige Gral denn nun eigentlich ist und wo er versteckt wird. Gerade Liebhaber von grenzwissenschaftlicher Enthüllungsliteratur finden im Plot eine Menge interessanter freimaurerischer und sakraler Symbolik wieder.
So an den Haaren herbeigezogen ist die Sache nämlich nicht, wie Otto-Normal-Leser vielleicht annehmen mag, der sich mit solchen oft in der Öffentlichkeit als Spinnerei geschmähten Theorien zur alternativen Menschheits- und Kirchengeschichte noch nie beschäftigt hat. Im Roman ist jedenfalls viel mehr zu finden als das profane Auge („Profane“ nennt man in Freimaurerkreisen uns nicht-eingeweihte Normalsterbliche) des unbedarften Lesers sieht. Zumindest beweist die mehr oder weniger versteckte Präsentation von in den Öffentlichkeit wenig bekannten (oder ignorierten) Informationen über die Geheimbündelei und die Gralslegende, dass Brown seine Hausaufgaben ordentlich gemacht hat. Ganz kommt „Sakrileg“ nach meinem Dafürhalten nicht an „Illuminati“ ran, aber ein guter Thriller ist es allemal.
Robert Harris – Pompeji
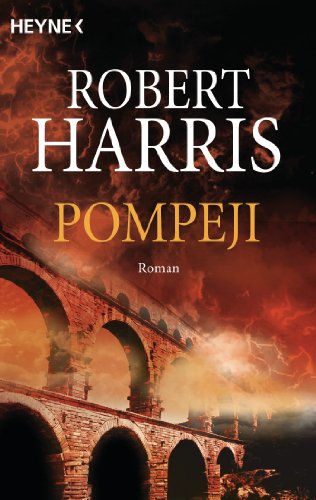
Robert Harris – Pompeji weiterlesen
Michael Hesemann – Geheimakte John F. Kennedy
_Quo Vadis – Ein Überblick zum Fall Kennedy_
John Fitzgerald Kennedy dürfte den Meisten wegen seines berühmten Spruches an der Berliner Mauer „Ick bin ain Berlina“ bekannt sein – und natürlich wegen seines gewaltsamen Ablebens, das damals am denkwürdigen 22. November im Jahre 1963 weltweit für Furore sorgte. Der amerikanische Präsident war allseits beliebt – zumindest beim Volk, aber wohl doch nicht in allen Kreisen, bis hoch in die Ämter seiner eigenen Regierung. Das Attentat in Dallas/Texas gilt heute als DER Startschuss für den Vietnam-Krieg, den Kennedy seinerzeit unter keinen Umständen billigen wollte. Seine Liberalität war sein Todesurteil. Michael Hesemann greift die losen Fäden der Geschichte und des Mythos Kennedy noch einmal auf und fügt sie in diesem Buch zusammen.
Nein, Präsident Kennedy hatte wahrlich nicht nur Freunde, sondern auch überaus zahlreiche und mächtige Feinde: Waffenlobby, CIA, Mafia, Exil-Kubaner – um nur die Wichtigsten zu nennen. Vor allem die CIA hatte allen Grund zur Freude über seinen Tod, hatte er doch kurz zuvor ihre Zerschlagung angedroht, was gleichzusetzen mit einer Quasiauflösung des Dienstes gewesen wäre, sprich: erheblichem Machtverlust. Sie waren nicht die Einzigen, die davon profitierten, dass nach den tödlichen Schüssen beinahe im Vorbeigehen und noch am gleichen Tag des Attentats sein Vize Lyndon B. Johnson buchstäblich on-the-fly vereidigt wurde und Kennedys bereits eingeleitete Reformen sofort stoppte. Doch schon die Vorbereitung des Präsidentenbesuchs in Dallas bringt bei genauerer Betrachtung Erstaunliches zu Tage:
Kurz vorher wurde beispielsweise – vollkommen ungewöhnlich – die Fahrtroute der Kolonne gravierend geändert, sodass der offene Wagen des Präsidenten zwangsläufig an der Stelle der tödlichen Schüsse sehr langsam fahren musste. Ein Unding. Die ursprünglich geplante Route hätte ihn erst gar nicht auf den Präsentierteller des Dealey Plaza geführt, doch sein Sicherheitsschef – der dies nach eigenen Angaben niemals zugelassen hätte – wurde kurzerhand an einen anderen Einsatzort abberufen. Der ganze Einsatz des Sicherheitspersonals beim Präsidentenbesuch ist scheinbar ziemlich schief und stümperhaft gelaufen und weist einige Unstimmigkeiten auf, die man nur mit vorsätzlicher Absicht erklären kann. Offiziell fielen bei diesem Hinterhalt drei Schuss und diese allesamt aus den 5. Stock eines Schulbuchlagers hinter der Wagenkolonne des Präsidenten. Zeugen behaupten etwas anderes – sowohl was die Anzahl der Schüsse, als auch die Position der mutmaßlichen Schützen angeht – und auch ein von einem anwesenden Zuschauer aufgenommener Amateurfilm zeigt, dass der tödliche Kopftreffer von vorn kam und nicht von hinten.
Die Geschichte von der „magischen Kugel“, die Kennedy letztendlich getötet haben soll, gehört zu den lächerlichsten Chimären in der Geschichte der Neuzeit – und fast alle haben sie geglaubt. Denn um die vielfältigen Einschüsse und dieser 3-Schuss-Theorie widersprechenden Verletzungen Kennedys und seiner Mitfahrer zu erklären, dichtete man dem Projektil Fähigkeiten an, die der Physik und der Logik Hohn sprechen. Die Autopsie wurde hastig, mehr als mangelhaft durchgeführt und dokumentiert, Teile des Berichts darüber verschwanden oder wurden offensichtlich manipuliert, doch die mit der Klärung beauftragte Kommission nahm offensichtlich keinen Anstoß an solchen ‚Kleinigkeiten‘ wie Plausibilität und Physik. Die Warren-Kommission tat im Gegenteil augenfällig ihr Bestes, sich möglichst schnell auf einen Attentäter zu einigen: Lee Harvey Oswald – der konnte als Leiche ja auch schlecht widersprechen. Bekannterweise wurde Oswald kurz nach dem Attentat von einem angeblichen, irren Fanatiker liquidiert, welcher später unter ebenfalls äußerst mysteriösen Umständen verstarb. Solcherlei ‚ungeklärtes, plötzliches Ableben‘ (böse Zungen mögen es auch ‚Mord‘ nennen) potenzieller Petzen war kein Einzelfall, sondern eher die Regel.
Auch massenhaft der offiziellen Darstellung widersprechende, aber sehr glaubwürdige, unabhängige Zeugenaussagen, welche mehrere Schüsse aus einer ganz anderen Richtung als dem fraglichen Schulbuchlager wahrgenommen haben, wurden ignoriert, oder die betreffenden Zeugen unter Druck gesetzt, diffamiert oder gar peu à peu aus dem Weg geräumt. Summa summarum beläuft sich der Bodycount in diesem Zusammenhang auf 42 am Fall mehr oder weniger beteiligter Menschen (hauptsächlich Augenzeugen), die unter teils kuriosen Arten ihr Leben aushauchten. Zeugen zu beeinflussen oder zu beseitigen, Tatsachen zu verdrehen, Akten verschwinden zu lassen und die gesamte Sache möglichst in Nebel zu hüllen, zieht sich wie ein roter Faden durch den Fall Kennedy. Im Laufe der Zeit wankten die offiziellen Darstellungsversuche vom „alleinigen Einzeltäter“ Lee Harvey Oswald immer mehr und es kamen berechtigte Zweifel auf, dass Oswald überhaupt abgedrückt hatte – seine Verstrickung in diese tief verschachtelte Geschichte ist hinlänglich erwiesen, doch ist er auch der Täter gewesen?
Die Begleitumstände lassen das fragwürdig erscheinen und legen eher den Schluss nahe, dass er ein simples Bauernopfer war. Das Gewehr, dass er zur Tat angeblich verwendet hat, war ein Uralt-Prügel und alles andere als ein Präzisionsgewehr, doch soll er in knapp sieben Sekunden auf dreihundert Meter drei Schuss treffsicher abgefeuert haben. So ein Kunststück bringen selbst Scharfschützen mit besseren Gewehren kaum fertig. Zudem war das Zielfernrohr nachweislich defekt und er als mieser Schütze bekannt. Selbst wenn er es fertig gebracht haben sollte, so bleibt immer noch der bildliche Beweis des Amateurfilmers, dass der tödliche Treffer von vorne in Kennedys Schädel eindrang. Das spricht für noch mindestens einen weiteren Heckenschützen, der die Kolonne von vorn unter Feuer nahm. Wahrscheinlicher ist, dass es sogar eher drei Gunmen waren. Wieder belegen Zeugenaussagen, dass dem tatsächlich so war. Doch all das wurde geflissentlich übersehen.
Der Staatsanwalt von New Orleans – Jim Garrison – war Jahre später der Einzige, der sich getraute, den Fall noch einmal weitreichend und minutiös aufzurollen, weil es himmelschreiende Ungereimtheiten und Anzeichen für eine Verschwörung im großen Stil im Abschlussbericht der Kommission gab. Sein hartnäckiges Engagement war offensichtlich zu weitreichend für einige Gestalten. Er hatte geradewegs in ein Wespennest gestochen. Trotzdem man ihn versuchte, öffentlich zu diffamieren und sogar offen zu bedrohen, brachte er es bis zum Prozess und auf zwei Bücher zum Thema. Mehr als die Öffentlichkeit aufzurütteln, konnte er aber nicht bewirken, der Prozess gegen einige der mutmaßlichen Verschwörer endete aufgrund einer formaljuristischen Spitzfindigkeit mit einem – recht zweifelhaften – Freispruch. Auf diesem Stoff basierend, schuf Oliver Stone 1992 den Film „JFK – Tatort Dallas“ mit Kevin Costner in der Hauptrolle, der kurioserweise schon im Vorfeld durch eine Hetzkampagne niedergemacht wurde, jedoch das Interesse am Mordfall Kennedy in der Öffentlichkeit wieder entfachte.
Garrisons geradezu inquisitorischem Ermittlungseifer damals und auch dem ambitionierten Film Oliver Stones ist es jedoch zu verdanken, dass die amerikanische Regierung heutzutage immerhin – gezwungenermaßen zwar – „die Möglichkeit eines Komplotts“ offiziell einräumt, jedoch weiterhin stur an Oswald als Täter festhält – allen gegenteiligen Indizien, die in all den Jahren auftauchten und zusammengetragen wurden, zum Trotz. Der Mord und die weitreichende Vertuschung der Vorgänge sind längst Legende und alle Sachverhalte bei weitem nicht zufrieden stellend geklärt, nicht zuletzt deswegen, weil aufschlussreiche Akten weiterhin unter fadenscheinigen Vorwänden von offizieller Seite unter Verschluss gehalten werden. Das Mauern geht also auch jetzt, vierzig Jahre nach dem Attentat, munter weiter.
_Qui Bono – Kritik_
Die Konsequenzen des Anschlags ziehen bis zur Jetztzeit ihre Kreise und selbst einige der heute im Amt Sitzenden waren damals schon offensichtlich mehr oder weniger involviert. George Herbert W. Bush Senior beispielsweise. Das jedenfalls recherchiert Hesemann aus Akten aus der aktiven CIA-Zeit des Ex-Präsidenten und Daddys des aktuellen Chefs des Weißen Hauses. Obwohl es mittlerweile ja en vogue ist, auf den Bush-Clan einzuprügeln, nimmt dieses Kapitel nicht viel Platz ein. Bush Senior war wohl nur ein kleines Rad im Getriebe der damaligen Vorgänge – eins von vielen. Als treibende Kraft hinter allem macht Hesemann hauptsächlich die CIA und auch andere Gruppierungen aus, die sich zusammenschlossen, um den bei ihnen so verhassten liberalen Präsidenten über die Klinge springen zu lassen. Genüsslich zerpflückt er die Einzeltäter-Theorie und nimmt CIA, Mafia, Waffenlobby und die Exilkubaner aufs Korn– ja selbst die Freimaurer kriegen ihr Fett weg. Letzteres ist ein recht neuer Aspekt und gar nicht mal so abwegig, muss aber heikle Spekulation bleiben. Dennoch interessant hergeleitet.
Den anderen Aspiranten auf die Täterschaft kann man mit belegbaren Facts schon eher zu Leibe rücken, viel Neues hat Hesemann aber nicht zu bieten – die meisten Erkenntnisse stützen sich auf die Ermittlungsarbeit von Jim Garrison und rekapitulieren sie nur noch einmal zusammenfassend. Zeugenaussagen, Protokolle und der berühmte „Zapruder“-Film (benannt nach Abraham Zapruder, der das Attentat mit seiner Super8-Kamera filmte, dessen Bilder später um die Welt gingen) sind unlängst bekannt, wenn auch vielleicht nicht in unseren Landen. Vieles von dem, was er schreibt, kommt in dieser oder abgewandelter Form auch im oben erwähnten Film von Oliver Stone vor, den Hesemann auch mehr als einmal lobt – da gebe ich ihm Recht, der Film ist um einiges verdaulicher als die Literatur. Nicht dass der Schreibstil etwa langweilig wäre, nein, es ist nur verdammt schwer, die ganzen Namen der Beteiligten keinem Gesicht zuordnen zu können. Es gibt eine Menge Namen und Ämter zu verdauen, quasi ein Who-is-Who aus Wirtschaft, Politik und Geheimdienst dieser Zeit. Oftmals verwirrend für jemanden, der sich noch nie zuvor damit auseinander gesetzt hat und somit, denke ich, recht schwere Kost.
Hesemann verknüpft aber auch die derzeitige Großwetterlage Amerikas mit den damaligen Ereignissen, sind doch viele der Handelnden ehedem zu Amt und Würden gelangt und haben den Lauf der Geschichte in der Folge maßgeblich beeinflusst. Ein vordergründig ziemlich wackeliges Argument, denn jede geschichtliche Begebenheit zieht unweigerlich einen Rattenschwanz an Kausalitäten hinter sich her, inwiefern das steuerbar ist, sei dahingestellt. Erstaunlich jedoch, abgesehen vom Wie, dass die alten Seilschaften (oder deren Zöglinge) zum Teil immer noch an den Fäden ziehen bzw. in Machtpositionen sitzen; Kennedys Beseitigung hat diese Entwicklung auf jeden Fall begünstigt und beschleunigt – wenn nicht gar erst ermöglicht -, insofern muss man ihm beipflichten. Unstrittig ist auch die These des Komplotts, denn eine solche Vertuschungsaktion entspricht nicht der Handschrift eines verblendeten Einzeltäters, sondern erfordert eine Menge Leute und setzt eine komplizierte Planung, Logistik und hohe Machtposition voraus, etwas in diesem groß angelegten Stil durchzuziehen. Die Indizien, die gegen Oswald als Todesschützen sprechen, waren und sind erdrückend. Das dokumentiert Hesemann auch mit zahlreichen Quelltexten, Fotos und Schaubildern, die trotz ihrer Brisanz bemerkenswerterweise frei zugänglich sind und zum Nachdenken anregen.
_Status Quo – Fazit_
Durch die Gnade der späteren Veröffentlichung im Jahre 2003 ist das Buch natürlich um einige Erkenntnisse reicher als ältere Publikationen und illustriert, wie Verschleierungstaktik seit jeher zur amerikanischen Politik gehörte und gehört. Notfalls geht man dabei auch über die Leiche des eigenen Präsidenten. Diese Einsicht ist nicht gerade neu und wird zähneknischend nun auch von offizieller Seite bestätigt – halbwegs jedenfalls. Publikationen wie diese geraten schnell unter Beschuss und der Grat zwischen Phantasterei und wirklicher Enthüllung ist denkbar schmal. Hesemann geht den sicheren Weg und resümiert hauptsächlich den Tathergang und Hintergründe, wie sie allgemein hin schon als erwiesen angesehen werden – basierend auf der Vorarbeit von Jim Garrison – und reichert die ohnehin dichte Indizienkette gegen die Verschwörer mit einigen eigenen Theorien an. Die leitet er gut her, sie entbehren nicht einer gewissen Logik. Letztendliche Gewissheit aber kann man wohl nur erlangen, wenn die derzeit noch unter Verschluss gehaltenen Akten tatsächlich irgendwann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Wenn. So sicher ist das nämlich nicht. Unterm Strich bleiben eine sehr detaillierte Zusammenfassung zum aktuellen Stand der Dinge im Mordfall Kennedy und eine prima Ergänzung/Nachschlagewerk zum Film Oliver Stones.