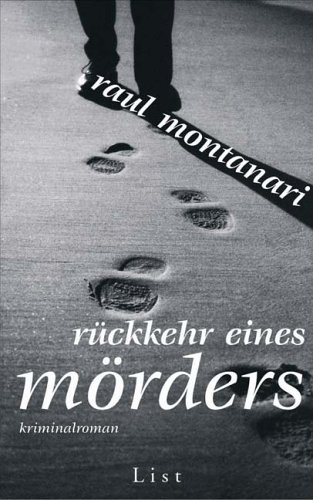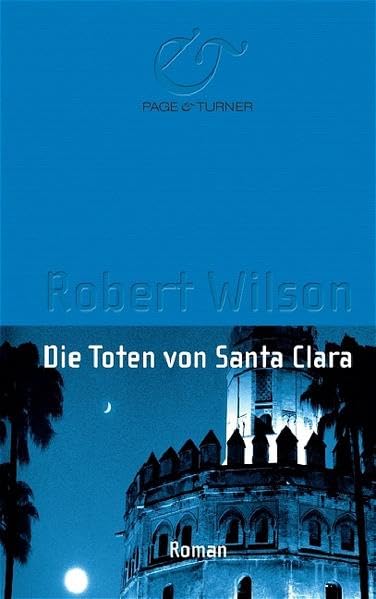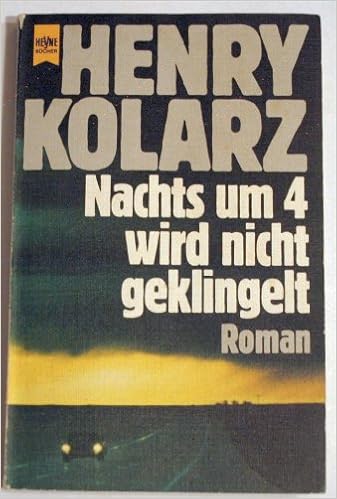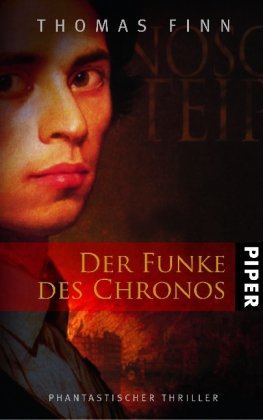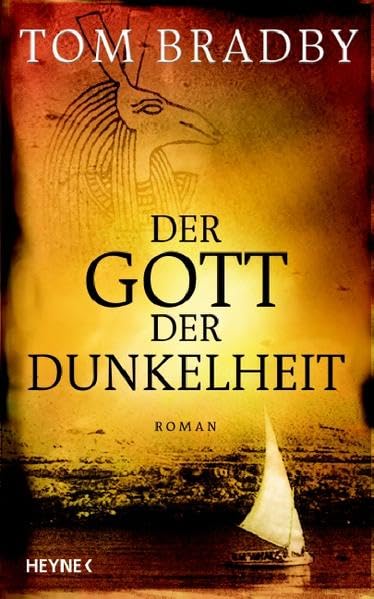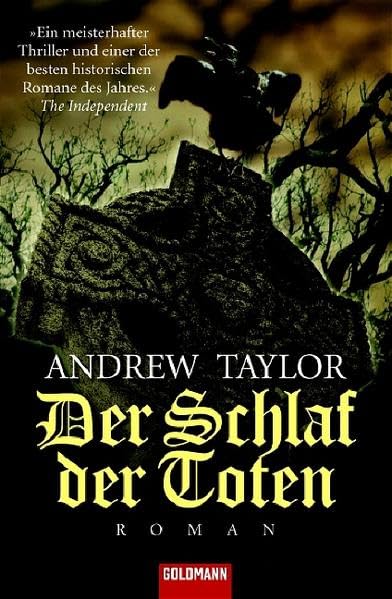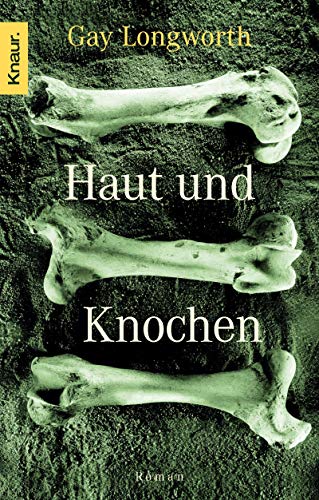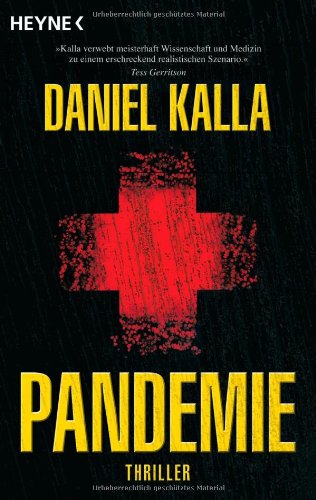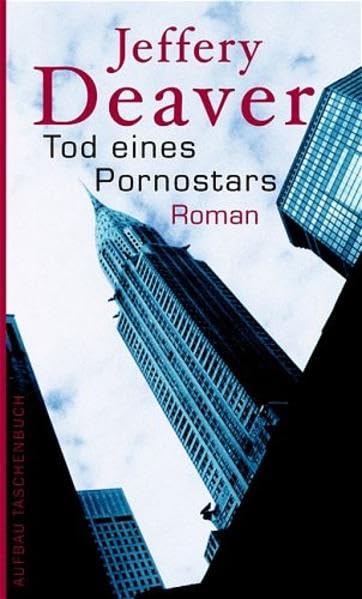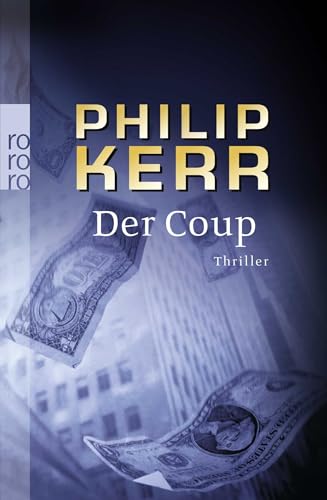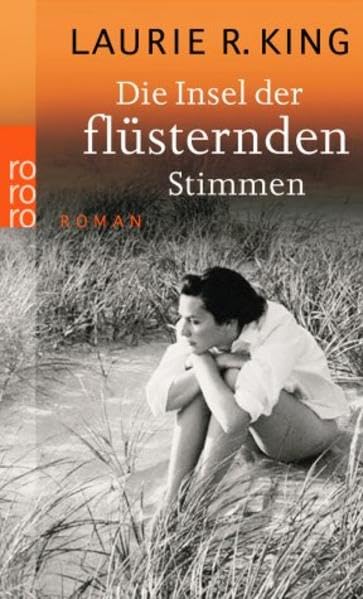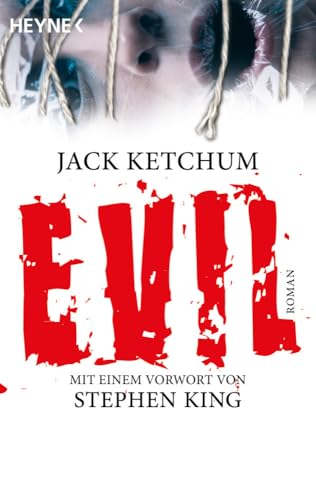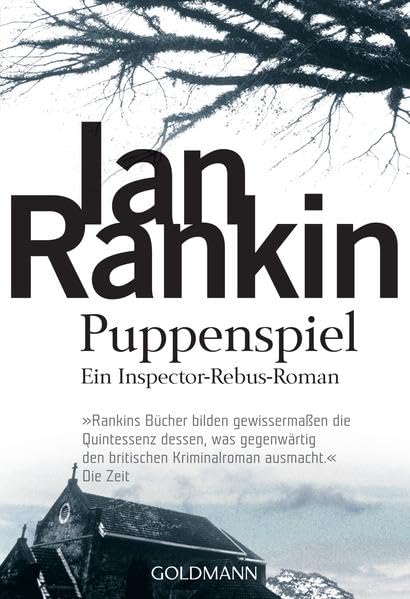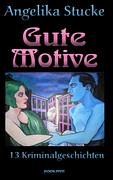„Rückkehr des Mörders“ ist eines dieser Bücher, von denen man anfangs nichts Spektakuläres, sondern einfach nur gute Unterhaltung erwartet, dann aber vom Inhalt total umgehauen wird. Ein unscheinbares Cover, ein dürftiger Klappentext und ein fast schon belangloser Titel – was soll an diesem Buch schon so besonders sein? Nun, besonders ist diese beklemmende, teils auch schon fast furchterregende Atmosphäre, die von den Charakteren in der Story ausgeht. Raul Montanari hat einige sehr brutale Figuren erschaffen und lässt diesen innerhalb der Erzählung auch weitestgehend freie Hand, was die Action anbelangt. Was dabei herausgekommen ist, ist schließlich weitaus mehr als das, was der kurze, unscheinbare Text auf dem Buchrücken vermuten lässt. „Rückkehr eines Möders“ bohrt nämlich um einiges tiefer und geht dabei bisweilen tief in die menschliche Psyche und ihre erschreckendsten Auswüchse hinein – nur um am Ende so simpel und direkt zu wirken, dass man, wahrlich fasziniert vom effektreichen Stil des Autors, Beifall klatschen muss!
_Story_
13 lange Jahre hat Andrea in Kanada verbracht, und in all dieser Zeit hat sich der ursprünglich aus einem kleinen italienischen Dorf stammende Mann wie ein Aussätziger gefühlt. Weggeekelt hat man ihn einst, als die junge Ilaria gestorben und Andrea des Mordes beschuldigt wurde. Und bis heute ist sich das gesamte Örtchen sicher, dass der langhaarige Schönling hinter dem Verbrechen steht. Andrea hat diesen Gedanken nie aus seinem Kopf vertreiben können, selbst wenn er nun in Kanada als Polizist ein ganz neues Standbein aufgebaut hat.
Eines Tages treibt ihn der Tod seiner Mutter zurück in seine Heimat, in der sich allerdings nichts verändert hat. Bereits bei seiner Ankunft schlägt ihm Feindseligkeit entgegen, als Ilarias Bruder Loris ihn erkennt, und nur wenige Stunden später muss Andrea bereits den Zorn der versammelten Dorfgemeinschaft spüren. Ganz anders hingegen reagiert die jugendliche Dora auf die Ankunft des verhassten Verdächtigen. Die Tochter des damals ermittelnden und mittlerweile an den Rollstuhl gefesselten Polizisten ist fasziniert von der Ausstrahlung Andreas – ganz zum Unmut ihres Vaters und ihrer Stiefmutter Antonella, die damals eine Affäre mit Andrea hatte. Je mächtiger der Hass der Anderen wird, desto größer wird auch ihr Verlangen nach Andrea, dem dies ebenfalls nicht entgeht. Immer wieder treffen die beiden aufeinander, doch die flüchtigen Momente reichen nicht aus, um ihre Begierde zu befriedigen. Außerdem lebt es sich für Andrea immer gefährlicher. Nicht nur Loris und sein Bruder Gianni haben sich gegen ihn verschworen; auch der brutale Sportstar Mauro schreckt vor keiner Grausamkeit zurück und stellt sich kompromisslos gegen Andrea. Dieser bewahrt jedoch die Ruhe und begibt sich daran, das Verbrechen von damals auf eigene Faust aufzudecken. Speziell der mysteriöse und um lehrreiche Geschichten nie verlegene Pfarrer Don Alfio scheint mehr zu wissen, als er zunächst zugibt. Doch bevor Andrea richtig klarsieht, wird auch schon ein weiterer Mensch tot aufgefunden, und es scheint, als würden die Emotionen von damals nun noch in weitaus schlimmerer Form wiederbelebt werden …
_Meine Meinung_
Die ersten Kapitel dieses Buches waren eine echte Qual, weil Montanari durch die Aufdeckung sehr vieler Tatsachen schon enorm schnell auf den Punkt kommt und die Geschichte bereits gelöst zu sein scheint, bevor sie richtig anfängt. Entsprechend habe ich mich bis zum Ende des ersten Fünftels dann auch eher gelangweilt, bis dann endlich mal so richtig Fahrt in die Sache kam und die wahren Hintergründe bzw. die echten Persönlichkeiten der Hauptcharaktere zum Vorschein traten. Oder zumindest das, was man hinter Leuten wie Mauro, Don Alfio, der Wahrsagerin Anna und dem körperlich eingeschränkten Werner vermutet. Und ab diesem Zeitpunkt ist „Rückkehr eines Mörders“ auch eine echte Berg- und Talfahrt, bei der sich die Rollen der beteiligten Hauptpersonen ständig ändern, so dass sich gleichzeitig auch die Perspektive des Lesers von Sinneinheit zu Sinneinheit wieder komplett erneuert.
Montanari hat sich am Anfang recht viel Zeit gelassen, den Schauplatz und den gesamten Rahmen vorzustellen, und die Folge ist, dass man sich recht schnell in Sicherheit wiegt, weil man glaubt, bereits alles über die einzelne Charaktere zu wissen. Doch das genaue Gegenteil trifft letztendlich zu; wirklich jede einzelne Person nimmt in diesem Buch mehrfache Wandlungen vor und gerät unerwartet in ein ganz anderes Licht. Hinter jedem schwebt ein unantastbares Mysterium, das sich absolut nicht ergründen zu lassen scheint und dem man während des gesamten Buches stets auf der Spur ist. Und dabei ist man sich ja doch eigentlich immer sicher zu wissen, wie es damals abgelaufen sein muss und wer genau dahintersteckt, da Montanari ohne jegliche Wertung schon ganz klar die ‚Guten‘ von den ‚Bösen‘ trennt. Doch dann wieder verliert man die Sicherheit des einstweiligen Verdachts und grübelt erneut darüber, wie der Tathergang gewesen sein muss.
Die Aufdeckung des Mordes von damals ist jedoch nur die Rahmenhandlung dieses Buches; weit wichtiger ist hier die eigentliche Rückkehr Andreas mit all ihren unschönen Nebenwirkungen. Und hier geht der Autor selber auch keine Kompromisse ein; vor allem auf die Beschreibungen der vielen Schlägereien lässt er sich sehr detailliert ein und rutscht nicht nur einmal mit seinen Schilderungen in übelsten Gossen-Slang ab. Vor allem die Bearbeitung des Genitalbereichs bei diesen Aggressionen haben es ihm angetan und tauchen gerade in den gewaltreichen Szenen gehäuft auf. Die einzige Schwäche stellt diesbezüglich auch die Wortwahl dar. Montanari liebt anscheinend den Begriff ‚Schwanz‘ und verwendet ihn auch gerne in jedem Zusammenhang der Gefühlslage des Protagonisten. Und dies ist nur ein Beispiel von vielen, das deutlich machen soll, mit welch simplen sprachlichen Mitteln der Autor in diesem Buch arbeitet. Simplizität ist in diesem Fall aber auch ganz klar mit Effektivität gleichzusetzen, und das in allerlei Hinsicht.
Raul Montanari hat nämlich durch die vielfältigen Nebenstränge dafür gesorgt, dass die Geschichte von allen Seiten immer wieder neue Impulse bekommt, ohne dafür ein großartiges Brimborium veranstaltet zu haben. Die Fakten liegen immer klar auf der Hand, und dennoch liegen dem Autor zahlreiche Möglichkeiten offen. So spielt er zum Beispiel mit der erotischen Anziehungskraft zwischen Dora und Andrea und mit der scheinbaren Überlegenheit des Dreiergespanns Loris/Gianni/Mauro und setzt diese immer wieder perfekt ein. Gleiches gilt für den Pfarrer, oder aber für Anna und nicht zuletzt für die unglücklich verheirateten Werner und Antonella. Alle Personen haben markante Eigenheiten und offenkundige Motive, lassen sich aber trotzdem in kein ersichtliches Schema einordnen. Und um diese ständige Ungewissheit auf Seiten des Lesers zu erreichen und ggf. noch zu verstärken, greift der Autor fast ausschließlich auf sehr simple Mittel zurück, aber das mit Bravour.
„Rückkehr des Mörders“ ist ganz sicher kein komplexes Buch und überzeugt durch einen sehr gradlinigen, gut durchstrukturierten Ablauf. Trotzdem aber ist die Story enorm reich an Wendungen und Spannung, speziell im letzten Drittel, bei dem es wirklich Schlag auf Schlag geht. Wenn hier überhaupt etwas stören könnte, dann die oftmals bemühte umgangssprachliche Wortwahl, doch im Grunde genommen passt diese sich auch nur der skrupellosen Umgangsart der jungen Italiener innerhalb der Geschichte an. Man sollte sich jedenfalls auf keinen Fall von den nichts sagenden Worten auf dem Rücken des Buches irritieren lassen, denn in „Rückkehr des Mörders“ steckt letzten Endes eine ganze Menge mehr als das, was man auf den ersten Blick vermutet.
_Fazit_
Raul Montanari hat eine sehr intensive, fesselnde Story kreiert und sich dafür einen nahezu perfekten Schauplatz ausgesucht. Dass nicht immer alles den gängigen Konventionen entspricht, ist dabei das innovative Momente dieses eigentlich einfach gestrickten, in letzter Konsequenz aber durch und durch genialen Buches. Ganz klare Empfehlung meinerseits!