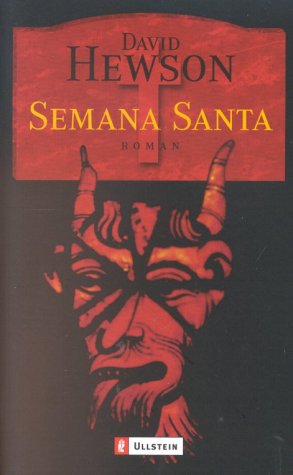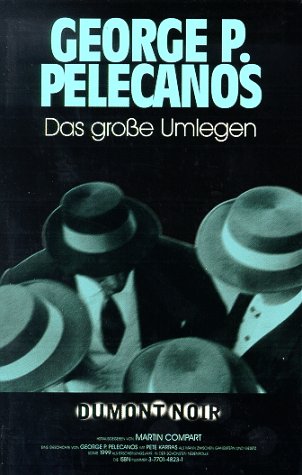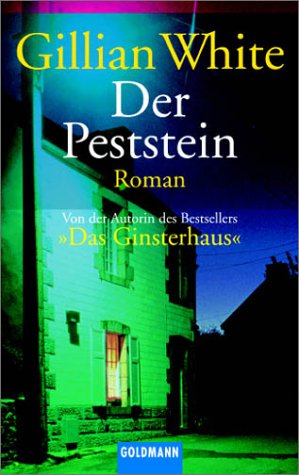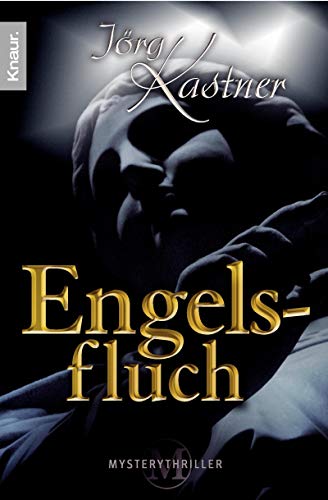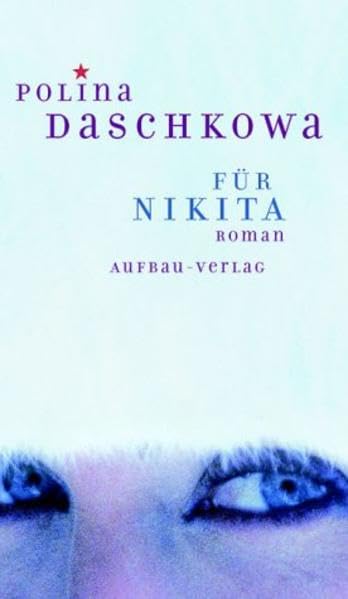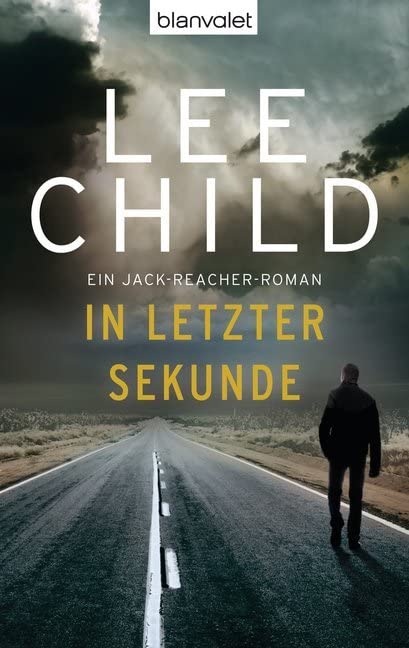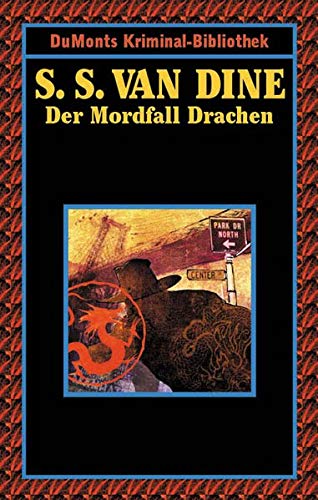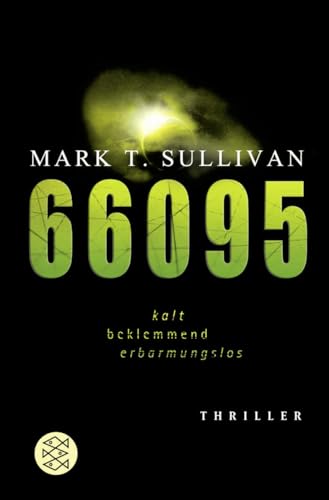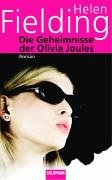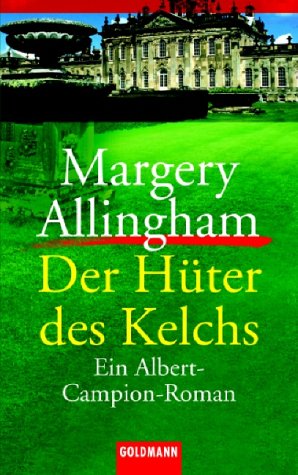In David Hewsons Thriller „Semana Santa“ dreht sich die Handlung um eine mysteriöse Mordserie während der Karwochen-Feierlichkeiten in der spanischen Hafenstadt Cadíz. Verfilmt wurde das Ganze auch schon, allerdings sollen Bücher ja grundsätzlich besser sein – ob das so stimmt, wollen wir nun einmal am Exempel prüfen.
_Hasta la vista, Baby – Zur Story_
Mit „Semana Santa“ bezeichnet man in Spanien die feierlichen Massenumzüge in der gesamten Karwoche vor Ostern, bei dem jede Gemeinde einer Stadt mit ihrer eigenen Madonnenfigur an der Kathedrale vorbeidefiliert und die ihren Abschluss (Gründonnerstag) in einer „Corrida“ findet, dem traditionellen Stierkampf. Wir befinden uns im Cadíz der Jetztzeit, der berühmten südspanischen Hafenstadt, wo eine ganze Woche lang pseudoreligiöses Highlife herrscht, was die örtliche Polizei jedes Jahr aufs Neue vor schier unlösbare Probleme stellt. Im Schutze des quasi unbeherrschbaren Trubels dieser Woche finden seltsame und bestialische Morde statt.
Als Erstes erwischt es ein verschrobenes Bruderpaar, das augenscheinlich neben seiner provokanten künstlerischen Arbeit und ebenso schrägen Lebensart auch Kontakte zur Homosexuellenszene hatte. Man hat die Leichen der beiden schön barock herausgeputzt und nach Art eines alten Bildes von Leál drapiert. Gespickt sind die Leichen der Angel-Brüder mit bebänderten Pfeilen, wie sie auch beim Stierkampf verwendet werden, um den Stier zu triezen. Auch die eigentliche Mordwaffe passt ins Bild: Ein Degen, der für den finalen Tötungsakt in der Arena benutzt wird. Ist der Killer also ein durchgeknallter Torrero?
Zentrale Figur der Geschichte ist Maria Guitterrez, die eigentlich nichts mit Kriminalistik am Hut hat, doch mit ihren 33 Jahren schon einen Universitäts-Professorentitel aufweisen kann. Sie wurde vom Innenministerium nach Cadíz geschickt, um sich die Polizeiarbeit näher anzuschauen und eventuell Optimierungsmöglichkeiten herauszuarbeiten. Eher widerwillig schleppen die Beamten sie zunächst mit an die Tatorte, sie halten sie für einen berichteschreibenden Spitzel und eine Belastung bei den Ermittlungen, doch gelingt es ihr nach und nach, einige wichtige Puzzleteile zusammenzufügen und den „Kollegen“ des eingesetzten, männlichen Ermittlerteams Respekt abzuringen.
Doch auch der Killer ist von ihr sehr angetan, was sie unweigerlich in sein Fadenkreuz und somit in Gefahr bringt. Doch was sind die Motive des – eine rote Büßerkutte tragenden – Kapuzen-Mörders? Religiös verbrämte Rache? Oder einfach nur Spaß daran, zu töten wie ein Torrero und dabei die Polizei durch geschickte Winkelzüge zum Narren zu halten? Der Schlüssel zur Lösung liegt weit in der Vergangenheit, genauer gesagt in den Wirren des frankofaschistischen, spanischen Bürgerkriegs im Jahre 1936 und dem gefürchteten Gefangenenlager „La Soledad“ … Wer in der Gegenwart überleben will, muss die Vergangenheit aufarbeiten und sich auch seinen persönlichen Teufeln stellen.
_Olé! – Meinung_
Klerikal angehauchte Kriminalgeschichten haben Hochkonjunktur. Hewson („Das Blut der Märtyrer“) zu unterstellen, er würde auf der Welle mitschwimmen, zieht in diesem Falle nicht, denn als das Buch 1996 veröffentlicht wurde, war man von dem heutigen Hype, der dieses Genre umweht, noch weit entfernt. Zudem ist der religiöse Touch auch nur vordergründig und dient als Kulisse für die Geschichte, die Wahrheit liegt tiefer verborgen. Bis die Tarnung auffliegt, fabriziert er einige recht unerwartete Wendungen, was den Spannungsbogen generell nicht abflachen lässt.
Lediglich die oft verwendeten Flashbacks in die Vergangenheit sind mir mitunter etwas zu langatmig, selbst wenn sie dazu dienen, das Motiv langsam herauszukristallisieren und am Ende Licht ins Dunkel zu bringen. Das hätte Hewson ein wenig straffen können, doch ist dies nur ein eher schwacher Kritikpunkt, erfüllt diese Vorgehensweise doch den Zweck, die Pro- und Antagonisten besser auszuarbeiten. Die haben es zum Teil auch echt nötig, aufgepeppt zu werden.
Die Charakterzeichnung leidet nämlich ein wenig unter dem Wechselspiel zwischen Rasanz und den eher ruhigen Ermittlungspassagen, sodass die verwendeten Figuren häufig etwas klischeehaft daherkommen. Da wäre die fähige, intelligente aber zunächst geschnittene Provinz-Polizistin, die sich innerhalb der von Männern dominierten Welt der spanischen Polizei erst ihre Sporen und den Respekt ihrer chauvinistischen Macho-Kollegen verdienen muss. Die entsprechen im Endeffekt auch großteils dem typischen Bild: harte Schale, weicher Keks … Verzeihung: Kern. Stilistisch nicht gerade berauschend neu und in etlichen anderen Romanen auch schon so – oder so ähnlich – praktiziert. Kalter Kaffee.
Dass die Protagonistin dann schlussendlich auch in den sexuellen Fokus des Serienkillers (und somit in Lebensgefahr) gerät, konnte man sich schon fast denken – den Ausgang im Groben auch. Interessant, dass gerade (in den von mir oben leicht bekrittelten) Flashbacks und ihren Personen dieses Stereotyp nicht gepflegt wird und literarische Vielschichtigkeit durchblitzt. Ob dieser Gegensatz gar beabsichtigt ist, sei dahingestellt, er ist in jedem Falle ausgesprochen augenfällig.
Wie es sich für einen Vertreter der Serial-Killer-Fraktion geziemt, kommt diesem Part natürlich ein besonderes Augenmerk zu. Detailliert beschreibt Hewson die vermeintlichen Ritualmorde und aufgefundenen Leichen am Tatort. Zeitweise vermeint man den Verwesungsgeruch in der Nase zu haben. Ab und zu darf der Leser auch „live“ dabei sein, wenn der große Unbekannte auf die Jagd geht, was einen Einblick in seine Psyche gewährt, jedoch dankenswerterweise seine Identität zunächst nicht enthüllt.
Erst gegen Ende des Katz-und-Maus-Spiels lichtet sich der Schleier um die Person des Täters und Hewson gibt dann offener etwas mehr über ihn preis. Alles Finte? Viele der Spuren erweisen sich tatsächlich als Sackgassen und Tricksereien seitens des Autors. Selbst wenn man meint, jetzt wäre es gelaufen, fehlen immer noch einige Puzzleteilchen, die das Motiv vollständig erklären. Und dingfest gemacht ist der Schuft damit erst recht noch nicht. Das behält Hewson sich für den fulminanten Showdown vor, wenn aus dem Psychothriller eine hektische Hetzjagd wird. Bis es dazu jedoch kommt, erlebt der Leser eine Menge spanischer Kultur, extremen Katholizismus, Pädophilie und soziologische Ränkeschmiede in blutiger Form.
_Psychoanalyse – Fazit_
Psychothriller mit Serienmördern stammen aus Amerika und spielen auch dort. Ein Trugschluss. Auch in Europa ist es durchaus möglich, einen guten Thriller zu schreiben und ihn auch dort stattfinden zu lassen – dachte sich Hewson und liefert einen atmosphärisch dichten Roman mit leichten Schwächen ab. Trotz seiner versuchten Verschleierungstaktik ist die Handlung oft vorauszusehen bzw. zumindest zu erahnen. Die Idee, das Motiv so weit in der Zeit zurückzuverlegen, ist nicht übel, hat aber streckenweise einige Längen. Langweilig ist das Buch indes nicht, hätte an einigen Punkten aber weniger Belanglosigkeiten gut vertragen können.
Der Plot an sich ist schlüssig, logische Lücken finden sich keine, obwohl es sicher nicht einfach war, die Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart vernünftig und nachvollziehbar miteinander zu verknüpfen. Wären nur die Figuren und deren Handeln nicht so berechenbar und genretypisch ausgefallen, hätt’s durchaus auch für eine bessere Beurteilung meinerseits gelangt. So bleibt ein solider Roman mit ordentlichem Unterhaltungswert. Trotz blutigem Verwirrspiel aber ziemlich leichte Kost für eingefleischte Krimi- und Thrillerfreunde, die den Schinken innerhalb kürzester Zeit durch haben dürften. Lesenswert, aber ohne Chance auf Kultstatus. Übrigens ist das Buch um Klassen besser als die Verfilmung.