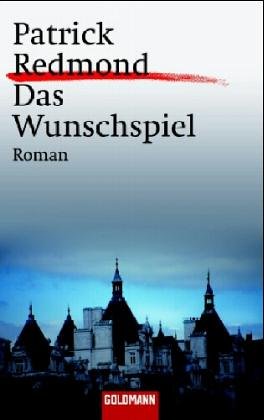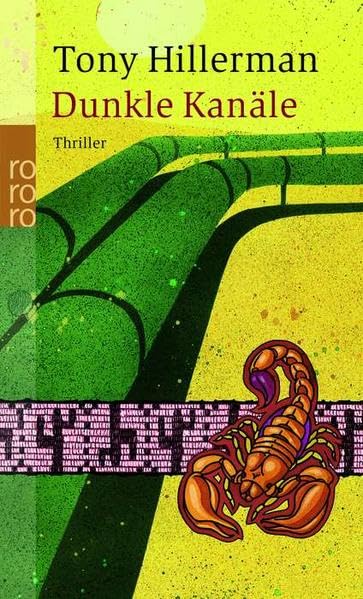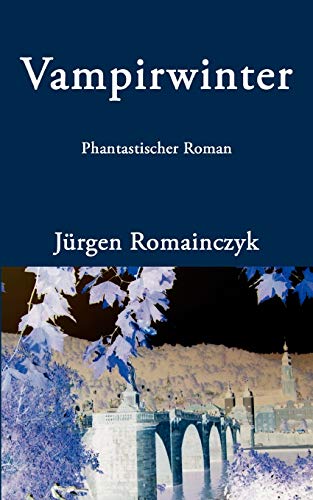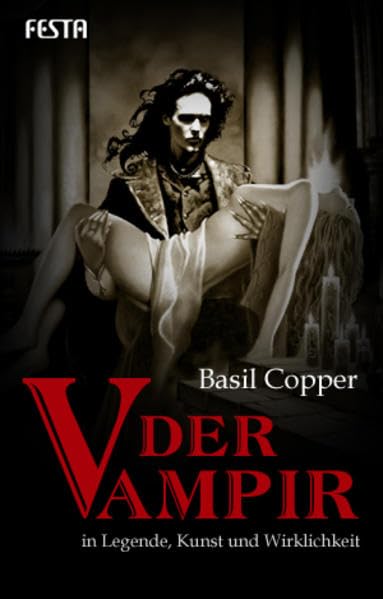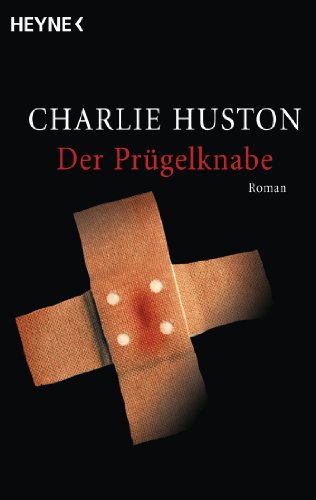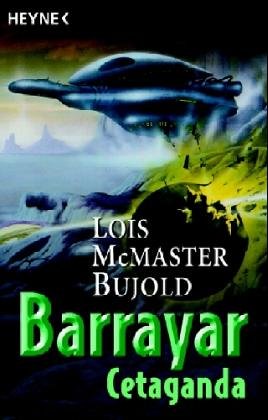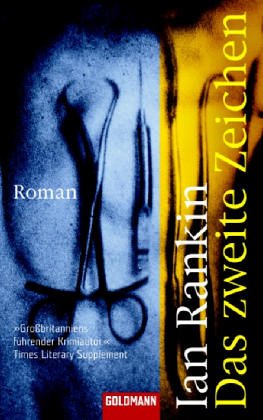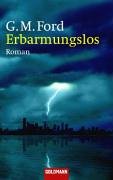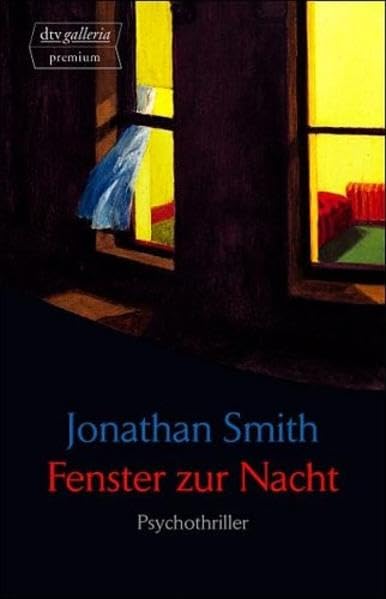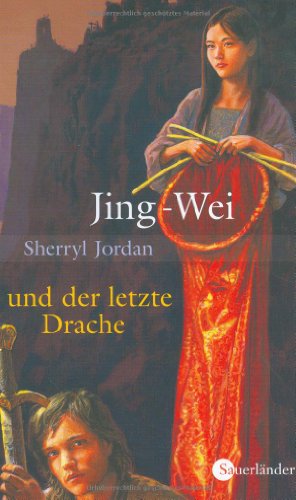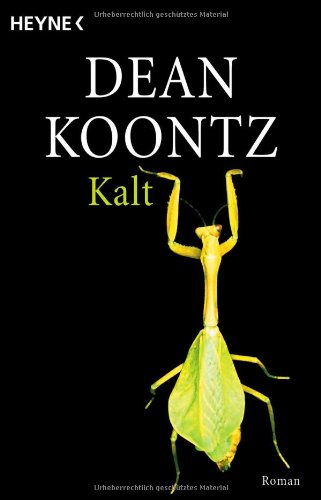Luka ist ein außergewöhnliches Kind. Es trägt auf jeder Fußsohle fünf schwarze Muttermale, das Zeichen dafür, dass er der auserwählte Kaiser ist, der nur alle fünfhundert Jahre vom Himmel steigt. Das erzählt Meister Atami dem kleinen Jungen jeden Tag. Und das ist auch der Grund, warum der Kleine so unendlich viel lernen muss. Manchmal kommt es dem Zwölfjährigen so vor, als müsste ihm jeden Moment die Decke auf den Kopf fallen. Doch Meister Atami lehnt es kategorisch ab, dass Luka ihm in die Stadt folgt und beim Betteln hilft. Irgendwann reißt Luka einfach heimlich aus. Und wird gleich als Erstes auf dem Markt des Diebstahls beschuldigt! Doch er verrät den wirklichen Dieb nicht, und das verschafft ihm die erste Freundschaft eines Gleichaltrigen in seinem Leben. Der Gassenjunge und sein kleiner Bruder geben zusammen mit dem Mönchsschüler ein recht merkwürdiges Trio ab.
Dann kommt der Tag, an dem Luka zum ersten Mal miterlebt, auf welche Art und Weise sein väterlicher Lehrer die Speisereste für ihn und sich selbst erbettelt! Die Grausamkeit der Soldaten schockiert ihn so, dass er sich nicht zurückhalten kann. Sein Eingreifen bringt ihn und seinen Meister in große Schwierigkeiten. Es dauert nicht lange, und die Häscher sind hinter ihnen her. Atami wird gefasst, Luka jedoch kann fliehen. Allerdings nicht für lange!
Lukas Geschichte spielt während der Besetzung Chinas durch die Mongolen, die hier Moro genannt werden. Luka ist der Enkel des letzten Kaisers. Pikanterweise ist sein Vater ausgerechnet Ulanbaat Ghengi, der Anführer der Mongolen, der seinen Großvater abgesetzt hat! Verständlicherweise hat sein Vater überhaupt kein Interesse daran, dass dieses Kind einmal Kaiser wird. Und so ist Atami eifrig bemüht, die Identität seines Schützlings geheim zu halten. Luka macht diese Bemühungen zunichte, als er versucht, seinen Meister gegen die Moro zu beschützen und damit seine Kampfausbildung offenbart. Fortan ist Luka fast ununterbrochen auf der Flucht, nur um letztlich doch Auge in Auge seinem Vater gegenüberzustehen und gegen ihn zu kämpfen.
Lukas Kampfausbildung basiert auf den Lehren des Tao. Ziel jeder Übung sind die eigene Vervollkommnung und das Erreichen des Tao. Grundsätzlich existieren auf diesem Weg keinerlei Grenzen, es sei denn, der Betreffende setzt sie sich selbst. Insofern hat es nicht unbedingt etwas mit Magie zu tun, wenn Luka fliegen kann, oder wenn Großmeister Gulan sich den Unterarm abreißt, um ein Ungeziefer loszuwerden, und ihn danach einfach wieder ansetzt, sondern mit Jin-Gong, einer durch Übung erworbenen inneren Kraft, die mit dem Mondlicht zusammenhängt. Atami verfügt über eine verwandte Macht, die von der Sonne stammt, Yin-Gong. Beide gemeinsam sind fast unüberwindlich und werden von Mönchen des Xi-Ling gelehrt.
Auch Ghengi kann fliegen, welche Kraft ihn dazu allerdings befähigt, wird nicht gesagt. Als Mongole kann er keine Xi-Ling-Ausbildung genossen haben. Dennoch ist es ihm gelungen, seinen verlorenen Arm durch eine Klob-Zange ersetzen und seinen Körper mit grünen Schuppen überziehen zu lassen.
Der Klob ist ein Meeresungeheuer, das seiner Beschreibung nach wie ein monströser Hummer aussieht. Seine Jungen, die offenbar eine Kreuzung aus Hummer und Schlange sind, werden sinnigerweise Klobster genannt. Das Gift des Klob ist tödlich, einziges Gegenmittel ist das Blut des gepanzerten Wesens, das ein Prinz des Königreiches Ozeana ist. Außerdem kommen zwei Snagon vor, Riesenschlangen, die für ihre früheren Verbrechen büßen und danach zu Drachen werden, und ein Goldener, ein großer Frosch, der golden schimmert und ebenfalls für seine Sünden büßt. Hier taucht erneut die Lehre des Tao auf, wonach jeder durch demütiges Erdulden Erlösung erlangen kann. Keines dieser Ungeheuer ist wirklich böse, nicht einmal der Klob, der von Ghengi mutwillig süchtig gemacht wurde, um ihn zu unterwerfen.
Ghengi und seine Moro sind die einzigen wirklichen Bösewichte. Das ist wohl auch der Grund, warum sie Moro und nicht Mongolen genannt werden, denn so auffallend die Parallelen sein mögen, entbehrt die Darstellung der Moro doch jeglicher Objektivität. Die Moro sind gleichgültig, grausam und schmarotzend, schlicht: genau so, wie die Chinesen die mongolischen Besatzer vielleicht empfunden haben mögen. Die positiven Seiten der Khane und ihrer Herrschaft, die es zweifellos auch gab, sind vollständig ausgeblendet, Ghengi als Oberhaupt der Moro zu einer Monstrosität verzerrt.
Gleichzeitig werden die Moro durch das Plakat, das die Brautfütterung ankündigt, komplett ins Lächerliche gezogen. Kein Gewaltherrscher würde einen solchen Text verfassen! Aber auch die Chinesen kriegen ihr Fett weg. Die außerordentlich abartigen Heilungsmethoden, die hier angewandt werden, können eigentlich nur als Anspielung verstanden werden. Viele Chinesen glauben immer noch, Rhinozeroshörner wären ein Potenzmittel. Und die übertriebene Anzahl von Muttermalen ausgerechnet an den Fußsohlen kann irgendwie auch nicht wirklich ernst gemeint sein.
Solche Anwandlungen von Humor sind allerdings ziemlich selten, es sei denn, ich hätte einige überlesen, was mich nicht wundern würde, denn vieles in diesem Buch war so exotisch und ungewöhnlich, dass ich manchmal Mühe hatte, mich wirklich hineinzudenken. Da Chen macht sich auch nicht die Mühe, viele Erklärungen abzugeben. Ein Chinese braucht sie sicherlich auch nicht, ich dagegen fragte mich gelegentlich schon, wie manche Dinge zusammenhingen oder zustande kamen. Das gilt zum Beispiel für die Skorpione unter den Goldbarren, die Schildkrötenstraße oder diesen seltsamen Wasserweg, der vom Xi-Ling-Kloster direkt in die kaiserliche Kloake führt.
Gelegentlich stolperte ich auch über simple Logikfehler. Lukas Freund Mahong steigt heimlich ins Kloster ein, um mit Großmeister Gulan zu sprechen, denn so hat Atami es ihm aufgetragen. Ein anderer würde ihm nicht glauben, weil er ein Straßenbengel und ein Dieb ist. Mahong erzählt aber auch, sie hätten von Gulans und Lukas Flucht aus dem Gefängnis erfahren. Wenn also Mahong weiß, dass beide entkommen sind und dass Gulan im Kloster ist, warum weiß er dann nicht, dass auch Luka da ist?
Und wie kommt es, dass Luka trotz seiner Macht des Jin-Gong an einer Mauer scheiterte, die sein Widersacher Yi-Shen ohne diese Macht durchbrechen konnte? Wie kommt es, dass Mahongs kleiner Bruder auf der Zinne der Gefängnismauer sitzen und auf das Gegengift für Atami warten kann? Sind die Wachen, die dort oben patroullieren, denn blind? Abgesehen davon hätte ich als Vorsteher von Lukas Gefängnis mit der Hinrichtung eines so brisanten Gefangenen keine sechs Monate gewartet, ganz gleich, wie überlastet die Hinrichtungskommandos auch sein mögen!
Da Chen hat hier eine ganz eigene Mischung von Abenteuerroman, Fantasy und Cinologie abgeliefert, wobei die beiden Letzteren für mich nicht immer klar zu trennen waren. In jedem Fall ist sie extravagant und ziemlich bunt und auch nicht uninteressant. Ich muss aber gestehen, dass mir die Meister-Li-Romane von Barry Hughart besser gefallen haben. Ich fand sie weniger verwirrend, leichter zu lesen und witziger. Das mag daran liegen, dass Barry Hughart kein Chinese ist.
Für Leute, die sich für China interessieren und vielleicht sogar mehr als oberflächliche Kenntnisse von chinesischer Philosophie und Mythologie besitzen, dürfte der Roman aber möglicherweise weniger verwirrend sein als für mich. Ansonsten könnte es ratsam sein, sich beim Lesen Zeit zu lassen. Trotz der einfachen Sprache ist das Buch nichts für Schnellleser und Überflieger, es sei denn, derjenige fühlt sich im Kulturraum des Hintergrundes schon wie Zuhause. Lesenswert ist es durchaus.
Das Lektorat war in Ordnung. Und auch das Cover hat mir gut gefallen. Eine praktische Idee waren die Drachenklauen und Tigerpranken, die die Kapitelanfänge zieren. Man sieht sie auch von außen, sodass man auch dann seine Seite wiederfindet, wenn das Lesezeichen das Weite gesucht hat. Vorausgesetzt natürlich, man hat am Ende eines Kapitels abgesetzt.
Da Chen stammt aus der chinesischen Provinz, wanderte aber im Alter von 23 Jahren nach Amerika aus. Er lebt mit seiner Familie in New York und arbeitet als Kalligraph und Schriftsteller. Außer „Meister Atami und der kleine Mönch“ erschien von ihm bisher nur ein weiteres Werk unter dem Titel „Die Farben des Berges“, in dem er seine Erinnerungen an China niedergeschrieben hat.