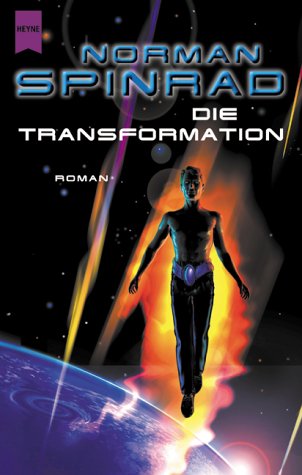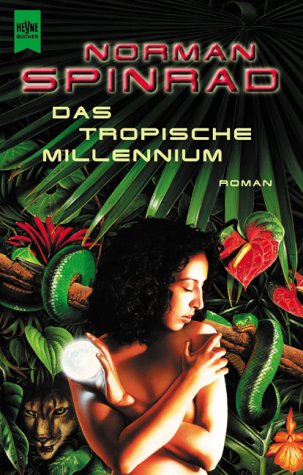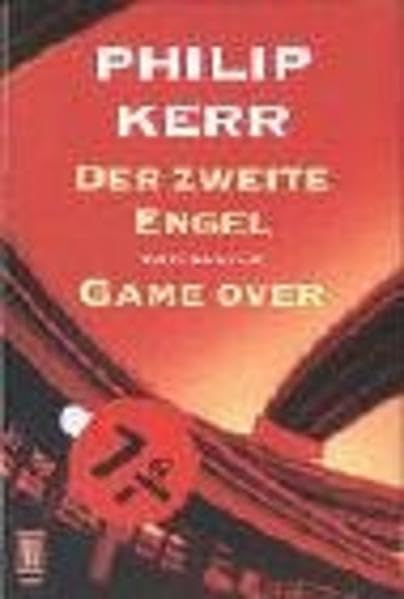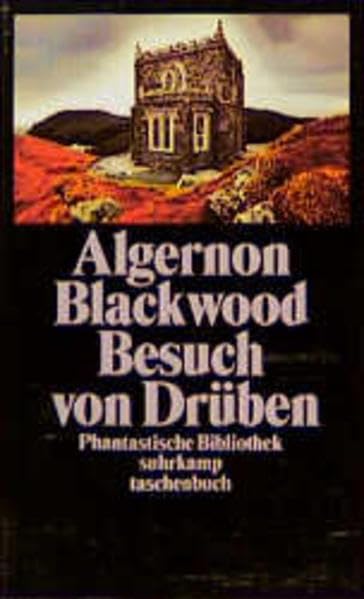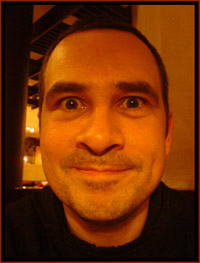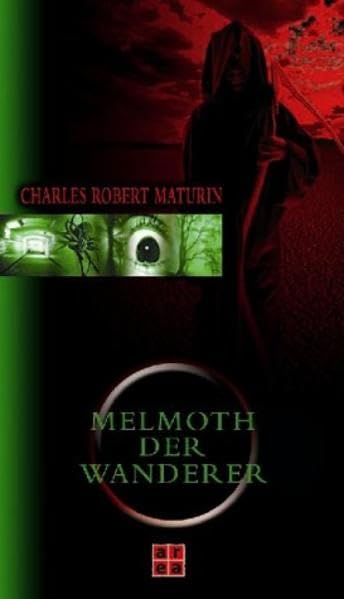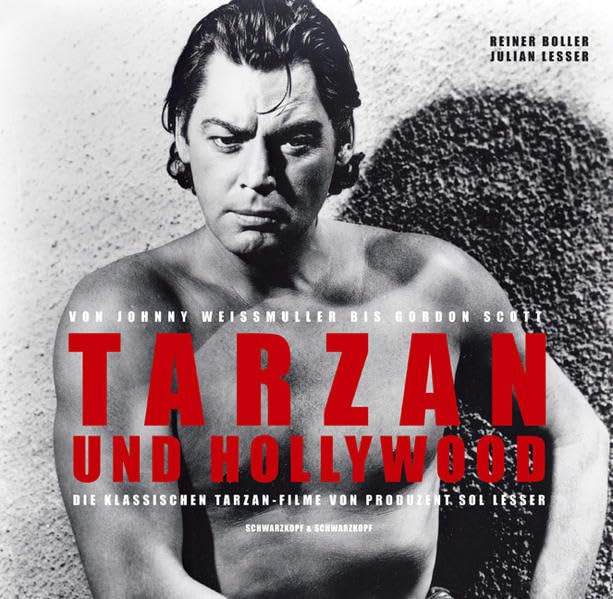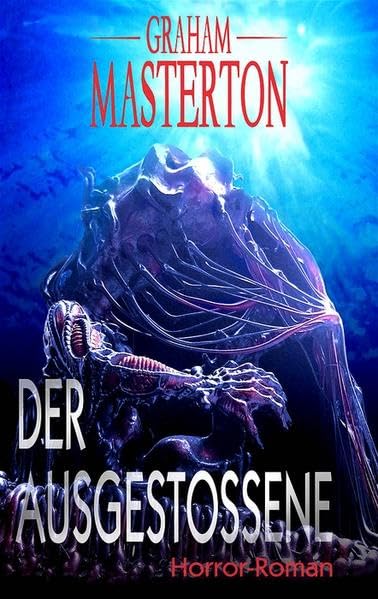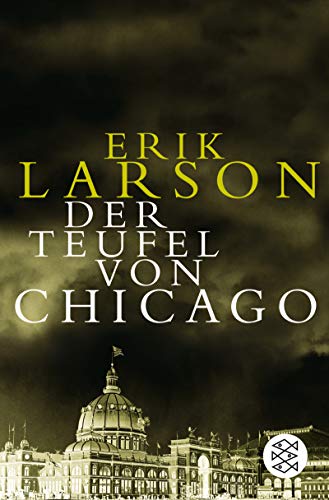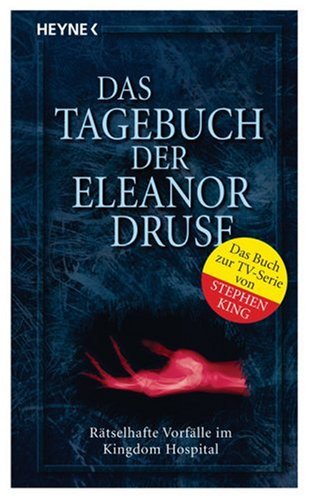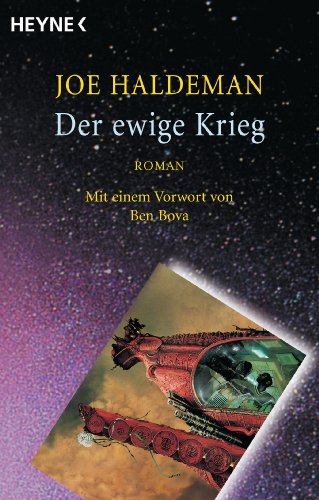Dark Fantasy mit episch breitem Hintergrund stellt eine Ausnahme im Fantasybereich dar, insbesondere in Deutschland. Der Autor Marc-Alastor E.-E. hat mit „Kriecher“ und „Adulator“ im |BLITZ|-Verlag eine Serie namens |GEISTERDRACHE| ins Leben gerufen, die in der Welt |Praegaia| spielt, zu der Marc-Alastor E.-E. bereits seit zwanzig Jahren Kurzgeschichten, Liedtexte und Gedichte schreibt. Seine Romane stellen eine Mischung aus klassischer High-Fantasy und maliziösem Horror dar, in der Einzelschicksale düsterer Helden in einer faszinierenden Urwelt im Vordergrund stehen.
_Michael Birke:_
Marc, du bist nicht nur Autor, sondern auch Mitglied einer geheimen, okkulten Loge, Zeichner, Dichter und warst früher sogar einmal Musiker. Ein vielseitiger und bemerkenswerter Lebenslauf. Könntest du dich selbst ein wenig näher vorstellen? Ist Marc überhaupt die richtige Anrede – dein Künstlername „Marc-Alastor E.-E.“ verleitet geradezu zu dem kürzeren „Marc-Alastor“.
_Marc-Alastor E.-E.:_
Das Pseudonym wurde mir schon früh von Seiten der okkulten Loge als eine Art Ehrentitel verliehen und lautet vollständig Marc-Alastor Elawar-Eosphoros. Wie Du ja schon selbst bemerkt hast, macht sich ein solch langer Name schwierig bei Veröffentlichungen und er klingt für viele auch arg überspannt. Andererseits hat dieser Name viel mit meinem Glauben zu tun und es wäre mir schwer gefallen, ihn nicht zu benutzen, daher auch die Abkürzung der beiden letzten Namen. Gebräuchlich ist im Umgang daher Marc oder Marc-Alastor.
Zu meiner Person: Ich blicke auf 33 bewegte, dunkle Lebensjahre zurück, bin gelernter Lithograph/Multimedia-Designer und lebe sehr zurückgezogen nahe des Teutoburger Walds.
_Michael Birke:_
Welche Quellen bzw. Autoren beeinflussten dein Werk am meisten? Was inspirierte dich zu deinem Antihelden „Kriecher“?
_Marc-Alastor E.-E.:_
Als ich vor über 20 Jahren zu schreiben begann, bewogen mich vor allen Dingen zwei Anliegen zum Schreiben: Ich wollte die Qualität der vorherrschenden Fantasy- und Horrorliteratur heben (was zweifelsohne als durchaus kühner Anspruch angesehen werden kann) und ich trachtete, okkulte Erlebnisse zu verarbeiten, die mir auf der Seele lasteten. Hinzu kam, dass ich durch meine Studien in den umfangreichen, okkulten Bibliotheken der |Ushanas Minne Lodge| viele Einblicke gewann, die mir viele Anregungen für Storys gaben, unter anderem auch für mein Lebenswerk, ein Okkultepos.
Von Autoren halte ich meine Werke eigentlich weniger beeinflusst, da ich während meiner Entwicklung nicht bewusst verglichen habe und konzentriert danach trachtete, das besser zu machen, was mir an den modernen „Kollegen“ missfiel. Aber natürlich schätze ich die Arbeit einiger Autoren, doch dies sind in erster Linie klassische, allen voran Hermann Hesse, aber auch Cervantes, Dickens oder Cline und Hodgson.
Was „Kriecher“ angeht – er war einfach da, als es um die Entdeckung eines Antihelden ging, für die ich ohnehin eine Vorliebe habe. Er hatte also keinen Paten und kein Vorbild, er wurde wie die meisten meiner Charakteren aus meinem Anspruch heraus einfach geboren.
Die Einflüsse der Serie |GEISTERDRACHE| wiederum sind recht unterschiedlich. Am Anfang stand ganz klar der lateinische Versband – das |Liber Incendium Veritas|. Es diente jedoch nur zur Entwicklung der Hauptprotagonisten, zumal sich seinerzeit schon abzeichnete, dass es im Ganzen wenig authentisch war. Inhaltlich sind die Einflüsse zum Teil in der klassischen Heroic und High Fantasy und im modernen Horror zu finden, stilistisch – wenn überhaupt – bei den Klassikern.
_Michael Birke:_
Was bietet deine Fantasywelt, was unterscheidet sie von gängiger deutscher (Das Schwarze Auge: Aventurien) und amerikanischer (AD&D-Multiversum z.B.) Fantasy?
_Marc-Alastor E.-E.:_
Also viel deutsche, epische Fantasy gibt es nicht gerade, und was es gibt, hat mich, wenn ich es denn gelesen habe, nicht gerade überzeugt. Es sind sowohl die abgegriffenen Plots als auch der schluderige Sprachstil, die mich dabei häufig schnell entmutigen. Auf dem amerikanischen Sektor gibt es zwar sehr viel, jedoch vermisse ich auch dort zuweilen den nötigen |suspense|, und die „guten“, geradlinigen Übersetzungen zeigen dann noch, wie es um den Sprachstil bestellt ist. Nur wenige amerikanische Autoren bedienen sich eines wirklich wortgewandten Sprachschatzes. Die Plotlines der Amerikaner sind zumeist sehr episch angelegt, einige folgen sogar Tolkien, indem sie Historien und Stammbäume einbringen, und am Ende leiden die Story selbst und die Spannung, die an erster Stelle stehen sollte. Also mir passiert es nur allzu oft, dass ich die Bücher nach dem ersten Drittel aus der Hand lege und nicht wieder ins Auge fasse. Ich kenne unzählige Leser, die lieber Horror als Fantasy lesen, was aber zumeist in der Erzählweise begründet liegt und weniger im Inhalt. Und wenn wir am Ende über den Erfolg einzelner Serien sprechen würden, bewegten wir uns unweigerlich in die ewige und auch leidige Diskussion des Maßstabs, den niemand genau festzulegen vermag. Allein an Verkaufszahlen zu messen, sagt nämlich nichts über den Erfolg einer Serie aus, da es ganz unterschiedliche Märkte mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen gibt.
_Michael Birke:_
Und was genau machst du in deinen Romanen anders?
_Marc-Alastor E.-E.:_
Was nun meine Fantasywelt und den Epos angeht, so versuche ich natürlich seine Stärken dort aufzubauen, wo ich die Schwächen der anderen sehe. Das bedeutet, ich lege sehr viel Wert auf Spannung und ein hohes sprachliches Niveau. Inhaltlich halte ich mich dabei schon an Bekanntes, denn ich mag ja all die Geschichten um Zwerge, Elfen und Drachen, füge dem Ganzen jedoch wissenschaftliche Informationen über Urwelten und Untergangstheorien hinzu, über frühzeitliche Hochzivilisationen und belegte Mythen, und versuche abschließend durch andere Gewichtungen bei der Erzählweise meinen Maßstab zu finden. Ich betone dabei, dass ich nicht behaupte, das einzig wahre Rezept gefunden zu haben, zumal es ein solches auch nicht gibt. Es gibt keinen Stein der Weisen für Fantasyautoren.
Aber es gibt den Anspruch, seinem eigenen hohen Qualitätsbild gerecht zu werden, wenn es auch, und das muß ich an dieser Stelle betonen, zu Konflikten führt. Natürlich würden die Verleger viel lieber leichtere, zugänglichere Kost liefern und ich habe in meiner Vergangenheit oft erlebt, dass gerade von dieser Seite immer wieder der Wunsch geäußert wurde, dass ich es etwas leichter angehen lassen möge. Doch den eigenen Anspruch zu verbiegen, geht nur bedingt, und daher versuche ich mich langsam auf das hinzubewegen, was mir als Endqualität im Kopf herumspukt. BLITZ lässt mir dabei freie Hand, unterstützt mich dabei, und es freut mich sehr, dass man dort erkennt, wohin meine „Reise“ gehen soll. Es gehört ganz eindeutig Mut dazu, auf einem immer schwieriger werdenden Markt ein solches Epos zu präsentieren, aber ich weiß dennoch, dass es sich für alle Leser lohnen wird.
_Michael Birke:_
Das |Liber Incendium Veritas| – inwiefern hat es dich inspiriert? Welche Ideen hast du – außer denen zu Medoreigtulb und M’Zaarox – daraus gewonnen?
_Marc-Alastor E.-E.:_
Außer den Grundzügen der Göttin und des Drachen gibt es keine weiteren Übernahmen, denn erstens war bis noch vor kurzem nur ein Teil davon übersetzt und somit mir überhaupt bekannt geworden, und zweitens erschien mir darüber hinaus nichts auch nur annähernd interessant genug, um daraus neue Ideen schöpfen zu können. Das mag sich möglicherweise noch ändern, wenn ich mich einmal an die Überarbeitung der Übersetzung mache und mich somit auch inhaltlicher mehr damit auseinandersetzen werde, doch im Augenblick habe ich gar keine Zeit, um das ins Auge fassen zu können, und es ist auch nicht von allzu großer Wichtigkeit für den Zyklus. Das |Liber Incendium Veritas| besitzt keinen essenziellen Charakter.
_Michael Birke:_
Die Hauptcharaktere Medoreigtulb und M’Zaarox sind, wie erwähnt, vom |Liber Incendium Veritas| inspiriert worden. Von einem Kampf zwischen den beiden ist nach „Kriecher“ und „Adulator“ aber noch nicht viel zu bemerken – was haben wir von M’Zaarox, seinen Dienern und Helfern in Zukunft zu erwarten? Welche Ideale verkörpern die beiden Gottheiten?
_Marc-Alastor E.-E.:_
Der Kampf zwischen Medoreigtulb und M’Zaarox erstreckt sich über viele Epochen, unterschiedliche Zeit- und Existenzebenen und läuft zumeist im Hintergrund ab oder wird nur fragmentarisch wiedergegeben. Meine Geschichten konzentrieren sich immer auf die Geschicke einzelner, zunächst einmal unbedeutender Charaktere, die jedoch auf irgendeine Weise mit dem Götterdisput in Berührung kommen, was ihnen die Bedeutsamkeit gibt. Das kann nur am Rande geschehen oder durchaus in die Tiefe gehen. Der Leser bekommt auf diese Weise erst langsam ein klareres Bild über die göttlichen Geschehnisse. Außerdem ist Medoreigtulb eher ein aktives und offensives Wesen, während M’Zaarox – ganz Geisterwesen und seiner Rolle als Beschützer entsprechend – eher passiv und defensiv auftritt, sein Wirken und das seines Gefolges ist zumeist kaum wahrnehmbar und erst wenn alles vorüber ist, erkennt man, dass er eine Schlacht für sich entscheiden konnte… Seine Zeit ist aber auch noch nicht gekommen, doch das wird sie…
_Michael Birke:_
Der |Bastei|-Verlag veröffentlichte 1988/89 deine Kurzgeschichten „Eine Spur Mitleid“ und „Schwungrad des Bösen“. Haben diese einen Zusammenhang mit dem von dir selbst als dein Lebenswerk bezeichneten Zyklus „Die Offenbarung eines Dämons“? Um was handelt es sich überhaupt dabei, welchen Platz hat „Kriecher“ in diesem Werk?
_Marc-Alastor E.-E.:_
Also wir müssen hier zwischen den beiden Epen unterscheiden. „Die Offenbarung eines Dämons“ ist ein okkultes Monumentalwerk, das bislang aufgrund seiner Extreme und seines Umfangs keine annehmbare Veröffentlichungsform gefunden hat. Es ist ein komplexer Romanepos, der aus der Sicht eines Dämons geschrieben ist und ausschließlich fundiertes, okkultes Material nutzt.
„Kriecher“ ist Bestandteil des Fantasy-Epos |GEISTERDRACHE|, das jetzt beim |BLITZ|-Verlag erscheint. Beide haben nichts miteinander zu tun. Und die beim |Bastei|-Verlag veröffentlichten Kurzgeschichten gehörten seinerzeit zum |GEISTERDRACHE|-Epos, wurden aber von mir damals auf die Gegenwart umgeschrieben.
_Michael Birke:_
Die am Rande eines Kataklysmus stehende Welt Praegaia ist der Schauplatz deiner Geschichten. Du unterhältst zu deinem Zyklus |GEISTERDRACHE| einige Webseiten, wie www.geisterdrache.de, www.praegaia.de, www.valusia.de. Leser deiner Romane können sich über ein Schlüsselwort einloggen, um im |GEISTERDRACHE|-Archiv zu stöbern, welches Erzählungen, Gedichte, Liedertexte und später die Übersetzung des |Liber Incendium Veritas| enthalten soll. Was brachte dich auf die Idee, diese Inhalte kostenlos im Netz anzubieten?
_Marc-Alastor E.-E.:_
Kurz nachdem sich die von mir mitbegründete Dark-Metal-Band |SPECTRE DRAGON| von mir getrennt hatte, eröffneten eine Bekannte und ich das Spectre-Dragon-Archiv im Netz. Hier sollten alle Kurzgeschichten, Liedertexte und Gedichte um den Zyklus veröffentlicht werden, damit sie nach meiner musikalischen Laufbahn nicht einfach verloren waren.
Das weckte das Interesse des |Schattenwelt|-Verlags und daraus resultierte die erste Auflage von „Kriecher“. Seitdem arbeiten wir an unterschiedlichen Seiten zum Ausbau des Kosmos, der ja nun – nachdem es Schattenwelt nicht mehr gibt – bei |BLITZ| unter dem Label |GEISTERDRACHE| in Serie gegangen ist. Geisterdrache.de ist, wenn man so will, das Spectre-Dragon-Archiv, das allerdings im Augenblick noch in einer Umbauphase steckt, denn wir haben die Inhalte des Archivs hinter ein Passwortportal stellen müssen, da es zu immer mehr Urheberrechtsverstößen gekommen war und es einfach unproduktiv ist, ständig seine Rechte einklagen zu müssen. Wir wollen aber vor dem Portal nicht nur die Bücher präsentieren, an denen gearbeitet wird und die schon veröffentlicht sind, sondern es soll wieder weitere Inhalte geben. So zum Beispiel Hintergrundberichte, Leseproben und Ähnliches. Einiges davon wird noch in diesem, unserem 20. Jubiläumsjahr umgesetzt werden.
_Michael Birke:_
Was unterscheidet diese Webseiten von einander, was werden Praegaia.de und Valusia.de bieten, was nicht bereits in diesem Archiv ist?
_Marc-Alastor E.-E.:_
Auf Praegaia.de wird der Kosmos des Epos präsentiert, Flora, Fauna, Götter, Kalender, Kartenmaterial, Stadtbeschreibungen, halt alles, was dazu gehört. Natürlich ist auch diese Seite noch im Aufbau und wird es wohl auch immer bleiben, denn es gibt unzählige Inhalte, die dort erscheinen werden.
Valusia.de gehört eigentlich nicht direkt dazu. Diese Seite sollte eigentlich meinem neuen Musikprojekt gewidmet sein, doch leider wurde daraus bislang nichts. Vor einem Jahr habe ich noch mit einem talentierten Musiker an den ersten Songs gearbeitet und alles war sehr viel versprechend, doch war er durch private Probleme dann gezwungen, das Musikbiz an den Nagel zu hängen. Seitdem hat sich nichts mehr getan und ich habe auch noch keine anderen musikalischen Möglichkeiten gefunden, was ich natürlich bedauere.
_Michael Birke:_
Du arbeitest bei der Umschlaggestaltung mit dem |Atelier Bonzai| zusammen, die Innenillustrationen des |De Joco Suae Moechae|-Zyklus sind von dem Künstler Aran. Wie kam die sichtbar positiv bemerkbare und scheinbar enge Bindung und Zusammenarbeit zwischen dir und den Künstlern zustande?
_Marc-Alastor E.-E.:_
Aran, Musiker bei der Black-Metal-Ikone |LUNAR AURORA|, kenne ich aus der Zeit, als ich für die Band die CD-Booklets layoutet habe. Daher war mir auch bekannt, dass er sehr gut zeichnen und malen konnte. Ich fragte ihn seinerzeit, ob er Lust hätte, „Kriecher“ zu illustrieren. Hatte er, und wie zu erwarten war, zeigten die Ergebnisse genau das, was mir vorschwebte. Dunkle Zeichnungen, die genau das Flair wiedergaben, welches ich in den Büchern beschreibe. Er hat es phantastisch verstanden, die Inhalte einzufangen und ich freue mich sehr, dass er auch für den dritten Teil wieder die Feder zücken wird.
_Michael Birke:_
Ist Aran ein Mitglied von |Atelier Bonzai|?
_Marc-Alastor E.-E.:_
Nein, Aran ist freischaffend und für mich ein Gefährte, der wie der Rest von |LUNAR AURORA| einfach ein ähnliches Gedankengut besitzt. Man braucht sich nicht sehr viel auszutauschen, weil sich die Ansichten in vielen Punkten gleichen, und so ist auch die künstlerische Zusammenarbeit einfach gewesen. Das Atelier wiederum ist im Prinzip eine Kooperative von Leuten, die sich um |PRAEGAIA| und |GEISTERDRACHE| verdient machen. Und leider im Augenblick unterbesetzt.
_Michael Birke:_
Der dritte Band um Kriecher, „Tetelestai!“, wird auf deiner Webseite mit einem ungewöhnlichen Appetizer als ein „Karmadrama in drei Aufzügen“ angepriesen. Was wird sich verglichen mit „Kriecher“ und „Adulator“ ändern und was ist ein „Karmadrama“ überhaupt?
_Marc-Alastor E.-E.:_
„Tetelestai!“ ist eine eigenartige Mischung aus Bühnenstück und Roman und vereinigt auch die daraus resultierenden Textkonventionen auf sich. Und da es dabei um das endgültige Schicksal Kriechers geht, nannte ich es ein Karmadrama. Während „Kriecher“ ja aus sechs beziehungsweise fünf Nachtschattennovellen zusammengesetzt war und durch die Perspektive eines Erzählers unnahbar und nüchtern erzählt wurde, wird in „Adulator“ – dem Schauerspiel – auf die Ich-Perspektive zurückgegriffen.
Erst am Ende wird klar, dass der Erzähler im Prinzip ein Teil von Kriechers noch menschlicher Seele gewesen ist, der sich absonderte und sein eigenes Wesen von außen betrachtete. Im dritten Teil nun wird die Erzählweise zwischen Erzähler und Kriechers Seelenpart wechseln. Grundidee war dabei, den dunklen Mörder aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.
Als objektiver Erzähler erscheint Kriecher dunkel, morbide und bösartig (Kriecher), als Bestandteil seiner Selbst (Adulator) erscheint er neutraler, besonnener und erreichbarer, fast schon milde, und im dritten Teil wird sich der Leser entscheiden müssen, denn er erfährt eben von den ganzen Wahrheiten und Lügen, die hinter allem abgelaufen sind.
_Michael Birke:_
Wird der Wechsel der Erzählperspektive zu einem Markenzeichen deiner Zyklen werden?
_Marc-Alastor E.-E.:_
Das kann ich jetzt noch nicht sagen, sicher ist jedoch, dass ich immer für außergewöhnliche Textformate sorgen möchte. Dabei werde ich aber letzten Endes immer zu Gunsten des Textes entscheiden, und wenn jener denn etwas Konventionelles erfordert, dann werde ich mich auch darauf einlassen.
_Michael Birke:_
Kriecher erlebt im Verlauf des Zyklus eine Metamorphose – kannst du dazu etwas mehr verraten? Wird Kriecher in zukünftigen Zyklen eine Rolle spielen?
_Marc-Alastor E.-E.:_
Die augenscheinliche Metamorphose hat mit besagten Sichtweisen zu tun und soll dem Leser im Endeffekt zeigen, dass viele Zustände abhängig sind von der Art und Weise, wie sie für den Einzelnen zu erkennen sind. Wenn wir in Adulator sehen, wie milde der Seelenteil Kriechers quasi über sich selbst richtet und wie neutral tatsächlich die Fragen, die er dabei aufwirft, beantwortet werden müssten, erscheint mit einem Male alles so verkehrt. Es mildert nicht die Vergehen, offenbart aber mit einem Male Motive, die nicht einmal ihm selbst gehörten, sondern denen er nur gefolgt ist.
Ob Kriecher in zukünftigen Zyklen eine Rolle spielen wird, kann ich an dieser Stelle noch nicht verraten, denn es würde das Ende von „Tetelestai!“ vorwegnehmen. Ich kann aber sagen: Durch Kriechers Verbindung zur Göttin ist zumindest bei ihm alles möglich. Zu jeder Zeit.
_Michael Birke:_
Zu Caracalla, dem Prinz der Pestilenz: Er ist offensichtlich der nächste Antiheld nach Kriecher. Ein Epileptiker und Söldner, der mit zahlreichen Seuchen und Krankheiten geschlagen ist, aber nicht stirbt. Ist Caracalla eine Art Anti-Caesar, kannst du schon einige interessante Details über den kommenden Zyklus |DE MORBIS SANGUINIS| preisgeben?
_Marc-Alastor E.-E.:_
Caracalla entstammt ja einigen Kurzgeschichten, in denen zum Teil sowohl seine Vorgeschichte als auch seine Entwicklung dargestellt wurde, zudem hatte er einen kurzen Gastauftritt in „Adulator“.
Aber nein, Caracalla ist kein Anti-Caesar, er ist ein Verfluchter, dadurch ein psychisch angeschlagener Charakter und, wenn man so will, ein Halbgott der Krankheit, der aus diesem Fluch, die Krankheiten zu übertragen, ein grausames Geschäft macht. Er ist eine schillernde Persönlichkeit und in seinen Geschichten wird das Thema philosophisch aufgearbeitet, das uns allen am ehesten das Fürchten lehrt – Krankheit, Schmerz und Siechtum. Seine Vorgeschichte, wie er zum Verfluchten wurde, kann man online im Archiv oder im Winter in der Anthologie „Die Chroniken – Widerparte & Gefolge“ lesen. Sie heißt: „Die letzte Zisterne des Königs Awarkadnondur“.
Sein Zyklus wird aus zwei voneinander unabhängigen Romanen bestehen, die wichtige Bestandteile seiner Entwicklung wiedergeben; so den Versuch, seinen Fluch zu brechen, indem er die Urheberin zu finden trachtet. Dabei spielt auch ein anderer bekannter Charakter eine tragende Rolle – der Drache Nodranthatax. Und schließlich wird es um Caracallas ureigenen Aufstieg im weltlichen Gefüge gehen.
_Michael Birke:_
|Praegaia| ist eine große Welt, eine Weltkarte existiert bereits auf deiner Webseite. Führst du Buch über die Handlungsorte, zeichnest du sie vielleicht auf einer Karte ein, wie behältst du den Überblick? Werden künftige Bücher vielleicht Landkarten der Welt |Praegaia| enthalten?
_Marc-Alastor E.-E.:_
In den Chroniken, die im Winter erscheinen werden, sollen Landkartenausschnitte jeder Erzählung vorangehen. Sie entstammen dem Kartenmaterial, das zum Teil auf Praegaia.de bereits veröffentlicht ist und in den nächsten Monaten noch veröffentlicht werden wird. Heute führe ich natürlich akribisch Buch über die vielen Handlungsstränge und die damit verbundenen Bewegungen der unterschiedlichen Charaktere, die sich ja auch stets weiter entwickeln und bewegen.
Leider war ich nicht immer so umsichtig, und im ersten Jahrzehnt wurde kein Buch geführt, so dass ich heute versuche nachzuvollziehen, wo die Bewegungen stattgefunden haben. Und wir arbeiten zudem für alle Gegenden in der Welt Karten und Beschreibungen aus, aber da wartet noch viel Arbeit auf uns und es wird uns noch viele Jahre dauern, bis wir die meisten Bereiche abgedeckt haben.
_Michael Birke:_
Werden wir von Marc-Alastor in nächster Zeit – oder jemals – mit einem Helden oder einer wichtigen Figur rechnen können, die eher dem Typus „strahlender Held“ entspricht?
_Marc-Alastor E.-E.:_
Das käme darauf an, wie man den definieren würde. Aus dem Bauch heraus würde ich „NEIN!“ sagen, denn ich finde strahlende Helden langweilig und eindimensional. Würde ich einen solchen entwickeln, wäre er bei mir derart überzogen, dass er schon wieder eher eine Verspottung seiner Selbst wäre.
_Michael Birke:_
Der Hintergrund zu |GEISTERDRACHE| geht, wie man auf deiner Webseite nachlesen kann, von einem zyklischen Weltbild aus, also von Untergang und neuer Schöpfung. Praegaia ist eine junge Welt, voller Barbarei und Gefahr, am Rande eines Kataklysmus – und Medoreigtulb trachtet danach, ihr den letzten Schubser zu geben. Planst du tatsächlich den Untergang deiner Welt oder werden wir noch lange Geschichten aus dem vertrauten |Praegaia| lesen dürfen? Oder wird es sich drastisch verändern?
_Marc-Alastor E.-E.:_
|Praegaia| wird sich drastisch verändern, jedoch ist dieser vernichtende Impuls der Göttin eher von schleichendem Charakter, der absolute Untergang steht noch aus. Aus irgendeinem Grund – den ich natürlich noch nicht vorwegnehmen möchte – scheint sie mit einigen Völkern zu spielen, sie gegeneinander aufzuhetzen, während sie andere gleich samt ihrer Kultur vernichtet. Ähnlich verfährt sie mit der Welt und ihrer Landschaft an sich. Es mutet an, als unterziehe sie alles und jeden erst eingehender Studien und Belastungsproben.
|Praegaia| selbst ist wie das uressenzielle Leben; quasi die Urmasse – |materia prima| oder wie bei den Alchemisten |massa confusa| benamt -, die sich zu formen beginnt. Die Schöpfungen und Zerstörungen wirken wie ein Spiel und die Welt scheint nur ein Ergebnis einer Kette von Zufällen und eines Zusatzes von Regeln. Mit etwas besserer Kenntnis über |Praegaia| und einige ihrer Geschichten wird man aber zu erkennen imstande sein, dass meine Welt im Grunde wissenschaftlichen Arbeiten über das deterministische Chaos und die Neuordnung komplexer Zusammenhänge Rechnung trägt, weil alles wie ein Glücksspiel anmutet, indem Gewinne und Verluste zwar gleichermaßen hervorgebracht werden, sich aber die Gewinne als Prinzipe durchsetzen.
Manchmal beginnt man sich dann zu fragen: Ist Medoreigtulb wirklich der Motor und Katalysator des Ganzen oder steht sie einfach nur für den gezähmten Zufall und die universellen Gesetze, nach denen sich die Welt, wie in unzähligen unserer Mythen überliefert, selbst vom Chaos zur Ordnung ausbildet?
Und genau darin fußt auch die Theorie, der ich persönlich zudem sehr zugetan bin, dass es vor unserer bekannten Zivilisation bereits andere gegeben haben muss. Lange vor unserer Zeitrechnung hat es bereits fortschrittliche Hochkulturen gegeben. Zum Einen gibt es viele unabhängig voneinander entwickelten Mythen, die trotzdem darin übereinstimmen, dass es frühe Kulturen gegeben hat, an die heute nicht mehr viel erinnert. So überlieferten beispielsweise die Azteken fünf solcher Hochkulturen in recht detaillierten Beschreibungen, und während die erste vom Wasser verschlungen wurde, was stark an den Untergang von Platos Atlantis erinnert, so wurde auch die fünfte beschrieben, in der wir noch heute leben. Man findet aber auch überall auf der Welt eindrucksvolle Hinweise für mögliche Frühkulturen, die bei genauerer Betrachtung keinen anderen Schluss mehr zulassen, als dass es solche gegeben haben muss und dass es sich auch bei diesen Kulturen um Entwicklungsprozesse und Endstadien gehandelt hat, die sich neu ordneten, aber scheinbar schlichtweg verschwanden. Belege und Zeugnisse finden wir in nahezu allen Kulturerbmassen; sie im Einzelnen hier aufzuführen, würde den Rahmen sprengen. Aber jedem kritischen Denker sei als Denkanstoß der Name Professor Charles H. Hapgood in Verbindung mit der Weltkarte von Admiral Piri Reis gegeben, alles andere fügt sich dann.
Hinzu kommen für mein Gesamtbild dann die ersten wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, dass unser Universum periodisch untergeht und neu entsteht. Paul Steinhardt, Professor der Astronomie an der |Princeton University New Jersey| und Neil Turok von der |University of Cambridge|, der auch ein früherer Mitarbeiter von Stephen Hawking war, gelangten zu einer neuen Sicht mit dem zyklischen Entstehen und Vergehen eines Universums und belegen somit ein Weltbild, das wiederum den Mythen vieler Völker zugrunde liegt.
Daher, um zu deiner Frage zurückzukehren, wird |Praegaia| untergehen, wenn Medoreigtulb alles getan hat, was getan werden musste, doch bis dahin wird noch Zeit vergehen und noch einiges geschehen – und erst dann sind wir in der nächsten Epoche…
_Michael Birke:_
Du hattest in der Vergangenheit einige Probleme mit deinen Verlegern, mit dem |BLITZ|-Verlag sind jedoch bereits zwei weitere Zyklen geplant. Werden diese bereits vorhandenen Stoff aus der |GEISTERDRACHE|-Welt aufarbeiten oder entwickelst du gerade völlig neue Ideen?
_Marc-Alastor E.-E.:_
Der |Schattenwelt|-Verlag löste sich wenige Monate nach Erscheinen der ersten Auflage von „Kriecher“ auf, weil sich die beiden Teilhaber nicht länger grün gewesen sind. Für mich war das tödlich, denn die meisten Verleger wollten keinen angefangenen Zyklus fortführen und hätten lieber etwas Neues gehabt. Kriecher hatte sich jedoch sehr gut verkauft, die Resonanz war groß und jeder wollte den zweiten Teil. Ich gab also alles, um möglichst schnell neue Verträge einzustielen, doch es zog sich alles unglaublich hin.
|BLITZ| verwaltete damals Kriechers Restbestände, denn |BLITZ| hatte auch den Druck und Vertrieb für |Schattenwelt| übernommen und auf diese Weise blieb „Kriecher“ wenigstens lieferbar. Schließlich konnte ich mich mit Joerg Kaegelmann auf einen Vertrag für den zweiten Teil einigen, so dass ich wenigstens diesen gewährleisten konnte. Da war „Kriecher“ jedoch nahezu ausverkauft und wir kamen ins Gespräch über eine Neuveröffentlichung. Als ich ihm den Zyklus als Ganzes und meine Pläne für den Epos vorstellte, gewann für ihn alles ein Gesamtbild und wir machten daraufhin einen Serienvertrag.
Was die geplanten Zyklen angeht, so arbeiten sie natürlich vorhandenes Material auf. Es gab einige Kurzgeschichten zu Caracalla, dem Prinzen der Pestilenz, die sehr gut angekommen sind, so dass ich einen Romanzyklus um ihn schuf. Er wird als nächstes angegangen werden. Mit einem Buch über die Göttin entspreche ich dem Wunsch vieler Leser, die gerade über sie mehr erfahren möchten, und ich kann nur versprechen: Sie werden mehr erfahren, mehr als ihnen lieb sein wird.
Natürlich entwickle ich immer neue Ideen, die können und werden jedoch Eingang in die jeweils laufenden Projekte finden, seien diese nun zu |GEISTERDRACHE| oder einem anderen Romankonzept.
_Michael Birke:_
Wie ist die bisherige Resonanz, besteht die Chance, dass deine Bücher einmal im normalen Buchhandel auftauchen werden oder werden sie weiterhin ausschließlich als limitierte Fassungen angeboten?
_Marc-Alastor E.-E.:_
Bis vor kurzem wurden alle |BLITZ|-Titel auch über den Buchhandel vertrieben, jedoch ist die wirtschaftliche Lage für den Buchhandel genauso schwierig wie für viele andere Wirtschaftszweige.
Selbst große Verlage wie |Heyne| stoßen ihr komplettes Phantastikprogramm ab. Die Entscheidung, sich vom Vertrieb des Buchhandels zu trennen, war ein rein wirtschaftlicher und ist Joerg Kaegelmann sicherlich nicht leicht gefallen, auf der anderen Seite werden die Gewinnspannen der Verlage immer kleiner, die Produktionskosten nicht billiger und der Absatz selten wesentlich größer, so dass die Entscheidung nachvollziehbar ist. Natürlich ist es für einen jungen Autoren immens wichtig, überall erhältlich zu sein, und ich habe lange gehadert, was ich von dieser Entscheidung halten soll.
Aber mir ist im Endeffekt für |GEISTERDRACHE| die Sicherheit, auch weiter dort veröffentlichen zu können, wichtiger, denn es nutzt niemandem etwas, wenn ein Verlag die Tore schließen muss. Und andere Titel von mir werden den Weg in den normalen Buchhandel finden, so dass sich in Zukunft auch eine andere Perspektive für |GEISTERDRACHE| bieten mag. Die exklusive Erstausgabe verbleibt einstweilen bei |BLITZ|.
_Michael Birke:_
Zum Abschluss: Was liest du persönlich zur Zeit, kannst du deinen Lesern einige Bücher anderer Autoren empfehlen?
_Marc-Alastor E.-E.:_
Im Augenblick muss ich mich auf zwei weitere Romanprojekte vorbereiten, so dass ich ausschließlich Sachbücher und Artikel lese. Was ich danach lesen werde, weiß ich noch nicht. Und Buchempfehlungen spreche ich generell ungern aus, weil sie im Grunde für jeden anderen wenig aussagen. Aber ich freue mich über jeden Menschen, der zu einem Buch greift und darin etwas zu finden imstande ist.
Marc-Alastor E.-E. bei Buchwurm.info:
[„Kriecher“ 319
[„Adulator“ 468