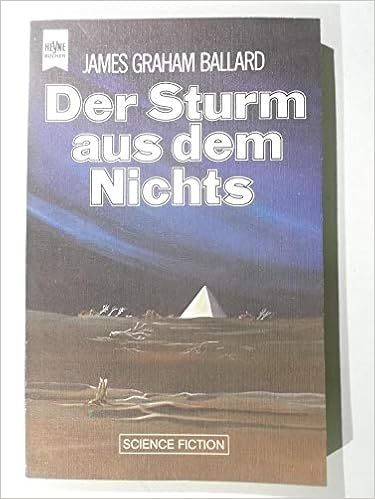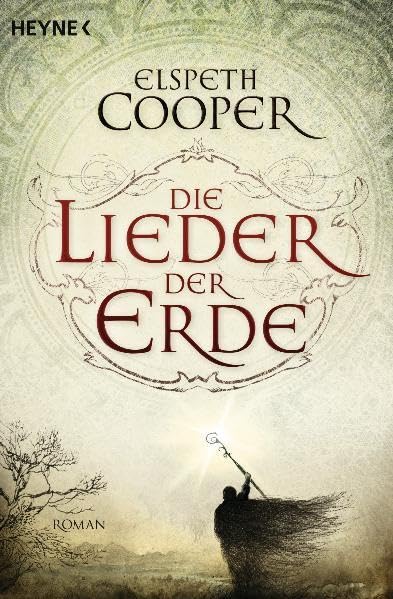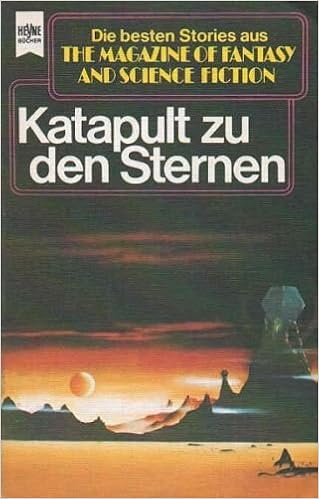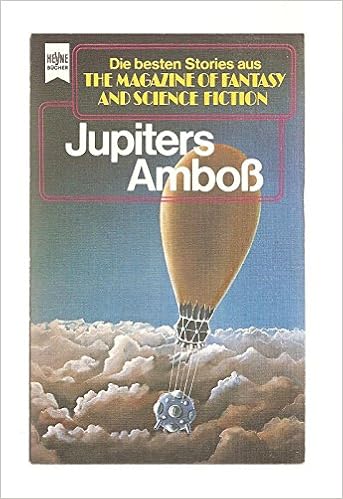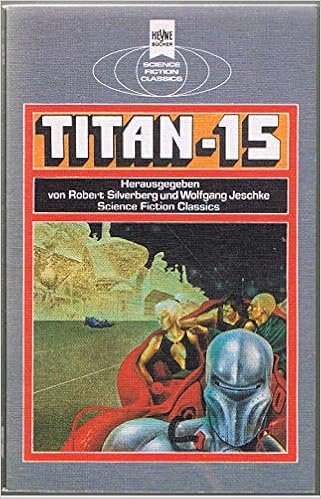Schlagwort-Archiv: Heyne
Clay & Susan Griffith – Schattenprinz (Vampire Empire 1)
Band 1: „Schattenprinz“
Band 2: „Nachtzauber“ (13.08.2012)
Band 3: „The Kingmakers“ (angekündigt, noch ohne dt. Titel)
„Vampire Empire“ – ein Vampirroman mit Schlagreim im Titel; das entbehrt nicht einer gewissen (vermutlich unfreiwilligen) Komik und man fragt sich zwangsläufig, ob mit dem Roman des Autorenduos Susan und Clay Griffith ein neuer Tiefpunkt des Genres erreicht ist.
Clay & Susan Griffith – Schattenprinz (Vampire Empire 1) weiterlesen
Cherie Priest – Boneshaker
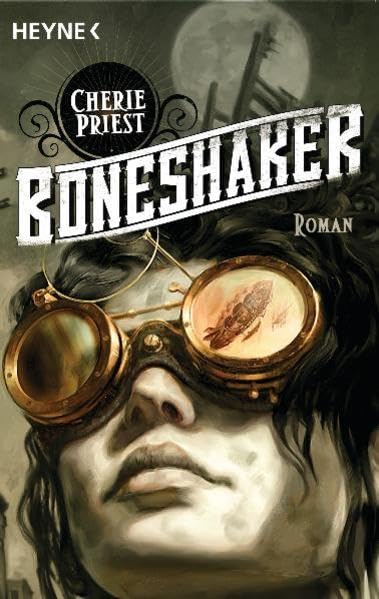
Andreas Brandhorst – Das Artefakt
Der Buchrücken verspricht wie eigentlich bei jedem seiner Romane „Brandhorst schreibt Space-Operas, wie man sie sich nur wünschen kann“ – so zitiert man dort Wolfgang Hohlbein. Der Titel ist immerhin so nichtssagend, dass man einfach den Haufen Geld für das aufgeplusterte Trade-Paperback hinlegen muss oder es eben sein lässt.
Andreas Brandhorst schreibt zahlreiche Übersetzungen und tritt seit seiner Kantaki-Serie nun auch verstärkt als Autor in Erscheinung. Man kann sagen, er ist der einzige deutsche Schriftsteller, der regelmäßig Space-Operas bei einem großen Verlag unterbringt. Was durchaus auch für den Unterhaltungswert seiner Romane spricht.
Die Geschichte beginnt mit der Wiedererweckung Rahil Tennerits, eines Missionars der „Ägide“, der während seiner wichtigsten Mission den Tod fand. Nun gibt es mehrere Probleme: Tennerits „Image“ ist fehlerhaft und zu alt, so dass er sich nicht an die Geschehnisse seines Todes, noch an die Einzelheiten seiner Mission erinnert. Die Raumstation, auf der er erweckt wird, ist menschenleer und wird von unbekannten Aggressoren heimgesucht, so dass Tennerit überstürzt aufbrechen muss, ohne sich vorbereiten zu können. Und seine Mission ist entscheidend für den weiteren Weg der Menschheit, denn die Hohen Mächte stehen vor der Entscheidung, die Menschheit an ihrem Wissen teilhaben zu lassen oder sie endgültig auszuschließen.
Für Tennerit beginnt eine irre Reise durch die Galaxis, immer knapp vor ominösen Verfolgern her, auf einer unmöglich anmutenden Mission und mit einer Vergangenheit belastet, die ihn stückweise einholt und auf einen Entscheidungspunkt zustrebt, der zugleich die Entscheidung für die Menschheit bringt.
Es ist eine typische Vorgehensweise, mitten in einer prekären Situation zu starten und die Hintergründe nach und nach aufzudecken. Typisch für Brandhorst ist außerdem, die Protagonisten mit einer ausschlaggebenden Vergangenheit auszustatten und über Schlaglichter in die Vergangenheit einzutauchen, um die Ursache für eine Wirkung aufzuzeigen, die schlussendlich die Entscheidung, die Wendung der Geschichte, dominiert. Das Ganze bettet er in eine spannende Verfolgungsjagd, über deren Verlauf man die Situation der Jetztzeit erfährt und im Fall einer neuen Weltenschöpfung die Gegebenheiten kennenlernt. Dadurch benötigt Brandhorst ein paar Seiten mehr, bis er zum Punkt kommt, doch das verleitet ihn zum Glück in diesem Roman nicht zu weitschweifenden Texten, wie dies in anderen heute üblichen Romanen im Ziegelsteinformat praktiziert wird.
Im Gegenteil liest sich „Das Artefakt“ zügig und durchweg flüssig, auch wenn sich die sich wiederholenden Situationen, aus denen der Protagonist keinen Ausweg zu haben scheint, mit der Zeit sammeln und die Spannung dann nicht mehr durch die Frage danach, ob, sondern höchstens wie überlebt wird, erzeugt wird.
Die Intrigen der Hohen Mächte untereinander und die Ursachen dafür liefern ein ganz eigenes interessantes Spannungsfeld, das auch ganz in typischer Souveränität von Brandhorst erzeugt wird. Spürbar ist hier ein erfahrener Erzähler am Werk, der bei diesem großformatigen Weltenspiel auch den „Sense of Wonder“ nicht vergisst.
Leider ist ein recht wichtiger Aspekt der Auflösung etwas konstruiert: Die Macht und die Fähigkeiten des Vaters Tennerits, der sich eigentlich von den höheren Zivilisationen abkapselte, kommen etwas plötzlich zum Tragen und haben größeren Einfluss auf das Geschehen als glaubwürdig wäre. Immerhin schaffen es die Ereignisse, ihn schließlich doch nur als Strohfigur im Spiel der intriganten Mächte zu entlarven.
Die technischen Aspekte bringen einige interessante Anwendungen von bekannten Vokabeln ein, innovative Neuerfindungen zeigen sich nicht. Doch aus dem mittlerweile ausgefeilten und umfangreichen Vokabular der Science-Fiction filtriert Brandhorst ein abgestimmtes, rundes Element für dieses Universum. So fällt es einem Science-Fiction-Fan leicht, sich in den Begrifflichkeiten zurechtzufinden, und auch der Neuling findet keine unüberwindbaren Barrieren.
So bleibt die Frage: Lohnt sich der Kauf oder lohnt er sich nicht? Hier gibt es kein einfaches Ja oder Nein zu nennen, denn da hinein zählt auch der Aspekt der Aufblähung durch das Format. Typischerweise erscheint ein erfolgreiches Tradepaperback bei |Heyne| in recht naher Zukunft auch als Taschenbuch, so dass es sich auch lohnen kann, noch etwas zu warten. Inhaltlich gesehen bekommt dieser Roman aber ein klares Ja, denn er bietet flotte Unterhaltung, ein interessantes Setting, eine unprofane Lösung und ein stimmiges Gesamtbild. Zwischen den deutschen Genreveröffentlichungen des Jahres wird „Das Artefakt“ mit Sicherheit einen guten Platz belegen.
Tradepaperback, 656 Seiten
ISBN: 978-3-453-52865-9
ORIGINALAUSGABE
Leseprobe
www.heyne.de
Der Autor vergibt: 



Wolfgang Jeschke, Brian W. Aldiss (Hg.) – Titan-22

In der vorliegenden Ausgabe des Auswahlbandes Nr. 22 von „Titan“ sind nicht Beiträge zur „Science Fiction Hall of Fame“ gesammelt, sondern klassische SF-Erzählungen – Thema sind „Evil Earths“, also kaputte Erden. Dies ist der erste von zwei TITAN-Bänden zu diesem Thema (Teile 1 bis 3 des Originals). Die Originalerzählungen entstammen Magazinen, die heute nur noch schwer zugänglich sind, und zwar aus drei Jahrzehnten.
Wolfgang Jeschke, Brian W. Aldiss (Hg.) – Titan-22 weiterlesen
Seth Grahame-Smith: Abraham Lincoln – Vampirjäger

Seth Grahame-Smith: Abraham Lincoln – Vampirjäger weiterlesen
Colin Harvey – Gestrandet

Colin Harvey – Gestrandet weiterlesen
Brian W. Aldiss – Tod im Staub

Als Kapitän Nolan mit seinem Frachter im 22. Jahrhundert über den Atlantik schippert, fischt sein Maat einen Toten auf, der über die Wellen geht. Damit handelt sich die Besatzung eine Menge Ärger ein. Denn die mit 20 Milliarden Menschen überbevölkerte Welt ist voller Gifte, und die alten Supermächte sind längst auf den Stand von Entwicklungsländer herabgesunken. Währenddessen haben sich die afrikanischen Nationen zu Großmächten aufgeschwungen, die eifersüchtig über ihre Besitzstände wachen. Durch den Toten wird Nolan mitten in diesen Konflikt hineingezogen …
_Der Autor_
Brian W. Aldiss (* 1925) ist nach James Graham Ballard und vor Michael Moorcock der wichtigste und experimentierfreudigste britische SF-Schriftsteller. Während Ballard nicht so thematisch und stilistisch vielseitig ist, hat er auch nicht Aldiss‘ ironischen Humor.
Aldiss wurde bei uns am bekanntesten mit seiner „Helliconia“-Trilogie, die einen Standard in Sachen Weltenbau in der modernen SF setzte. Das elegische Standardthema von Aldiss ist die Fruchtbarkeit des Lebens und die Sterilität des Todes. Für „Hothouse“ („Am Vorabend der Ewigkeit“) bekam Aldiss den HUGO Award. Er hat auch Theaterstücke, Erotik, Lyrik und vieles mehr geschrieben.
_Handlung_
Im 22. Jahrhundert schippert Kapitän Knowle Noland mit seinem vollautomatisierten Frachter „Trieste Star“ gerade auf die südwestafrikanische Skelettküste zu, um dort Sand zu laden, als der Tote auftaucht. Dieser Tote hält sich nicht an die Regeln: Er liegt nicht brav in einem stillen Grab, sondern schwebt über die Wellen des Atlantiks.
Als Nolans erster Maat den Toten an Bord holt, zeigt sich, dass dieser einen Antigrav-Anzug umgeschnallt trägt, die sein Gewicht auf etwa zehn Kilo reduzierte. Dr. Thunderpeck weiß Bescheid: So etwas können sich nur sehr reiche und herzkranke Leute leisten, und der feine Anzug des Toten spricht dafür. Wahrscheinlich machte er eine Erholungskur an der Küste, in einer Luxusferienanlage. Von dort wehte ihn vielleicht der Wind aufs Meer hinaus, wo er verhungerte. Und jetzt haben sie den Salat, denkt Noland.
Genau. Als sei der Tote ein Geist seiner schuldbeladenen Vergangenheit, balgt sich Noland mit ihm – und entdeckt die Briefe. Es sind Liebesbriefe von einer gewissen Justine an einen gewissen „Peter“. Sie muss einen Geheimauftrag im Umkreis des afrikanischen Präsidenten El Mahasset haben und der Adressat, den sie „Peter“ nennt, ein hohes Tier aus Großbritannien sein. Der letzte Brief datiert erst zwei Tage zuvor. Justines Worte verzaubern den seit 19 Monaten pausenlos auf See schippernden Kapitän. So entgeht ihm eine verhängnisvolle Entwicklung an Bord.
Der Autopilot ist ausgefallen. Noch während er mit dem Maat die unheilbringende Leiche – der Maat hat bereits rote Flecken im Gesicht – über Bord wirft, erkennt der Kapitän, dass das Land der klippenstarrenden Küste bereits in unmittelbarer Nähe ist. Jede Kursänderung kommt zu spät, wird ihm klar. Vollgas gebend lacht Noland auf: „Jetzt erst recht, Justine!“ Und rammt seinen 80.000-Tonnen-Kahn mit Karacho in die Felsen der Skelettküste, die ihren Namen vollauf verdient. Unzählige Wracks liegen hier. Und schon ist die „Trieste Star“ eines von ihnen.
|Rückblende|
In seinem Bericht blickt Noland zurück auf die Ereignisse, die ihn hierhergebracht haben. Wegen seines speziellen geistigen Zustands, der ihn unter Stress in Halluzinationen mit Schreikrämpfen verfallen lässt, war er vor zwölf Jahren aufs Land verschickt worden. Dort befinden sich nur scharf bewachte Strafkolonien in der mechanisierten Landwirtschaft. Als er per Zufall auf die vogelfreien „Wanderer“ stieß, verriet er deren Anführer und wurde von seinem Boss, dem Farmer, dafür mit dem Posten auf der „Trieste Star“ belohnt. Seit jenem Tag vor zwölf Jahren fühlt sich Noland an der Ermordung der „Wanderer“ schuldig.
|Odyssee|
Der Atomreaktor der „Trieste Star“ gerät just in dem Moment außer Kontrolle, als eine Militärpatrouille von Neu-Angola an Bord gehen will, um die leckere Prise in Besitz zu nehmen. Die Atomexplosion verschont lediglich das Leben von Noland, doch keinen sonst (ein Irrtum, wie sich herausstellt). Auf der Suche nach Nahrung wendet sich der Schiffbrüchige nach Süden und wird von einer anderen Patrouille gefangen genommen.
In dem Freistaat Walvis Bay geht etwas vor sich: Überall wird gebaut und dekoriert. Hier lernt Noland endlich seine Traumfrau kennen, die Justine aus den Briefen. Er kann nicht anders, als ihr seine Liebe anzubieten. Voll Verachtung schiebt sie diesen ahnungslosen „Plebejer“ beiseite. Aufgrund der Briefe, die man ihm abnimmt, verdächtigt sie Noland natürlich, etwas mit dem Tod jenes Mannes zu tun haben, der mit seinem Antigravgerät auf das Meer hinausgetrieben worden – er war ein Spion. Ergo muss auch Noland ein Spion sein, oder? Vergeblich beteuert er seine Unschuld, was ihn nur umso erbärmlicher wirken lässt.
Seine Häscher wollen ihn zu Justines Verbündetem bringen, der natürlich ebenfalls in den unheilvollen Briefen erwähnt wird: Es ist der Adressat Peter Mercator. Zu seinem Entsetzen stellt sich Mercator als sein früherer Boss heraus. Welche Rolle Justine und Peter an diesem schicksalhaften Vorabend spielen wollen, soll Nolan nur zu bald herausfinden. Denn sie haben ihm eine zentrale Rolle dabei zugedacht …
_Mein Eindruck_
Dieser SF-Klassiker war einer der Ersten, der sich ernsthaft und konsequent mit dem schon Anfang der sechziger Jahre absehbaren Problem der Überbevölkerung auseinandersetzte. Ein halbes Jahrzehnt später beschäftigte sich John Brunner in „Schafe blicken auf“ mit den daraus entstehenden Schwierigkeiten, die die Menschheit zu bewältigen hat. In dieser Thematik sind die britischen Autoren, zu denen auch J. G. Ballard zu zählen ist, den meisten ihrer amerikanischen Kollegen um Jahre voraus.
Aldiss schildert ein 22. Jahrhundert, in dem sich nicht weniger als 24 Milliarden menschliche Wesen in Städten drängen, die inzwischen auf Plattformen über der völlig ausgebeuteten und automatisierten Landwirtschaft gebaut werden. Die Macht der Nationen hat sich inzwischen umgekehrt: Der Westen und Asien schauen neidisch auf die vergleichsweise noch fruchtbaren Ebenen Afrikas. Deshalb spielt jenes Afrika, in dem Noland strandet, eine so entscheidende Rolle.
Und er landet hier am Vorabend eines Tages, der über die Zukunft Afrikas und somit der Erde entscheidet: Der afrikanische Präsident El Mahasset soll in Walvis Bay, einer winzigen Exklave, praktisch einen neuen Staat gründen. Gelingt ihm dies, so wäre dies eine Demonstration für den Frieden in Afrika. Scheitert er, so wird er Krieg mit Algerien und Neu-Angola führen, die nur darauf warten, ihn zu ersetzen.
Fatalerweise steht mit dieser Entscheidung auch das Problem der Überbevölkerung auf der Kippe: Die Maßnahme der Enthaltsamkeit, der sich die Abstinezler-Sekte hingibt, fruchtet nichts. Nun sinnt die Sekte auf eine weitaus radikalere Maßnahme, um die zunehmende Überbevölkerung nicht nur zu stoppen, sondern sogar zu verringern: Krieg ist das patentierte und erprobte Mittel zur Dezimierung von Menschenmassen. Und Krieg wird es geben, sobald El Mahasset in aller Öffentlichkeit ermordet wird.
Dies haben Justine und Peter Mercator im Sinn, als Noland auftaucht. Da Mercator todkrank ist, soll Noland für ihn einspringen. Und was soll er bitteschön davon haben, fragt er hartnäckig. Das ist eben die knifflige Frage, die er in intensiven Dialogen mit Mercator und Justine erörtert. Was gewinnt er, was gewinnt die Welt, wenn er El Mahasset tötet? Die Frage sei doch vielmehr, ob es mindestens einen Gewinner geben wird, erwidert Justine: die Wanderer, die Noland selbst so schnöde verraten hat. Und mit ihnen hätte die Erde eine Überlebenschance. Wird Noland schießen?
_Die Übersetzung_
Die Übersetzung, die der Lichtenberg-Verlag 1970 unter der Leitung von Günther Schelwokat anfertigen ließ, zeichnet sich durch hohes sprachliches Niveau und das Fehlen jeglicher Druckfehler aus. Das erlaubt ein höchst erfreuliches Leseerlebnis. Erst 1973 und erneut 1983 veröffentlichte Heyne diese Übersetzungsfassung.
Lediglich zwei Wörter fielen mir auf. Auf S. 37 ist von einer „Sprue“-Krankheit die Rede. Der Ausdruck war mir nicht geläufig. Das englische Wort bezeichnet eine fiebrige Erkrankung. Auf Seite 53 wird das Wort „Garage“ wieder mal im alten Sinn „Autowerkstatt“ verwendet.
_Unterm Strich_
Die Imitation des offensichtlichen Vorbilds Graham Greene, bekannt für Romane wie „Der stille Amerikaner“ und „Der Honorarkonsul“, rechtfertigt noch nicht, dass dieser Roman einen Status als Klassiker erreicht hat. Nein, es reicht nicht, einen Engländer in eine Agentensituation à la James Bond zu schicken, auch wenn die Action noch so packend ist. Es ist daher die zweite Komponente, die den Ausschlag gibt: die Figur des Knowle Noland selbst.
Er ist nicht nur das hilflose Produkt der Zustände auf einer übervölkerten, ausgepowerten Erde. Vielmehr ist er obendrein ein höchst unzuverlässiger Chronist. Er leidet an einer seltenen Geisteskrankheit, die ihm Visionen und Halluzinationen vorgaukelt, die mal poetisch, mal horrormäßig anmuten. Und einer dieser Trancezustände verzerrt seinen Geisteszustand derart, dass er eine lange „Fugue“ von Visionen erlebt. Wir können zwar annehmen, er sei zu Tode gestürzt, und er selbst nimmt das ebenfalls an, doch ist das objektiv nicht der Fall – der Leser wird genarrt.
In dieser Fugue findet ein fundamentaler Wandel in Nolands gequälter Seele statt. Die Begegnung mit dem Tod, mit Toten, mit weisen Männern voll ironischer Sprüche – all dies ermöglicht erst, dass Noland verändert zu Mercator und Justine zurückkehren kann – um mit ihnen zu kollaborieren. So eine seelische Transformation sucht man in konventionellen SF-Abenteuern vergeblich. Dieser Inner Space hebt das Buch, ebenso wie die Problematik, weit über den Durchschnitt hinaus.
Entgegen meiner Erwartung – ich war abgestoßen vom scheußlichen Titelbild – erlebte ich also einen spannenden Roman, der politisch relevant ist, eine kritische Vision der Zukunft aufweist und zudem so gut erzählt ist, dass einem die Figur des Knowle Noland unweigerlich in Erinnerung bleibt. Hinzukommt die hohe Qualität der Übersetzung. Sammler greifen am besten zur weißen Ausgabe aus der Heyne SF Bibliothek, die 1983 erschien.
Taschenbuch: 144 Seiten
Originaltitel: Earthworks (1965)
Aus dem Englischen von Evelyn Linke
ISBN-13: 978-3453309050
www.heyne.de
James Graham Ballard – Der Sturm aus dem Nichts
Nach einer Sonneneruption erhebt sich ein weltumspannender Riesensturm, dessen Stärke pro Tag um etwa 8 km/h zunimmt. Ein Arzt und ein U-Boot-Kommandant sowie zwei Reporter, versuchen dem nachfolgenden Inferno zu entrinnen. Sie stoßen auf den geheimnisvollen Multimillionär Hardoon, der nicht nur eine Privatarmee aufgestellt, sondern auch eine riesige Pyramide gebaut hat. Doch zu welchem Zweck? Ist es eine Arche oder eine Narretei? Das versuchen die Überlebenden herauszufinden.
_Der Autor_
James Graham Ballard wurde 1930 als Sohn eines englischen Geschäftsmannes in Schanghai geboren. Während des Zweites Weltkrieges, nach der japanischen Invasion 1941, war seine Familie drei Jahre in japanischen Lagern interniert, ehe sie 1946 nach England zurückkehren konnte. Diese Erlebnisse hat Ballard in seinem von Spielberg verfilmten Roman „Das Reich der Sonne“ verarbeitet, einem höchst lesenswerten und lesbaren Buch.
In England ging Ballard zur Schule und begann in Cambridge Medizin zu studieren, was er aber nach zwei Jahren aufgab, um sich dem Schreiben zu widmen. Bevor er dies hauptberuflich tat, war er Pilot bei der Royal Air Force, Skriptschreiber für eine wissenschaftliche Filmgesellschaft und Copywriter (was auch immer das sein mag) an der Londoner Oper Covent Garden.
Erst als er Science-Fiction schrieb, konne er seine Storys verkaufen. Ab 1956 wurde er zu einem der wichtigsten Beiträger für das Science-Fiction-Magazin „New Worlds“. Unter der Herausgeberschaft von Autor Michael Moorcock wurde es zum Sprachrohr für die Avantgarde der „New Wave“, die nicht nur in GB, sondern auch in USA Anhänger fand.
Ballard und die New Wave propagierten im Gegensatz zu den traditionellen amerikanischen Science-Fiction-Autoren wie Heinlein oder Asimov, dass sich die Science-Fiction der modernen Stilmittel bedienen sollte, die die Hochliteratur des 20. Jahrhunderts inzwischen entwickelt hatte – zu Recht, sollte man meinen. Warum sollte ausgerechnet diejenige Literatur, die sich mit der Zukunft beschäftigt, den neuesten literarischen Entwicklungen verweigern?
Doch was Ballard ablieferte und was Moorcock dann drucken ließ, rief die Politiker auf den Plan. Seine Story „The Assassination of John Fitzgerald Kennedy Considered as a Downhill Motor Race“ (1966) rief den amerikanischen Botschafter in England auf den Plan. Ein weiterer Skandal bahnte sich an, als er Herausgeber von „Ambit“ wurde und seine Autoren aufrief, Texte einzureichen, die unter dem Einfluss halluzinogener Drogen verfasst worden waren. Seine härtesten Texte, sogenannte „condensed novels“, sind in dem Band „The Atrocity Exhibition“ (1970, dt. als „Die Schreckensgalerie“ und „Liebe und Napalm – Export USA“) zusammengefasst, dessen diverse Ausgaben in den seltensten Fällen sämtliche Storys enthalten …
Seither hat Ballard über 150 Kurzgeschichten und etwa zwei Dutzend Romane geschrieben. Die ersten Romane waren Katastrophen gewidmet, aber derartig bizarr und andersartig, dass sie mit TV-Klischees nicht zu erfassen sind. Bestes Beispiel dafür ist „Kristallwelt“ von 1966, das ich hier aber nicht darlegen möchte, sondern ich verweise auf meine entsprechende Rezension. Äußere Katastrophen (wie die Kristallisierung des Dschungels) wirken sich auf die Psyche von Ballards jeweiligem Helden aus und verändern sie. Dabei stehen die vier Romane „The Wind from Nowhere (1962), „The Drowned World“ (1962), „The Drought“ (Die Dürre, 1964) und schließlich „The Crystal World“ sinnbildlich für Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, ausgedrückt durch die Metaphern Luft, Wasser, Feuer und Erde/Diamant (Kristall). Ballard starb 2009.
_Handlung_
Der Arzt Donald Maitland will gerade von London Heathrow nach Vancouver fliegen, um einer gescheiterten Ehe zu entfliehen, als das Startverbot erteilt wird: Die Scherwinde sind viel zu stark, als dass ein Flieger gefahrlos abheben könnte. Also steigt er wieder ins Taxi und schafft es durch die vielen Staus zu seiner Wohnung. Er hat aber bereits seine Schlüssel an Susan abgeschickt und muss bei sich selber einbrechen. Dabei wird er von Susan und ihrem derzeitigen Lover Sylvester überrascht und niedergeschlagen. Willkommen daheim!
Eigentlich sollte die reiche Alkoholikerin Susan ja in ihrem luxuriösen Haus an der Küste der Lust frönen, doch sie klagt, der aufgekommene Wind habe alle Scheiben bersten lassen, das gestiegene Wasser habe sie sogar vom Festland abgeschnitten. Wie grässlich! Da platzen auch in Maitlands Wohnung die Scheiben, und ein kristalliner brauner Staub bläst herein. Maitland hält hier nichts mehr, schon gar nicht Susan.
Bei seinem Kollegen Andrew Symington, einem Luftfahrtingenieur mit guten Verbindungen, gibt es auch keine guten Neuigkeiten. Luxusdampfer verkehren inzwischen ebenso wenig wie Flugzeuge; man kommt nicht mehr runter von der Insel Britannien. Der Sturm trägt Lössboden aus Tibet und Nordchina nach Europa: 50 Mio. Tonnen davon. Symington erfährt, dass die britische Regierung erste „Vorsichtsmaßnahmen“ plane: Evakuierungen in Bunker und U-Bahn-Schächte. Das Radio berichtet von enormen Verwüstungen in Asien.
|Genua / Nizza |
Der amerikanische U-Boot-Kommandant Lanyon bekommt den Auftrag, von seinem Stützpunkt in genau 240 Kilometer nach Nizza zu fahren und dort einen General aus einem Lazarett abzuholen, der bei einem Flugabsturz schwer verletzt worden sei. Die Fahrt wird bei Windgeschwindigkeit von rund 185 km/h zu einem Himmelfahrtskommando. Nur weil der Wagen schwer gepanzert und geländegängig ist sowie Allradantrieb hat, kommt Lanyons Fahrer überhaupt durch.
Der General ist mittlerweile tot und wird in einem Sarg in den Panzerwagen geladen. Auf der Rückfahrt nimmt Lanyon vier Amerikaner mit, doch sie schaffen es nur bis kurz vor Genua. Der Wagen kippt um, und wer aussteigt, wird vom Sturm weggerissen. Lanyon kann sich mit einer Radioreporterin namens Patricia Olsen in einen Keller retten. Doch wie sollen sie überleben, wenn draußen die Windstärke weiter zunimmt?
|London: die Operationszentrale, die Tunnel |
Über Symingtons Verbindungen ist es Maitland gelungen, bei der Navy als Arzt unterzukommen. Auf diese Weise kann er der Operationszentrale ebenso wie den Menschen helfen. Als er jedoch einem verunglückten kommandierenden Offizier und dessen Sekretärin hilft, entdeckt er in dessen Haus Gasmasken und Minenwerfer, außerdem genug Leute für eine Privatarmee. „Haldoon“ steht auf den Kisten. Die Geräte sind von einem Multimillionär hergestellt worden, der auf dem Lande sein eigenes Bunkersystem angelegt hat, soweit sich Maitland erinnert. Er fragt sich, was dort vor sich gehen könnte.
Die Windgeschwindigkeit ist auf 180 Meilen pro Stunden angewachsen, das sind rund 290 km/h. Sie nimmt pro Tag um 5 Meilen / Stunde zu. Nun standen auch selbst relativ moderne Gebäude dem Winddruck und -sog nicht mehr stand. Die Diensttruppen bewegen sich nur noch in gepanzerten Fahrzeugen durch die dunklen Straßen Londons, und die Zivilisten bewegen sich zwischen Zementsackbarrikaden wie Ratten in dunklen Tunneln, wenn sie zwischen Keller und U-Bahnstation wechseln wollen.
Als er erfährt, dass Susan sich immer noch in seiner Wohnung befindet, eilt er zu ihr. Warum weigert sich die Millionärin, sich in Sicherheit zu bringen? Ist sie denn irre? Sie argumentiert, dass sie nichts mehr mit Männern zu tun haben wolle, die über sie bestimmen. Als er sie packen will, um sie in die Tunnel zu bringen, reißt sie sich los – und wird vom gierigen Sturm hinaus ins Nichts gerissen. Maitland kann gerade noch dem einstürzenden Haus entgehen, als er sich vor verrammelten Tunnelzugängen wiederfindet. Gefangen …
|Unterdessen|
Die Pyramide ist fertiggestellt. Ihr Erbauer blickt zufrieden aus sicherem Versteck auf sein Werk, wo nun weitere Zugangstunnel angebaut werden. Er nennt die Pyramide „Die Tore des Sturmwinds“. Doch zu welchem geheimnisvollen Zweck hat er sie erbaut? Donald Maitland und Captain Lanyon sollen es schon bald herausfinden …
_Mein Eindruck_
Der Autor hat den Roman mit einer Geschwindigkeit von 6000 Wörtern pro Tag an nur zehn Tagen rausgehauen, um das hübsche Sümmchen von 300 Pfund Sterling zu verdienen – anno 1961 noch ein Jahresgehalt wert. (Siehe dazu das Ballard-Interview mit Pringle & Goddard von 1975.) Dementsprechend anspruchslos wirkt die Story auch. Sie unterscheidet sich in beinahe nichts von all jenen britischen Katastrophenromanen, die spätestens seit H.G. Wells‘ „Krieg der Welten“ und John Wyndhams „Die Triffids“ so in Mode gekommen waren.
Immerhin sorgt dieses in fast jeder Hinsicht konventionelle Werk für beste Unterhaltung. Actionszenen und Romantik halten sich die Waage, alles unter dem Alpdruck der bangen Frage: Wird es einen Fortbestand der Menschheit geben? Das Finale steigert das Geschehen noch einmal ins Gigantomanische: Dann wird die Frage beantwortet, ob Hardoons Pyramide der Urgewalt des titelgebenden Sturms standhalten kann oder nicht. Das soll hier aber nicht verraten werden.
Entgegen den Behauptungen anderer Rezensenten gibt der Autor durchaus eine Begründung für diesen immensen Sturm an. Die stetig steigende Windstärke soll die Folge eines ungewöhnlich starken Sonnensturms sein. Das ist zwar ziemlich hanebüchen, entsprach aber damals, anno 1961, wohl dem Stand der Wissenschaft. Immerhin hatte die Astronomie sich gerade dazu durchgerungen, die tropischen Sümpfe auf der Venus, die noch Heinlein & Co. als Abenteuerspielplatz gedient hatten, ins Reich der Phantasie zu verweisen.
Ballards Debütroman (einen anderen Erstling soll er zuvor entsorgt haben) ist ein klassisches Experiment: Was passiert, wenn eine unendlich starke Kraft auf ein Objekt trifft, dessen Widerstand möglicherweise unendlich groß ist? Die Kraft des Sturms nimmt ständig zu, und wir laufend mit Informationen versorgt, welche Bauwerke bei welcher Stärke dem Druck nachgeben. Traurig aber wahr: Auch die Krönung der Architektur in Gestalt von britischen Gebäuden der Londoner City (dito in New York City) geben nach, und selbst Bunker für U-Boote sehen sich dem Einsturz gegenüber.
Muss dann nicht die Errichtung einer großen Pyramide wie pure Narretei wirken? So flach die Figur des Multimillonärs Hardoon auch gezeichnet sein mag, so erfüllt sie doch eine Schlüsselfunktion: Sie beantwortet die Frage, ob irgendetwas von Menschenhand Errichtetes Bestand haben kann – und zwar im Schnellvorlauf. Hardoon agiert aus Trotz und fordert die Götter heraus, wenn es sie noch gäbe. Sein Schicksal liefert eine Antwort auf obige Frage (und soll hier nicht preisgegeben werden). Gleich darauf legt sich der Wind. Q.E.D.
Der absurde Wind ohne Ursache ist ebenso purer Ballard wie die Halluzinationen, unter denen Maitland leidet. Ballard wollte bekanntlich Psychiater werden und kannte sich mit abweichenden Geisteszuständen aus, ebenso mit dem grafischen Surrealismus. Allerdings hält er sich mit symbolischen Umschreibungen in diesem Debüt äußerst zurück, so dass der Roman auch als Drehbuch für einen realistischen Katastrophenthriller dienen könnte.
_Unterm Strich_
Dass der Roman völlig konventionellen Vorgaben gehorcht und voller Klischees der Katastrophenliteratur steckt, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es doch mit einem Ballard zu tun haben: Eine einzige Kraft transformiert die gesamte Erde, genau wie in „The Drowned World“, „The Drought“ und „The Crystal World“. Stets hat der Mensch eine Möglichkeit, sich der Landschaft anzupassen, sei es in den Tropen, im Sandmeer oder im Dschungel der Kristallwelt.
Die vorliegende Umwandlung lässt den Menschen jedoch nicht die geringste Chance, sich der entstehenden Landschaft anpassen – denn aus all den Bauwerken des Menschen und allen Formen des natürlichen Lebens entsteht nur eines: Staub. Mit anderen Worten: Die Erde wird so unbewohnbar wie der Mars, aus einem relativen Eden wird eine unbarmherzige Hölle. Nur im allerletzten Augenblick gewährt die Natur den todgeweihten Überlebenden – seien es vier oder 400 – einen Gnadenaufschub. Bis zum nächsten Mal?
Die Figur Hardoons ist sowohl konventionell als auch dramatisch wichtig. Der Millionär fordert die Urkraft des Elementes Luft heraus. Er ist jedoch weder der Magier Prospero noch Kapitän Ahab, sondern ein Trotzkopf, der der unintelligenten Natur etwas selbst Errichtetes entgegenstellt. Wird er damit bestehen oder untergehen? Das sollte man selbst lesen.
|Die Übersetzung |
Bei der Übersetzung durch Gisela Stege kommt keinerlei Freude auf. Allzu sachlich und umständlich formuliert sie die Sätze, die das Original vorgibt, nach. Was aber im Englischen als guter Stil gegolten haben mag (anno 1962), das muss nicht unbedingt für das Deutsche gelten. Ich warte also immer noch auf eine mustergültige Übersetzung.
Taschenbuch: 155 Seiten
Originaltitel: The Wind from Nowhere (1962)
Aus dem Englischen von Gisela Stege
SBN-13: 978-3453305014
www.heyne.de
Licia Troisi – Der Fluch der Assassinen (Die Schattenkämpferin 3)

Band 1: „Das Erbe der Drachen“
Band 2: „Das Siegel des Todes“
Band 3: „Der Fluch der Assassinen“
Story:
Nach der teils triumphalen Rückkehr der einzelnen Gefährten beschließt der Rat des Wassers, die Gilde der Assassinen endgültig zu vernichten und die Schreckensherrschaft Dohors‘ parallel hierzu zu einem friedlichen Ende zu führen. Auch Dubhe fühlt sich inzwischen ihrer Aufgabe verpflichtet und reist mit der ungleichen Magierin Thena nach Makrat, um die Herkunft ihres Siegels zu ergründen und es durch den Tod des kriegstreibenden Königs endgültig zu verbannen. Als Mägde verkleidet fallen die beiden jedoch schnell in die Hand von Sklavenhändlern und werden auf dem Markt als neue Hilfskräfte feilgeboten. Ausgerechnet Learco, Dohors Sohn, verpflichtet Thena und Dubhe für seine Dienste, nicht wissend, wen er künftig mit sich führt. Während ihrer treuen Dienste am Hofe von Dohor erforschen Dubhe und Thena die Bibliothek des Königs und werden für ihre Hartnäckigkeit belohnt. Gleichzeitig nähern sich auch Learco und Dubhe immer weiter an – eine Begebenheit, die in der Schattenkämpferin Gefühle weckt, die ihr bislang in dieser Intensität immer fremd waren. Dubhe offenbart sich schließlich dem ungeliebten Königssohn und überredet ihn zur Verschwörung gegen den finsteren Herrscher. Doch bevor ihr Attentat umgesetzt werden kann, wird der Hochverrat bekannt.
Licia Troisi – Der Fluch der Assassinen (Die Schattenkämpferin 3) weiterlesen
A. E. W. Mason – Das Geheimnis der Sänfte

A. E. W. Mason – Das Geheimnis der Sänfte weiterlesen
Alan Dean Foster – Das Ding aus einer anderen Welt
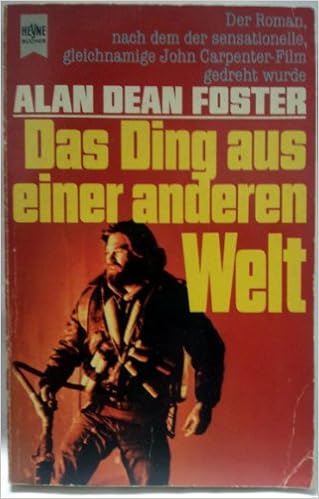
Alan Dean Foster – Das Ding aus einer anderen Welt weiterlesen
Elspeth Cooper – „Die Lieder der Erde“ (Die wilde Jagd 1)
Die wilde Jagd:
Band 1: „Die Lieder der Erde“
Band 2: „Trinity Moon“ (19.04.2012, noch ohne dt. Titel)
Band 3: „The Dragon House“ (angekündigt, noch ohne dt. Titel)
Gair besitzt magische Fähigkeiten, was in seiner Heimat einem Todesurteil gleichkommt. Nur durch ein Wunder, wie es scheint, ist er dem Scheiterhaufen entgangen und hat in dem alten Alderan auch noch einen freundlichen Helfer gefunden. Nun ist er auf dem Weg nach Westen, denn Alderan hat ihm einen Platz an seiner Akademie angeboten, und Gair mag Bücher. Doch seine Alpträume lassen ihn nicht los. Und auch die Kirche scheint sich nicht damit abfinden zu wollen, dass er dem Tod entronnen ist, denn sie hat ihm einen Hexenjäger hinterhergeschickt …
Laut Klappentext ist Elspeth Coopers Buch „einer der größten Fantasy-Romane“ unserer Zeit. Ein ziemlich vollmundiges Lob! Zu Beginn der Lektüre kamen mir da allerdings gelinde Zweifel.
Der Anfang der Geschichte liest sich irgendwie holperig und zusammenhanglos. Die Erzählsicht wechselt innerhalb der ersten Kapitel ziemlich häufig, nicht nur zwischen unterschiedlichen Personen, sondern auch zwischen verschiedenen Zeitebenen. Diese Wechsel sind bestenfalls durch eine Leerzeile und einen neuen Absatz gekennzeichnet, die sich aber auch an Stellen finden, an denen die Erzählsicht nicht wechselt. Das führt dazu, dass der Leser sich immer wieder mal überraschend in einem völlig anderen Zusammenhang wiederfindet. Nachdem Gair den Einflussbereich der Stadt Dremen verlassen hatte, wurde es etwas besser, aber auch in den späteren Kapiteln war die Handlung ab und an immer noch gut für einen überraschenden Sprung.
Nach dem holperigen Einstieg verläuft die Handlung grob gesagt in drei Strängen. Einer dreht sich um einen Mann namens Masen, einer zeigt die Ereignisse in Dremen nach Gairs Flucht, und der Hauptstrang erzählt natürlich von Gair.
Der Strang um Masen dient vorwiegend der Erklärung der Welt. Hier erfährt der Leser Details über den Schleier und seine Funktion sowie über die Wesen in der Welt auf der anderen Seite des Schleiers. Nicht unbedingt ausführlich und erschöpfend, aber die Skizze ist deutlich genug, um eine spürbare Bedrohung aufzubauen und gleichzeitig eine Differenzierung zu ermöglichen. Nicht alle Geschöpfe der anderen Seite sind bösartig.
Die Ereignisse in Dremen bestehen hauptsächlich aus Politik. Anfangs störte mich die Darstellung der Kirche. Ihre Lehren sind dogmatisch und intolerant, ihre Methoden grausam. Gleichzeitig stammt ein Großteil der Begriffe aus dem christlichen Bereich: das Gebet, das Gair so oft wiederholt, klingt extrem nach Rosenkranz, es gibt ein heiliges Buch, dessen Zitate teilweise aus der Bergpredigt stammen könnten, es gibt eine Inquisition und ein Sakrament, das nahezu völlig dem Abendmahl der katholischen Messe entspricht. Dass die Gottheit dieser Kirche eine Göttin ist, macht da auch keinen großen Unterschied mehr. Falls die Autorin die Absicht hatte, hier ihre eigene persönliche Kirchenkritik zu formulieren, hat sie meiner Meinung nach das falsche Medium gewählt. Und falls sie diese Absicht nicht hatte, hätte sie sich vielleicht ein wenig mehr Mühe geben können, um sich eine eigene Art von Kirche auszudenken.
Dieser erste Eindruck mildert sich zum Glück mit fortschreitender Handlung. Und letztlich bietet dieser Strang die meisten Facetten, nicht nur, weil hier die meisten Personen aktiv sind, sondern auch, weil zusätzlich zur Politik auch noch Geschichtsforschung betrieben wird. Worum es bei all dem genau geht, hat die Autorin noch nicht verraten, aber das macht die Sache eigentlich nur interessanter.
Auch der Hauptstrang hatte seine Mankos. Der Weg zu den westlichen Inseln wirkt noch immer ein wenig holprig, weil zwischen den einzelnen Etappen, die gelegentlich mit ein wenig Action aufgepeppt wurden, jedes Mal größere Zeitsprünge liegen. Die treten auch nach Gairs Ankunft an der Akademie noch gelegentlich auf, wirken aber nicht mehr so störend, weil ab diesem Punkt wenigstens der Ort immer derselbe ist. Dafür focussiert sich die Handlung – nach einer eher kurzen und letztlich geradezu unbedeutend wirkenden Schwertkampfepisode mit einem Mitschüler, der Gair nicht mag – bald ziemlich stark auf Gairs Beziehung zu Aysha. Die Entstehung und Entwicklung dieser Beziehung wird sehr ausführlich dargestellt. Das störte mich aus mehreren Gründen: Zum einen war diese Beziehung absehbar ab dem Augenblick, in dem die beiden sich das erste Mal trafen, selbst, wenn Aysha nicht bereits im Klappentext als Gairs erste große Liebe bezeichnet worden wäre. Zum anderen entwickelt sich die Liebe zwischen den beiden zu einem ziemlich großen Teil, während sie in Tiergestalt unterwegs sind, was nicht unbedingt gesprächsfördernd wirkt, da Gair zu diesem Zeitpunkt die Telepathie noch nicht beherrscht. Vor allem aber drängt sie fast alles andere in den Hintergrund, auch die Sache mit Darrins Kristall, die für den Verlauf der Handlung eigentlich viel wichtiger war als spielende Wölfe im Schnee.
Ein wenig hatte es vielleicht auch mit den Charakteren zu tun: Gair ist ja ganz nett. Ein wenig naiv, da er in einem klösterlichen Ritterorden aufgewachsen ist, und auch unsicher, weil er als Findelkind seine Herkunft nicht kennt, weil er sein Leben lang gelernt hat, dass seine Fähigkeiten Sünde seien, und weil er ein Brandmal trägt, das ihn zum Ausgestoßenen macht. Aber er ist mutig, freundlich und hat einen ziemlich sicheren Instinkt für Gefahr. Aysha dagegen mochte ich nicht besonders. Sie ist charismatisch, schön und stolz, aber auch ziemlich egoistisch, zum Beispiel wenn sie Gair von anderen Unterrichtsstunden wegholt, um ihn selbst zu unterrichten. Nicht, dass ich die Gründe nicht verstehen könnte, selbstsüchtig fand ich sie trotzdem. Auch sonst ist sie ziemlich rücksichtslos, wenn es darum geht, ihre eigenen Interessen durchzusetzen, wenngleich sie damit niemandem schadet. Tanith fand ich viel sympathischer. Sie ist genauso stark und mutig und genauso schön, aber sanftmütiger und nicht so selbstbezogen. Eigentlich würde sie viel besser zu Gair passen.
Ein ziemlich interessanter Charakter ist Ansel, das Oberhaupt der Kirche. Bevor er Präzeptor wurde, war er Kirchenritter und hat Krieg gegen die Wüstenstämme geführt, dementsprechend sind seine Umgangsformen. Von den Dogmatikern innerhalb des Rats von Kirchenmännern hält er gar nichts. Außerdem scheint er wesentlich weitsichtiger zu sein als die meisten Räte, denn während die sich mit kleinlichen Intrigen beschäftigen, versucht er, die Lösung für ein Problem zu finden, von dessen Existenz die anderen offenbar noch gar nichts gemerkt haben. Dadurch trägt Ansel ganz massiv dazu bei, den ersten Eindruck von der Kirche als Gesamtheit zu differenzieren.
Und dann ist da noch Savin. Er taucht zu Beginn einmal kurz auf und ist dann fast das gesamte Buch über verschwunden, nur um zum Showdown überraschend wieder aufzutauchen. Sein Verhalten ist allerdings ziemlich unlogisch. Warum sollte jemand versuchen, seinen Gegenüber erst zu umgarnen, dann, ihn umzubringen, und zuletzt, ihn zu benutzen? Falls es dafür einen triftigen Grund gibt, erfährt der Leser ihn erst in den Folgebänden.
Immerhin ist Savin durchaus für eine Überraschung gut. Und nachdem er wieder aufgetaucht ist, zieht auch die Spannung an, und zwar ganz gehörig. An dieser Stelle kommt zum ersten Mal richtig Bewegung und Dramatik in die Handlung. Nicht, dass es vorher langweilig gewesen wäre. Wirklich uninteressant fand ich eigentlich nur das ausgiebige Geplänkel zwischen Gair und Aysha. Ein echter Sog entwickelte sich aber erst auf den letzten hundert Seiten, dafür dann aber gleich richtig.
Unterm Strich war der Eindruck ein wenig durchwachsen. Nachdem ich das Geholper der ersten paar Kapitel hinter mich gebracht hatte, las sich das Buch zunehmend flüssig und interessant. Die Charaktere waren zwar nicht allzu intensiv gezeichnet, aber immerhin sympathisch, und Alderans Geheimniskrämerei sorgte dafür, dass ich neugierig blieb. Die kleinen Actionszenen auf Gairs Reise reichten zwar nicht aus für einen echten Spannungsbogen, hielten die Handlung aber immerhin abwechslungsreich. Über den späteren Durchhänger, den Gairs Liebesbeziehung für mich bedeutete, rettete mich Ansel hinweg. Und der Showdown war wirklich gelungen, und das nicht nur, weil der Angriff aus einer völlig unerwarteten Richtung kam.
Zu den „größten Fantasy-Romanen unserer Zeit“ würde ich es also nicht zählen. Aber ich denke, ich werde dem nächsten Band eine Chance geben. Da Aysha nicht mehr da ist, dürfte das störende Gebalze als stärkstes Gegenargument wohl wegfallen. Ansels Geschichtsforschungen und sonstigen Maßnahmen klingen interessant und vielversprechend. Und der Hexenjäger und Savin sind bisher so wenig zum Zug gekommen, dass ihr Potenzial noch nahezu unverbraucht ist. Falls die Autorin tatsächlich die Romantik zu deren Gunsten etwas drosselt, könnte die Fortsetzung des Zyklus so spannend werden wie das Ende des ersten Bandes.
Elspeth Cooper stammt aus dem Nordosten Englands und ist vernarrt in Bücher, seit sie allein lesen kann. Vor allem Epen haben es ihr angetan. Nach der Schule arbeitete sie zunächst für eine Softwarefirma, bis die Diagnose Multiple Sclerose ihre Bewegungsfähigkeit einschränkte, woraufhin sie sich dem Schreiben widmete. „Die Lieder der Erde“ ist ihr erster Roman und der erste Band ihrer Trilogie |Die wilde Jagd|. Ein deutsches Veröffentlichungsdatum für die Folgebände „Trinity Moon“ und „The Dragon House“ steht noch nicht fest.
Taschenbuch 557 Seiten
Originaltitel: Songs of the Earth – The Wild Hunt 1
aus dem Englischen von Michael Siefener
ISBN-13: 978-3-453-26713-8
http://elspethcooper.com/blog
http://www.heyne.de
Der Autor vergibt: 




Freeman Wills Crofts – Das Verbrechen von Guildford

Freeman Wills Crofts – Das Verbrechen von Guildford weiterlesen
Jeschke, Wolfgang (Hrsg.) – Ikarus 2001. Best of Science Fiction

Wolfgang Jeschke, der ehemalige Herausgeber der SF- & Fantasy-Reihe im Heyne-Verlag, hat als seine letzten Herausgebertaten drei Bände mit den besten SF-Erzählungen veröffentlicht:
1) Ikarus 2001
2) Ikarus 2002
3) Fernes Licht
Die Beiträge in diesen drei Auswahlbänden stammen von den besten und bekanntesten AutorInnen in Science-Fiction und Phantastik. In diesem ersten Band sind Beiträge aus den Jahren 1955 bis 1987 vertreten.
Der Herausgeber
Wolfgang Jeschke, geboren 1936 in Tetschen, Tschechei, wuchs in Asperg bei Ludwigsburg auf und studierte Anglistik, Germanistik sowie Philosophie in München. Nach Verlagsredaktionsjobs wurde er 1969-1971 Herausgeber der Reihe „Science Fiction für Kenner“ im Lichtenberg Verlag, ab 1973 Mitherausgeber und ab 1977 alleiniger Herausgeber der bis 2001 einflussreichsten deutschen Science-Fiction-Reihe Deutschlands beim Heyne Verlag, München. Von 1977 bis 2001/02 gab er regelmäßig Anthologien – insgesamt über 400 – heraus, darunter die Einzigen mit gesamteuropäischen Autoren.
Seit 1955 veröffentlicht er eigene Arbeiten, die in ganz Europa übersetzt und z. T. für den Rundfunk bearbeitet wurden. Er schrieb mehrere Hörspiele, darunter „Sibyllen im Herkules oder Instant Biester“ (1986). Seine erster Roman ist „Der letzte Tag der Schöpfung“ (1981) befasst sich wie viele seiner Erzählungen mit Zeitreise und der Möglichkeit eines alternativen Geschichtsverlaufs. Sehr empfehlenswert ist auch die Novelle „Osiris Land“ (1982 und 1986). Eine seiner Storysammlungen trägt den Titel „Schlechte Nachrichten aus dem Vatikan“.
Die Erzählungen
1) Walter M. Miller: Der Darfsteller (The Darfsteller, 1955)
In der nahen Zukunft hat das von programmierbaren Schaufensterpuppen ausgeführte „Autodrama“ das traditionelle Theaterschauspiel abgelöst – und mit ihm auch die menschlichen Darsteller. Thornier, der einst große Mime, hat dadurch seine Berufung verloren, doch er arbeitet immer noch im Theatergebäude: als Reinigungskraft. Dass er sich erniedrigt fühlt, versteht sich von selbst. Sein Kumpel Rick erklärt, wie das Autodrama im einzelnen funktioniert, und ein tollkühner Plan.
Als das neue Stück namens „Der Anarchist“ seine Premiere hat, will er die Puppe der Hauptfigur ausfallen lassen und für sie einspringen. Soweit klappt sein Plan auch hervorragend, denn die Koproduzentin spielt mit, ist sie doch eine alte Bekannte von Thornier. Doch dann taucht auch seine frühere Geliebte Mela auf, die ebenfalls in diesem Stück durch eine Puppe verkörpert wird. Und an diesem Punkt beginnen die Dinge schiefzugehen …
Mein Eindruck
In jeder Zeile verrät der Autor seine genaue Kenntnis des Theaters, und zwar nicht nur von dessen äußerer Mechanik und Verwaltung, sondern auch vom Innenleben der Schauspieler – wie sie „ticken“, was sie motiviert, was sie zum Versagen und zum Weitermachen bringen kann. Diese Psychologie erfüllt den Charakter der Hauptfigur der Geschichte auf glaubwürdige Weise und bringt den Leser dazu, mit ihm zu fühlen: sich zu freuen, mit ihm zu bangen.
Der Autor verschließt auch nicht die Augen vor der Notwendigkeit der Veränderung durch neue Technik: Rechner, Fernsehen, Schreibmaschine, was auch immer – nun ist es eben Autodrama. Doch er sagt auch, dass jede unabwendbar erscheinende Veränderung nicht immer zum Besten ausschlagen muss. Die Hauptsache ist doch meist, dass sie Geld einbringt. Wenn dadurch einige tausend Leute ihren Job verlieren – nun ja, dann müssen sie eben umsatteln. Leichter gesagt als getan.
Was die Geschichte inzwischen antiquiert erscheinen lässt (anno 1982 wohl nicht so sehr als jetzt, 2007), sind natürlich die technischen Details. Die Programmierung der „Mannequins“, die wie frühere Stars aussehen, erfolgt noch mit Lochstreifenbändern wie anno dazumal und noch nicht mit magnetischen (Festplatte) oder optischen Medien (mit Laserabtastung) wie heute. Auch das ein paar verwirrende Druckfehler den Leser stören, gehört zu den Schwächen dieses Textes. Auf Seite 388 muss es z.B. statt „mit einem … Federhütchen und dem Kopf“ natürlich „auf dem Kopf“ heißen.
2) David J. Masson: Ablösung (Traveller’s Rest, 1965)
Der Soldat H kämpft in vorderster Front einen Grenzkrieg, von dem er nicht weiß, wer der Feind ist und wer ihn angefangen hat. Endlich wird er abgelöst und darf zurück in die Heimat. Erst den Berg hinab, weiter unter Beschuss, dann ins Teil, wo er seinen Kampfschutzanzug loswird und Zivilkleidung bekommt. Er kann sich jetzt an seinen Namen erinnern: Hadol oder Hadolaris, richtig? Der Zeitgradient scheint auch seine Erinnerung zu beeinflussen.
Ganz oben an der Bergfront ist die Zeit aufgrund der Konzeleration am dichtesten: Sie vergeht kaum. Je weiter er ins Tal und dann in die Ebene gelangt, desto mehr Zeit vergeht für ihn subjektiv. Deshalb versucht er auch, so weit wie möglich von der Front wegzukommen, um eben mehr Zeit für sein Leben zu haben. Nicht jeder wird abgelöst, das muss er ausnutzen. An der Südostküste findet er einen Job in einer Firma und steigt dort im Laufe der Jahre auf, die nun vergehen. Er gründet eine Familie und zieht drei Kinder groß, für deren Zukunft er mit seiner Frau Mihanya schon Pläne schmiedet.
Doch nach 20 Jahren holen sie ihn wieder: drei Soldaten, die ihm seinen Einberufungsbefehl zeigen. Er muss sofort mitkommen, ohne seine Familie zu benachrichtigen. Alles verläuft wieder umgekehrt. Die Konzeleration schlägt wieder zu: Im Bunker an der Front sind seit seiner Ablösung lediglich 22 Minuten vergangen, rechnet er nach. Jetzt ist er nur noch Had, dann bloß noch H, als er lossprintet, um seine Stellung zu erreichen.
Mein Eindruck
Die Parallelwelt, in der Hadolarison lebt, hat einige Ähnlichkeit mit den Vereinigten Staaten, doch es gibt einen gravierenden Unterschied: die Zeitgradienten zwischen der Grenze in den Bergen und dem Hinterland. Dadurch vergeht die Zeit unterschiedlich schnell und sehr relativ. Das betrifft sogar den Aufenthalt im Nordosten im Gegensatz zum Südosten.
Merkwürdig kommt es Hadolaris vor, dass an der Grenze der Gradient praktisch gegen unendlich geht, so dass dort fast keine Zeit vergeht. Es ist, als wäre die Grenze ein Spiegel. Und wenn das stimmt, dann wären die Geschosse, die der Feind abfeuert, im Grunde die eigenen. Als er diesen ketzerischen Gedanken äußert, wird ihm gesagt, er solle sich nicht lächerlich machen.
Besonders interessant fand ich, dass zusammen mit der Zeitdehnung auch der Name des Soldaten immer länger wird: von H zu Had zu Hadol zu Hadolaris zu Hadolarisón und so weiter. In umgekehrter Richtung verkürzt sich der Name bis hin zum Einzelbuchstaben H. Hadols Bezeichnung allerdings lautet XN2. Die Entpersönlichung, die hier angedeutet wird, ist ein typisches Merkmal militärischer Strukturen, wie sie etwa in Kubricks „Full Metal Jacket“ erschreckend dargestellt wurden. Der Mensch darf nicht als Individuum existieren, sondern muss als Rädchen im Getriebe funktionieren, und das geht nur, wenn er austauschbar ist: eine Nummer.
3) Roger Zelazny: Der Former (He Who Shapes, 1965)
Bedeutende Forschungen auf dem Gebiet der Psychiatrie haben zur Einführung einer neuen Technik, der Neuro-Partizipations-Therapie, geführt. Mit ihrer Hilfe kann der Therapeut direkt in das Unterbewusstsein des Patienten eindringen, von dort aus den Heilungsprozess beginnen und den Patienten langsam umformen. Ein solcher „Former“ ist Charles Render. Er spielt Gott, indem er realistische Traumwelten in der Psyche seiner Patienten modelliert, die, richtig angewendet, zur allmählichen Gesundung führen sollen. Bis eines Tages …
Dr. Eileen Shallot, eine blinde Psychiaterin, bittet Charles Render, ihr über den Umweg der Geistesverbindung das Sehen zu ermöglichen, ein lang gehegter Wunsch der Blinden. Trotz der Gefahren, welche die Therapie bei willensstarken Personen mit sich bringt – die von Geburt an blinde Eileen verfügt über ein Realitätsempfinden, das stark von der tatsächlichen Realität abweicht – ist Render bereit, die Therapie zu beginnen. Um Eileens geistige Gesundheit zu erhalten, muss er ihre ‚idyllische‘ Weltsicht durch das Aufzeigen realer Dinge korrigieren. Aber sie erweist sich als stärker als er und zieht ihn in ihre Traumwelt hinein, bis es für Render kein Entkommen mehr gibt. Der Psychiater endet im Wahn. Aber in einem schönen.
Mein Eindruck
Ist dies nun eine Drogenstory, die sich auf einen Trip begibt, wie ihn Timothy Leary mit Hilfe von LSD verwirklichen wollte und anpries? Oder geht es doch „nur“ um den inner space, also die Bewusstseinswelt, die ähnlich bizarr ausfallen kann wie eine fremde Welt? Darin folgt Zelazny der britischen New Wave und ihrem wichtigsten Autor J. G. Ballard.
Der Autor zieht C.G. Jungs Psychologie heran, um den Leser durch eine Galerie mythischer Elemente zu führen, die teils aus der Artussage, teils aus der nordischen Götterdämmerung stammen. Es ist ein ganz schön bunter Trip, voll faszinierender Erlebnisse, und manchmal wünschte ich mir, auch so einen Former zu kennen, der mal mein eigenes Unterbewusstsein aufräumen würde. Zelazny hat die Novelle zu einem Roman ausgebaut: „The Dream Master“ erschien 1966.
4) Alfred Bester: Die Mörder Mohammeds (The Men Who Murdered Mohammed, 1967)
Henry Hassel, Professor am Psychotic Center der Unknown University irgendwo im Mittelwesten, ist eifersüchtig: Er hat seine Frau Greta in den Armen eines Fremden entdeckt. Doch statt sie beide über den Haufen zu schießen, fällt ihm als verrücktes Genie etwas viel Besseres ein: eine Reise in die Zeit, um Gretas Vorfahrinnen zu töten. Die Zeitmaschine ist rasch erfunden und Großvater sowie Großmutter getötet. Der Effekt? Gleich null. Greta und der Fremde liegen sich weiterhin in den Armen.
Nach einem Anruf bei der Künstlichen Intelligenz Sam ändert Henry seine Methode: Er setzt auf Masseneffekte. Daher erschießt er als nächsten George Washington im Jahr 1775. Die Wirkung? Absolut null. Ebenso auch bei Napoleon, Mohammed, Caesar und Christoph Kolumbus. Woran kann es nur liegen, fragt er sich frustriert.
Ein Anruf bei der Bibliotheks-KI bringt ihn auf die Spur eines weiteren Zeitreise-Genies: Israel Lennox, Astrophysiker, der 1975 verschwand. Zudem erfährt er, dass auch der Liebhaber seiner Frau ein Zeitspezialist ist, William Murphy. Könnte er ihn ausgetrickst haben? Lennox belehrt Henry eines Besseren: Henry Problem liegt nicht an seiner Methode, sondern an der Natur der Zeit: Sie ist stets individuell. Eine Veränderung betrifft stets nur den Zeitreisenden selbst, nicht aber die anderen Zielpersonen. Und weil jeder „Mord“ den Zeitreisenden weiter von seinen Mitmenschen entfernt, ist Henry Hassel jetzt ebenso wie Israel Lennox ein Geist …
Mein Eindruck
Die Story ist zwar völlig verrückt, aber eminent lesbar, wie so häufig bei Alfred Bester. Neu ist hier das Konzept, dass Zeit völlig individuell sein soll. Jedem Menschen ist wie einer Spaghettinudel im Kochtop seine eigene Zeit zugewiesen (von wem, fragt man sich). Das macht die Einwirkung auf andere Zeit-Besitzer, quasi also auf andere Nudeln im Topf, unmöglich. Noch irrsinniger ist die Vorstellung, dass all die Versuche, auf andere einzuwirken, zum Verschwinden des „Mörders“ führen könnten. Aufgrund welcher Gesetzmäßigkeit? Hat es etwas mit Entropie zu tun? Der Autor erklärt mal wieder nichts, obwohl er mit Formeln um sich wirft, was den Spaß nur halb so groß werden lässt.
5) J. G. Ballard: Der Garten der Zeit (The Garden of Time, 1967)
Graf Axel lebt mit seiner klavierspielenden Frau in einer prächtigen Villa, zu der ein See und ein bemerkenswerter Garten gehören: In diesem Garten wachsen die Zeitblumen. Eine Zeitblume speichert in ihrer kristallinen Struktur Zeit und wenn Graf Axel eine Blüte bricht, so dreht er die Zeit ein wenig zurück, mal eine Stunde, mal nur wenige Minuten, je nach der Größe und Reife der Blume.
Diesmal bricht er wieder eine, denn über die Anhöhe des Horizonts drängt eine Lumpenarmee auf die Villa zu, die alles in ihrem Weg zu zertrampeln und zu zerstören droht. Schwupps, ist die Armee wieder auf den Horizont zurückgeschlagen. Aber das nicht ewig so weitergehen. Leider sind nur noch ein halbes Dutzend Zeitblumen im Garten der Zeit verblieben. Seine Frau bittet ihn, die letzte Blüte für sie übrigzulassen …
Als die Lumpenarmee den Garten erobert und die Villa plündert, findet sie nur noch eine Ruine vor, der Garten ist verlassen und verwildert. Nur mit größter Vorsicht umgehen die namenlosen Plünderer ein Dornendickicht, das zwei Steinstatuen umschließt: einen Mann und eine edel gekleidete Frau, die eine Rose in der Hand hält …
Mein Eindruck
Das Szenario des Grafen und seiner Gräfin in ihrem Garten aus konservierter Zeit sind eine elegische Metapher auf die gesellschaftliche Überholtheit der adeligen Klasse. Sie huldigt Idealen von Schönheit, die dem „Lumpenproletariat“ – ein begriff von Marx & Engels – völlig fremd sind. Dieses sucht lediglich materielle Werte, zerstört Bilder und Musikinstrumente ebenso wie Bücher, um Heizmaterial zu erhalten. Der Gegensatz ist klar: Bei den Adeligen bestimmt das Bewusstsein das Sein, bei den Proleten ist es umgekehrt: Der Materialismus triumphiert. Die hinfortgespülte Klasse existiert nur noch als Statuen, genau wie heutzutage.
Ein SF-Autor also, der der Revolution das Wort redet? Wohl kaum, denn sonst würde er den zerbrechlichen Zeitblumen solche schönen Worte widmen, die an Poesie nichts zu wünschen übriglassen. Er trauert den vergangenen Idealen nach, doch der Garten macht seine eigene Aussage: Sobald die letzte Blume vergangen ist, bricht die aufgeschobene Zeit mit aller Macht über die Adeligen herein und lässt sie zu Stein erstarren. Wie immer bei Ballard ist dieser abrupte Übergang überhaupt nicht kommentiert oder gar einer Erwähnung wert. Der Leser muss ihn sich dazudenken.
6) George R. R. Martin: Abschied von Lya (A Song For Lya, 1973)
Robb und Lyanna sind Talente – er kann Gefühle anderer erspüren, sie deren tiefste Gedanken. Auf Bitten des Planetaren Administrators der erst vor zehn Jahren erschlossenen Welt der Shkeen sollen sie herausfinden, was die menschlichen Siedler in die Arme der Religion der Ureinwohner treibt – und wie man dies verhindern kann. Denn bei dieser Religion geht es darum, sich mit einem Parasiten zu verbunden und nach Ablauf weniger Jahre sich in den Höhlen von Shkeen, einem Riesenparasiten, dem Greeshka, hinzugeben – und absorbiert zu werden.
Nicht auszudenken, wenn sich dieser Kult auf andere Welten der Menschheit ausdehnen würde. Immerhin hat sich Gustaffson, einer der Vorgänger des Administrators, diesem Kult angeschlossen. Und immer mehr Menschen scheinen ihm folgen zu wollen.
Robb findet einige Dinge an dieser Welt bemerkenswert. Die Zivilisation existiert hier bereits 14.000 Jahre, ist also weitaus älter als die menschliche, doch sie befindet sich auf dem Niveau unserer Bronzezeit. Zudem glauben die Shkeen weder an ein Jenseits noch an einen Gott, sondern lediglich an das Glück der Verbundenheit mit dem Greeshka und an die abschließende Vereinigung. Aber was haben sie davon? Und warum sind die „Verbundenen“ so glücklich?
Als sich Robb und Lyanna mit dem Seelenleben der Verbundenen befassen und sogar auf Gustaffson selbst stoßen, müssen sie sich mit einem grundlegenden Problem aller denkenden und fühlenden Lebewesen auseinandersetzen: dass das fortwährende Alleinsein nur durch die Liebe oder den Tod überwunden werden kann. Was aber, wenn Liebe und Tod ein und dasselbe sind?
Mein Eindruck
Dieser detailliert geschilderte Kurzroman ist wunderbar zu lesen, denn der Autor befasst sich sehr eingehend mit dem Gefühlsleben des zentralen Liebespaares und dem Dilemma, in dem es sich plötzlich wiederfindet. Denn Lya hat im Geist der Verbundenen von dem Glück gekostet, das die Vereinigung mit dem Greeshka spendet.
Dieses Glück besteht offenbar nicht nur in der grenzenlosen Liebe der Vereinigung, die über die Liebe zu Robb hinausgeht, sondern auch in der Überwindung des Todes und der irdischen Begrenztheit. Kurzum: Sie ist mit einem Gott vereint, wenn sie den Übergang wagt. Aber dafür muss sie Robb verlassen, falls er ihr nicht folgt. Wie wird er sich entscheiden?
Die zunehmend elegische Stimmung ist charakteristisch für die tiefschürfenden Erzählungen des frühen George R. R. Martin. Sie brachten ihm zahlreiche Auszeichnungen und wirtschaftlichen Erfolg ein – bis er dann Drehbuchautor wurde. Aus dieser Erfahrung wiederum erwuchs ihm die Routine, um das gewaltige Epos von Winterfell zu erschaffen, das in der deutschen Ausgabe etwa zehn Bände umfasst – und offenbar immer noch nicht abgeschlossen ist.
7) Ursula K. Le Guin: Das Tagebuch der Rose (The Diary of the Rose, 1976)
Dr. Rose Sobel ist medizinische Psychoskopin und hat die Aufgabe, das Bewusstsein von Patienten ihrer Vorgesetzten Dr. Nades zu untersuchen, d. h. sowohl die bewusste als auch die unbewusste Ebene. Die neuesten Patienten sind die depressive Bäckerin Ana Jest, 46, und der paranoide Ingenieur Flores Sorde, 36, ein angeblich psychopathischer Gewalttäter.
Ana Jest bietet keinerlei Überraschungen, was man von F. Sorde nicht behaupten kann. Nicht nur ist er ein überaus verständiger, friedlicher und intelligenter Mann, sondern bietet Dr. Sobel auch ein besonderes Erlebnis: Aus seinem Bewusstsein generiert er das perfekte Abbild einer großen roten Rose, wie sie Dr. Sobel noch nie gesehen hat. Was hat das zu bedeuten? Doch das weitere Vordringen verhindert Sordes deutliche Blockade: „ZUTRITT VERBOTEN!“
Sobel beschwert sich über dieses Ausgeschlossenwerden und Sorde muss ihr erklären, wovor er Angst hat: vor dem Eingesperrtsein, vor Gewalt, vor Unfreiheit und vor allem vor dem Vergessen, das die Elektroschocktherapie bringen wird. Sie dementiert, dass es eine ETC geben werde, doch er lächelt nur über ihre Naivität. Sie mag ja eine Diagnose stellen, aber die Entscheidung über die Behandlung treffen andere, so etwa Dr. Nades. Oder die TRTU, was wohl die Geheime Staatspolizei ist. Durch Einblicke in seine Kindheit erkennt sie, wonach er sich sehnt: nach einem Beschützer, der ihm alle Angst nimmt. Seine Idee von Demokratie demonstriert er mit dem letzten Satz von Beethovens neunter Sinfonie: Brüderlichkeit, Freiheit usw. Au weia, denkt, Rose, er ist also doch ein gefährlicher Liberaler.
Dennoch schafft sie es, ihn aus der Abteilung für Gewalttäter in die normale Station für Männer verlegen zu lassen. Dort lernt er Prof. Dr. Arca kennen, den Autor des Buches „Über die Idee der Freiheit im 20. Jahrhundert“, das Sordes gelesen hat. Das war, bevor es verboten und verbrannt wurde. Prof. Arca hat durch die Elektroschocktherapie sein Gedächtnis verloren. Sordes befürchtet stark, dass er genauso werden wird wie Arca. Rose ist verunsichert. Sie versteckt ihr Tagebuch. Denn dieses Tagebuch enthält auch ihre eigenen geheimen Gedanken und Gefühle, und wer weiß schon, was die TRTU davon hielte?
Mein Eindruck
Rose Sobel denkt, sie wäre eine unbeteiligte Beobachterin, wenn sie einem Menschen ins Bewusstsein blickt. Aber das ist, wie wir durch Heisenbergs Unschärferelation wissen, eine Selbsttäuschung. Der Beobachter beeinflusst das zu Beobachtende und umgekehrt. Ganz besonders bei Menschen. So kommt Rose nicht umhin, von Sordes beeinflusst zu werden, und sich verbotene Fragen zu stellen. Fragen, die auch die klugen Ratgeber, die ihre Chefin empfiehlt, nicht beantworten: Warum haben alle so viel Angst?
Dass etwas mit ihrer eigenen Welt nicht in Ordnung sein könnte, geht ihr nur allmählich auf. Dass die TRTU ihren Patienten vielleicht völlig grundlos wegen „Verdrossenheit“ eingewiesen hat und ihn schließlich fertigmachen will, entwickelt sich nur allmählich zur schrecklichen Gewissheit. Ebenso wie die Erkenntnis, dass es keine unpolitische Psychiatrie mehr geben kann. Deshalb will sich Rose zur Kinderklinik versetzen lassen. Ob dort die Patienten weniger Angst haben werden?
Die Erzählung ist typisch für Le Guin: Sie zeigt die politische, ethische und zwischenmenschliche Verantwortung der Mitarbeiterin in der staatlichen Psychiatrie auf. Diese Verantwortung ist auf heutige Verhältnisse zu übertragen, falls es dazu kommt, dass in den USA ein Polizeistaat errichtet wird. Und wenn man den Patriot Act von 2001 mal genau durchliest, dann kann es sehr leicht dazu kommen. Ich liebe solche warnenden Geschichten. Sollen sie mich doch dafür einsperren und „therapieren“ …
8) John Varley: Die Trägheit des Auges (The Persistence of Vision, 1977)
Ende des 20. Jahrhunderts herrscht in den USA mal wieder Wirtschaftskrise, zumal der Raktor von Omaha in die Luft geflogen ist und eine verstrahlte Zone erzeugt hat, den China-Syndrom-Streifen. Unser Glückssucher, der sich von Chicago gen Kalifornien aufgemacht hat, passiert die Flüchtlingslager von Kansas City, die nun als „Geisterstädte“ tituliert werden. In der Gegend von Taos, New Mexico, lernt er zahlreiche experimentelle Kommunen kennen, wo man leicht eine kostenlose Mahlzeit bekommen kann. Von den militanten Frauenkommunen hält er sich klugerweise fern.
Auf dem Weg nach Westen stößt er mitten im Nirgendwo auf eine Mauer. So etwas hat er im Westen höchst selten gesehen, so dass er neugierig wird. Ein Navaho-Cowboy erzählt ihm, hier würden taube und blinde Kinder leben. Eisenbahnschienen führen um das ummauerte Anwesen herum, so dass er ihnen einfach zum Eingang folgen kann. Dieser ist offen und unbewacht, was er ebenfalls bemerkenswert findet. Gleich darauf erspäht er mehrere Wachhunde.
Um ein Haar hätte ihn die kleine Grubenbahn überfahren, die von einem stummen Fahrer gesteuert wird. Dieser entschuldigt sich überschwenglich und vergewissert sich, dass dem Besucher nichts passiert ist. Dieser versichert ihm, dass dem so ist. Der Fahrer schickt ihn zu einem Haus, in dem Licht brennt. Der Besucher bemerkt, wie schnell sich die blinden und tauben Bewohner der Kuppelgebäude bewegen. Sie tun dies aber nur auf Gehwegen, von denen jeder seine eigene Oberflächenbeschaffenheit aufweist. Unser Freund nimmt sich vor, niemals einen solchen Gehweg zu blockieren.
In dem erleuchteten Gebäude gibt es etwas zu essen. Er muss sich jedoch von vielen Bewohnern abtasten lassen. Sie sind alle freundlich zu ihm. Ein etwa 17-jähriges Mädchen, das sich weigert, wie die anderen Kleidung zu tragen, erweist sich als sprech- und sehfähig, was ihm erst einmal einen gelinden Schock versetzt. Sie nennt sich Rosa und wird zu seiner Führerin und engsten Vertrauten, schließlich auch zu seiner Geliebten.
Im Laufe der fünf Monate seines Aufenthaltes erlernt er die internationale Fingergebärdensprache, aber er merkt, dass die anderen noch zwei weitere Sprachen benutzen. Das eine ist die Kurzsprache, die mit Kürzeln arbeitet, die nur hier anerkannt sind. Die andere, viel schwieriger zu erlernende ist die Einfühlungssprache, die sich jedoch von Tag zu Tag ändert.
Als er sie schließlich entdeckt, ahnt er, dass er sie nicht wird völlig erlernen können. Denn dazu müsste er ja selbst blind und taub sein. Und dass die Sprache des Tatens auch den gesamten Körpers umfasst, versteht sich von selbst. Deshalb gehört auch die körperliche Liebe dazu.
Eines Tages erfährt er, welche Stellung er in der Kommune einnimmt. Er stellt aus Gedankenlosigkeit einen gefüllten Wassereimer auf einem der Gehwege ab und widmet sich seiner Aufgabe. Als ein Schmerzensschrei ertönt, dreht er sich um, nur um eine weinende und klagende Frau am Boden liegen zu sehen. Aus ihrem Schienbein, das sie sich am Eimer gestoßen hat, quillt bereits das Blut. Es ist die Frau, die ihn als Erste in der Kommune begrüßt hat. Nun tut es ihm doppelt leid, und er ist untröstlich. Doch Rosa informiert ihn, dass er sich einem Gericht der ganzen Kommune von 116 Mitgliedern stellen muss …
Mein Eindruck
Die vielfach ausgezeichnete Erzählung stellt dar, wie sich allein aus der Kommunikation eine utopische Gemeinschaft entwickeln lässt. Dass natürlich auch ökonomische, legale und soziale Randbedingungen erfüllt sein müssen, versteht sich von selbst, aber dass Außenseiter ihre eigene Art von Überlebensstrategie – in einer von Rezession und Gewalt gezeichneten Welt – entwickeln, schürt die Hoffnung, dass nicht alles am Menschen schlecht und zum Untergang verurteilt ist.
Der Besucher, ein 47-jähriger Bürohengst aus Chicago, findet in der Gemeinschaft der Taubblinden nicht nur sein Menschsein wieder, sondern auch eine Perspektive, wie er in der Außenwelt weiterleben kann. Er arbeitet als Schriftsteller, und dessen Job ist die Kommunikation.
Neben den drei Ebenen der Sprache, die die Taubblinden praktizieren, gibt es noch eine Ebene der Verbundenheit, die er nur durch die Zeichen +++ ausdrücken kann. Auf dieser Ebene findet mehr als Empathie statt, weniger als Telepathie. Aber es ist eine Ebene, erzählt ihm Rosa bei seiner Rückkehr, die es den Taubblinden (zu denen sie und die anderen Kinder nicht zählen) erlaubt hat, zu „verschwinden“. Wohin sind sie gegangen, will er wissen. Niemand wisse es, denn sie verschwanden beim +++en.
Es handelt sich also eindeutig um eine SF-Geschichte, nicht etwa um eine Taubblindenstudie, die in der Gegenwart angesiedelt ist. Für ihre Zeit um 1977/78 war die Geschichte wegweisend. Nicht nur wegen des Gruppensex und die Telepathie, die an das „Groken“ in Heinleins Roman „Fremder in einem fremden Land“ erinnert. Auch Homosexualität wird behandelt – und in der Geschichte praktiziert.
Wichtiger als diese Tabuthemen ist jedoch der durchdachte ökologische Entwurf für die Kommune und die Anklage gegen die Vernachlässigung bzw. Fehlbehandlung der Taubblinden – nicht nur in den USA.
9) James Tiptree alias Alice Sheldon: Geteiltes Leid (Time-Sharing Angel, 1977)
Die 19-jährige Jolyone Schram liebt die Natur und arbeitet in Los Angeles beim Rundfunksender. Dieser Sender ist neu, liegt auf einem hohen Berg und verfügt über die stärkste Sendeleistung der Stadt. Wahrscheinlich deshalb kann es an diesem zu dem ungewöhnlichen Ereignis kommen.
Erst hat Jolyone, die in einer Zahnfüllung einer Sender empfängt, eine schreckliche Vision: Die Erdoberfläche wird unter Massen von Menschen begraben. Als ein SF-Autor im Sender die finstere Zukunft der Menschheit ausmalt, hält Jolyone gerade ein Stromkabel in der Hand. Erschüttert fleht sie zu Gott, er möge all dies aufhalten. Eine unbekannte Stimme antwortet ihr auf ihrem gefüllten Zahn, dass das in Ordnung gehe.
Schon bald machen sich die ersten Anzeichen des Wirkens des Engels bemerkbar. Von jeder Familie, und sei sie noch so groß und verbreitet, bleibt nur das jüngste Kind bei Bewusstsein, alle anderen fallen in Tiefschlaf. Weltweite Panik! Doch nach ein paar Tagen verbreitet sich die Kunde von einem wieder erwachten Kind irgendwo in West-Virginia. Ein Mathegenie berechnet die Arithmetik: Wenn Mrs. McEvoy 26 Kinder hat, dann jedes davon nur etwa 14 Tage im Jahr wach sein (weil zweimal 26 genau 52 Wochen = 1 Jahr ergibt). Wer zwei Kinder hat, der kann sich an sechs Monaten Wachsein der Kinder erfreuen und so weiter. Dieser Effekt hat eine verblüffende Folge: Da nur das Wachsein als Lebenszeit zählt, können die Schläfer bis zu 3000 Jahre alt werden!
Die Welt verändert sich beträchtlich, das Wachstum kommt zu einem knirschenden Halt, Wirtschaften brechen fast zusammen, doch die Ressourcen bleiben erhalten. Die Ich-Erzählerin trifft eines Tages Jolyone im Park, und diese erzählt ihr alles. Endlich darf sich Jolyone auf die Zukunft freuen.
Mein Eindruck
Die Autorin Alice Sheldon hat die Erde schon viele Male untergehen lassen. Hier gewährt sie ihr wenigstens eine Gnadenfrist, eine Art Nothalt. Die Geschichte mit den Schläfern erinnert an die Romane von Nancy Kress, in denen eine Schläfer-Generation dem alten Homo sapiens Konkurrenz macht. Allerdings handelt es sich um Leute, die keinen Schlaf benötigen, also pro Tag acht Stunden mehr zur Verfügung haben. Auch daraus ergeben sich diverse Folgen.
10) Dean R. Lambe: Tefé Lauswurz (Damn Shame, 1979)
Die zwei amerikanischen Studienfreunde Albert und Frederick haben verschiedene Wege in der Medizin eingeschlagen. Al wurde Allgemeinarzt in Wisconsin, Fred ist in Kalifornien in die Krebsforschung gegangen. Nun meldet Fred in einem Brief den Durchbruch: Die Versuchsreihe mit dem Präparat AC337 führt zu sagenhaften Remissionen bei den Krebszellen! Das haut Al noch nicht vom Hocker. Erst als er zwei Patienten mit Krebs im Endstadium bekommt, wendet er sich an Fred. Die nicht ganz legal gelieferte Menge reicht aus, um eine vollständige Heilung zu bewirken.
Al ist hin und weg. Doch dann schreibt er Fred, dass seine Frau Ruth Brustkrebs im Anfangsstadium habe. Er brauche mehr von AC337. Fred schreibt seinen Lieferanten an, doch der muss passen: von dem pflanzlichen Grundstoff werde aus Brasilien nichts mehr geliefert, v. a. wegen der anti-amerikanischen Unruhen. Es gebe aber noch einen Arzt …
Leider ist auch dieser Arzt verstorben, erfährt Fred. Dr. Linhares habe sich umgebracht, als der große Amazones-Staudamm geflutet wurde – und damit auch das winzige Vorkommen des pflanzlichen Wunderstoffs von AC337 …
Mein Eindruck
Die Moral von der Geschicht‘ ist einfach: Die Menschheit opfert ihre Gesundheit dem Gott des Fortschritts. Ein soeben entdecktes Krebsheilmittel wird für immer unter den Fluten des Amazones-Stausees verschwinden. Die bittere Ironie dieser Erkenntnis wird konterkariert von der freundschaftlichen Verbindlichkeit, die sich im Schriftverkehr der beiden Freunde spiegelt. Dort scheint die Welt in Ordnung zu sein. Doch draußen, wo fremde Kräfte walten, ist sie es nicht. Eine Geschichte, die uns zur Warnung dienen sollte. Denn weiterhin werden Wälder vernichtet – und mit ihnen Heilmittel.
11) Michael Swanwick: Der blinde Minotaurus (The Blind Minotaur, 1984)
Der blinde Minotaurus ist ein Unsterblicher auf einer Menschenwelt in ferner Zukunft. Nachdem er seinen Freund, den Harlekin bei einer Gauklertruppe, in der Arena aufgrund einer Hormonmanipulation getötet hat, reißt er sich zur Selbstbestrafung die Augen heraus. Geblendet nimmt ihn seine Tochter Schafgarbe an der Hand. Doch wo ist ihre Mutter?
Er sitzt von nun an als Bettler am Straßenrand. Doch die Herrschaft der Adligen wankt. Vorbei sind die Zeit, da sie von allen als überlegen angesehen wurden, und seltsame Sekten und Rebellen gedeihen im entstehenden Chaos. Unter den Attacken junger Tunichtgute und seltsamen Sekten leidend, richtet sich der blinde Unsterbliche zum Protest auf. Er ruft die Bürger dazu, ihre Freiheit zu verteidigen. Im Hafenviertel erzählt er seiner Tochter und den anderen Bürgern der Stadt, was mit ihm geschah und wie es dazu gekommen konnte.
Mein Eindruck
Der Autor Michael Swanwick erzählt häufig Geschichten von Außenseitern. Hier schildert er in Rückblenden die Geschichte eines Unsterblichen, der in eine Art Umsturzbewegung gerät. Aus den Momentaufnahmen muss sich der Leser selbst ein Bild dessen zusammensetzen, was eigentlich passiert. Die Handlung verläuft aufgrund der Rückblenden auf zwei verschiedenen Zeit-Ebenen, und so heißt es aufpassen, auf welcher man sich gerade befindet.
Einer der wichtigsten Aspekte des Minotaurus ist seine sexuelle Potenz. Deshalb beglückt er auch in seinem sehenden Leben zahlreiche Frauen. Das eigentliche Rätsel besteht nun in dieser Hinsicht darin, wie es zur Zeugung seiner Tochter kommen konnte, wenn er doch, wie er sagt, stets „vorsichtig“ war. Könnte die Lady mit der Silbermaske, die ihm zweimal begegnet, die Mutter Schafgarbes sein?
Auch die Sache mit den Hormonen und Pheromonen bildet ein interessantes Element. Und für den Blinden ist das Riechen einer der wichtigsten Sinne geworden. So führt uns die Geschichte in zwei Welten, in die vor und die nach der Blendung der Hauptfigur.
12) David Brin: Thor trifft Captain Amerika (Thor Meets Captain America, 1986)
Man schreibt den Spätherbst des Jahres 1962, und noch immer wütet der Zweite Weltkrieg zwischen den Nazis und den Alliierten. Der Grund: anno ’44, kurz vor der Invasion der Normandie, als der Krieg bereits gewonnen schien, erschienen die Fremdweltler in Gestalt der nordischen Götter, der Asen. Der Gott der Stürme fegte die riesige Armada von der Oberfläche des Ärmelkanals. Thor zerschlug die vorgerückten Armeen der Russen, so dass sich in Israel-Iran das Zentrum des Widerstands bildete.
Doch es gibt seit 1952 einen Helfer auf Seiten der Alliierten, mit dem man nicht gerechnet hat: Loki, der Gott des Trugs. Er war es, der die Amis vor dem Einsatz der H-Bombe warnte, denn der Nukleare Winter würde auch sie vernichten. Nun haben die Amis in einer letzten verzweifelten Aktion ein Dutzend U-Boote ausgesandt, um die Asen in ihrem Zentrum anzugreifen, auf der schwedischen Insel Gotland. Vier sind davon noch übrig, und in einem davon sitzt Loki neben Captain Chris Turing, dem Leiter dieses Himmelfahrtskommandos. Sie haben eine zerlegte H-Bombe bei sich, um die Unsterblichen ins Jenseits zu blasen.
Doch die zusammengewürfelte Truppe des Kommandos wird entdeckt, und die Dinge entwickeln sich völlig anders als geplant. Hat Loki sie etwa verraten?
Mein Eindruck
Dieser Alternativgeschichtsentwurf ist an die Marvel-Comics angelehnt, deren Verfilmungen wir ironischerweise jetzt erst in den Kinos besichtigen dürfen – ein Vierteljahrhundert nach dieser Pastiche. Oder sollte ich sagen „Persiflage“? Denn weder Thor ist der aus den Comics, sondern ein echter Alien, der nicht mal ein Raumschiff brauchte, um zur Erde zu gelangen. Und wer ist der „Captain America“ des Titels? Natürlich Catain Chris Turing – ein Kerl, der von Dänen abstammt statt von echten Amis.
Allerdings ist das Szenario angemessen grimmig. Nazis überall, vor allem Totenkopf-SS, die dem Asen- wie dem Todeskult anhängt, und natürlich nordische Priester – für die Blutopferzeremonie. Aber diese Wichte haben bei den Asen, die sie gerufen haben, nichts mehr zu melden. Sie machen dementsprechend säuerliche Mienen zur Opferzeremonie.
Da die Lage sowieso aussichtslos ist, kommt es für Chris Turing auf einen guten Abgang an. Er überlegt sich, was es sein könnte, das die Asen so mächtig macht. Als er auf den Trichter kommt – dank eines kleinen Hinweises von Loki -, fällt ihm auch das einzige passende Gegenmittel ein, das dagegen hilft: Gelächter …
Entfernt man all diesen mythologischen Überbau, bleibt eine zentrale Szene übrig: Ein jüdischer KZ-Insasse, der den sicheren Tod schon vor Augen hat, lässt die Hose herunter und zeigt seinen Mörder den Hintern und ruft: „Kiss mir im Toches!“ Na, das nenn ich mal Todesverachtung.
13) Kim Stanley Robinson: Der blinde Geometer (The Blind Geometer, 1987)
Carlos Nevsky ist von Geburt an blind und hat sich mit seiner „Behinderung“ ausgezeichnet eingerichtet, ja, er ist sogar Professor für Geometrie an einer Washingtoner Universität geworden. Sein räumliches Vorstellungsvermögen ist ausgezeichnet. In letzter Zeit fällt ihm auf, dass sein Kollege Jeremy Blasingame ihn auffällig aushorcht, wie dieser glaubt. Dann tauchen Carlos‘ Ideen in dessen Veröffentlichungen auf – sicher kein Zufall, oder?
Carlos ist ein begieriger Leser alter Detektivgeschichten, insbesondere über Carrados, den blinden Detektiv. Was also lässt sich aus Jeremys Verhalten deduzieren? Dass er in jemandes Auftrag handelt? Carlos weiß, dass Jeremy mit dem militärischen Geheimdienst im Pentagon zu tun hat. Aber was hat das Pentagon, das sich ja vor allem für Waffen interessiert, mit n-dimensionaler Vervielfältigungsgeometrie am Hut?
Eines Tages gibt ihm Jeremy eine geometrische Zeichnung. Sie stamme von einer Frau, die gerade verhört werde. Alles gedruckte kopiert Carlos mit seinem Spezialkopierdrucker in Braille-Schrift. Die Zeichnung ist nichts besonderes, nur etwas Grundlegendes. Er besteht darauf, die Frau persönlich zu sprechen. Jeremy bringt sie und stellt sie als Mary Unser vor, eine angebliche Astronomin. Ihre Ausdrucksweise ist ungrammatisch. Ist das Absicht? Kann er ihr trauen? In einem unbeobachteten Augenblick, als Jeremy Trinkwasser holt, gibt Mary Carlos Signale per Handdruck. Was will sie ihm sagen?
Allmählich weiß Carlos, dass etwas nicht stimmt, und entdeckt zwei Abhörgeräte in seinem Büro. Er kauft sich selbst eine Wanze, die er in Jeremys Büro platziert. Dieser telefoniert mit einem Mann in Washington, der sich nie identifiziert. Um mehr herauszufinden, macht sich Carlos an Mary heran. Aber auch jetzt muss er sich fragen, ob sie verdrahtet ist. Erst während eines heftigen Gewitters, das alle Abhörgeräte außer Gefecht setzt, kann sie ihm die erstaunliche Wahrheit anvertrauen …
Mein Eindruck
Dieser Blinde ist so ziemlich das Gegenteil von der Blindenkolonie in John Varleys Erzählung „Die Trägheit des Auges“. Sogar dessen Heldin Helen Keller (1880-1968) wird als textbesessene Träumerin kritisiert, die viktorianische Wertvorstellungen nachhing. Dagegen nimmt sich Carlos Nevsky doch ziemlich modern aus. Wenn er auch eine eigene virtuelle Welt in seinem Kopf errichtet hat, so weiß er sich doch in der sogenannten Realität ausgezeichnet zu bewegen, denn auch davon hat er ein geometrisch exaktes Abbild in seinem Gedächtnis gespeichert.
Doch all dies gerät durcheinander, als ihm Jeremy eine Wahrheitsdroge verabreicht, die ihn dazu bringen soll, seine kühnsten Entwürfe offenzulegen. Das passiert zwar nicht, aber Carlos wankt dennoch völlig desorientiert durch Washingtons Straßen. Und dann ist da ja noch Mary, die ihn seelisch schwer aus dem Gleichgewicht bringt. Mir ihr zu schlafen, ist nicht schwer, doch kann er ihr auch sein Leben anvertrauen?
In einem dramatischen Showdown zeigt sie ihm, was sie drauf hat: Zwei Blinde gegen drei bewaffnete Männer – ob das wohl gut geht? (Denn dass auch sie blind sein muss, ahnen wir von Anfang an.)
14) Bruce Sterling & Lewis Shiner: Mozart mit Spiegelbrille (Mozart In Mirrorshades, 1985)
Die Zeitreisenden aus der Zukunft haben die Festung Hohensalzburg als Stützpunkt eingenommen, um von hier die Stadt Salzburg in den Griff zu bekommen. Rice, der Ingenieur, hat eine Ölraffinerie hingestellt, so dass nun Pipelines durch die Gassen bis ins Zeitportal führen – in die Zukunft. Im Gegenzug haben die Zeitreisenden den Einheimischen alle Segnungen amerikanischer Kultur zugutekommen lassen: Bars, Klubs, Elektronik, Drinks, Klamotten, Musik – einfach alles. Das 18. Jahrhundert wird nie mehr sein, wie es mal war. Sogar die Französische Revolution ist fast unblutig verlaufen, und Thomas Jefferson ist der erste Präsident der USA – von Zukunfts Gnaden.
Wolfgang Amadeus Mozart ist der spezielle Schützling Rices und übt schon mal, seine Art von Pop mit den Mitteln der Zukunft herzustellen. Parker wird sein Manager und sagt ihm eine große Zukunft voraus. Mozart schwärmt Rice von Maria Antonia alias Antoinette vor, der Tochter der Kaiserin Maria Theresia, die jetzt, nach der Revolution, wohl in Versailles ein bisschen sein könnte. Prompt macht sich Rice auf den Weg und verliebt sich in das Luxus-Hippie-Girl.
Doch zehn Tage später kommt ein Video-Anruf von Mozart: In Salzburg sei die Kacke am Dampfen, die Raffinerie unter Beschuss, die Trans Temporal Army verteidige die Festung, deren Kommandantin Sullivan unter Kuratel gestellt worden sei. Als sich Rice in panischer Hast auf den Weg von Versailles nach Salzburg macht, trickst ihn Marie Antoinette aus und so fällt er den Masonisten-Freischärlern in die Hände. Wird Rice es jemals zurück in die Zukunft schaffen?
Mein Eindruck
Auch diese Story über einen alternativen Geschichtsverlauf bringt richtig Schwung in die Lektüre. Da trifft das bekannte Inventar des ausgehenden 18. Jahrhunderts auf die modernen USA, abgesehen mal vom Zeitportal, und im fröhlichen Culture Clash entstehen skurrile Szenen. Diese Story nimmt Sophia Coppolas Film über Marie Antoinette schon um Jahre vorweg. Und Mozart wird zum Popstar der Zukunft, so wie er das ja schon zu seiner Zeit war.
Zeitparadoxa – was soll damit sein? Der Zeitverlauf, erfahren wir, hat sowieso zahlreiche Verzweigungen, wie ein Baum Äste. Deswegen mache die Kontamination DIESES 18. Jahrhunderts den vielen anderen 18. Jahrhunderten gar nichts aus. Klar soweit? Und man kann sogar zwischen verschiedenen Zeitzweigen wechseln. Daher auch das Auftauchen der Trans Temporal Army.
Im Grunde jedoch zeigen die Autoren anhand der Kulturinvasion der modernen USA, wie ja vielfach in den Achtzigern zu beobachten, verheerende Auswirkungen auf die lokale Kultur – auch im soziopolitischen Bereich. So entsteht etwa die Widerstandsbewegung der Freimaurer alias Masonistas, gegen die Thomas Jefferson schon wetterte. Und es gibt die Trans-Temporalarmee, die sich als eine Art Sechste Kolonne der Manager aus der Zukunft engagiert – und so Rices Hintern rettet. Insgesamt also ein richtiger Dumas’scher Abenteuerroman, auf wenige Seiten komprimiert.
15) Karen Joy Fowler: Der Preis des Gesichts (Face Value, 1986)
Der Alien-Forscher Taki und seine Frau, die Dichterin Hesper, sind auf die neu entdeckte Welt der Meine gekommen, um diese rätselhaften Wesen zu erforschen. Unter dem Doppelsternsystem ist es heiß und staubig, doch den insektenartigen Menen macht das nichts aus. Die fliegenden Wesen mit den Flügelzeichnungen, die wie Gesichter aussehen, leben in unterirdischen Tunnelsystemen, deren Mittelpunkt Taki noch nicht hat erreichen können. Das frustriert ihn. Die Art und Weise ihrer Kommunikation könnte Telepathie sein.
Ebenso frustriert ist er vom Verhalten seiner Frau. Sie weint der Erde hinterher, besonders ihrer längst verstorbenen Mutter, die sie sehr liebt. Sie schreibt kaum noch Gedichte, und auch lieben will sie sich nicht mehr lassen. Nach einem weiteren zudringlichen Besuch eines Mene-Schwarms verliert sie nicht nur die Beherrschung. Sie verliert buchstäblich den eigenen Verstand. Aus ihrem Mund sprechen nun die Mene: „Wir haben sie. Wir können verhandeln …“
Mein Eindruck
Mit in der SF seltener Feinfühligkeit stellt die amerikanische Autorin den Prozess dar, wie einer sensiblen Frau der Verstand geraubt wird. Das geht überhaupt nicht gewaltsam vor sich, sondern ganz sachte, fast unmerklich für Taki. Bis es auf einmal zu spät ist. Die Kommunikation verläuft in beide Richtungen, sagt er, deshalb müssen die Menschen für die Mene zugänglich sein.
Doch die Identität einer Frau scheint sich von der eines Mannes zu unterscheiden. Eine Frau wie Hesper stört es, wenn die Mene ihre Fotos, Gedichte, ihren Schmuck und ihre Kleider durchwühlen. Nicht so bei Taki, der gleichmütig hinnimmt, wenn Mene seine Bänder mitnehmen und bald wieder in den Staub fallen lassen. Ding für Ding, Stück für Stück nehmen die telepathischen Mene also die Identität Hespers an sich. Dadurch wird die Geschichte zu einer Demonstration über den Geschlechterunterschied, vor allem in psychologischer Hinsicht.
16) Lucius Shepard: R & R (R & R, 1986) = [Life During Wartime]
Diese mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Novelle bildet das Mittelstück von Shepards Roman „Das Leben im Krieg“ (Life During Wartime, 1987).
Es geht um kein triviales Thema, sondern quasi um „Apocalypse Now“ in Mittelamerika, im Dschungel Nicaraguas und El Salvadors, als die Reagan-Truppen die kommunistischen Sandinistas bekämpften. David Mingolla ist einer der amerikanischen Soldaten, Durchschnitt, er versucht, die Hölle des Krieges zu überleben. Seinesgleichen versucht mit Drogen vollgepumpt und im Direktkontakt mit ihrer Elektronik ihrer Waffen, gleichen sie eher Kampfmaschinen als Menschen. Die Grenzen zwischen Gut und Böse, zwischen Liebe und Haß und zwischen Mythos und Realität lösen sich auf – alles wird möglich, alles ist relativ.
Was von den Soldaten übrig bleibt, falls sie die sinnlosen Gefechte und Massaker an der Zivilbevölkerung überleben, sind leergebrannte Zombies. Sie werden nie mehr fähig sein, in ein normales bürgerliches Leben zurückzukehren, es sei denn, sie springen rechtzeitig ab und desertieren. Mingolla aber desertiert nicht, sondern schlägt sich durch. Bis er schließlich zu seinem Entsetzen herausfindet, dass der Krieg nur die Fortsetzung einer jahrhundertelangen Blutfehde zweier verfeindeter mittelamerikanischer Familien ist, zwar mit anderen Mitteln, aber immerhin: Die Weltmacht USA als Handlanger von Provinzfürsten mit privaten Rachegelüsten!
Mein Eindruck
Shepards Interesse gilt nicht so sehr den (waffen-) technischen, militärischen oder wirtschaftlich-sozialen Aspekten dieses speziellen Krieges, den er schon 1984 in seiner Story „Salvador“ verarbeitete. Es geht um die Psyche, die sich in diesem Hexenkessel verändert – bis zur Unkenntlichkeit. Hier findet der amerikanische Traum sein Ende: im Dschungel, im Drogenrausch, im Kampf mit einem Jaguar, unter dem Einfluss eines Voodoo-Magiers, kurz: im Herzen der Finsternis.
17) Walter Jon Williams: Dinosaurier (Dinosaurs, 1987)
Der irdische Botschafter Drill landet auf dem Planeten der Shar, um Friedensverhandlungen zu führen. Die Shar, mit denen er sich per Übersetzungsgerät verständigt, sind pelzige, dreibeinige Wesen mit großen Augen, spitzer Schnauze und einer komplexen Sozialstruktur. Ihre Präsidentin Gram begrüßt Drill. Der massige Zweibeiner mit seiner schwarzen Haut und dem langen Penis zwischen den Beinen hört auf seine zwei eingebauten Gehirne, das Metahirn im Beckenbereich und die Erinnerung im Kopf. Die Erinnerung sagt ihm, dass er sich diplomatisch verhalten soll.
Und bald stellt sich in den Verhandlungen heraus, dass die Shar bereits Millionen Opfer auf ihren Welten zu beklagen haben. Der Grund sind die Terraformerschiffe der „Menschen“, die nicht intelligent genug sind, um die Shar als intelligente Rasse zu identifizieren nund zu respektieren. Daher wurden sie als Schädlinge „exterminiert“.
Als die Präsidentin, die mehr Geduld als ihre Minister aufbringt, nachhakt, was denn diese Unterscheidung zwischen intelligent und nicht-intelligent zu bedeuten habe, antwortet ihr Drill in aller Unschuld, dass dies eine Folge der Spezialisierung sei. Nach acht Millionen Jahren habe sich die menschliche Rasse eben zwangsläufig in spezialisierte Unterspezies aufgespalten. Manche davon, wie die Terraformer, benötigen für ihre Tätigkeit nur einfach Instruktionen, andere, wie die Diplomaten, benötigten beispielsweise auch eine komplexe Erinnerung, also die gesammelten Erfahrungen der Menschheit.
All diese Erklärungen reichen nicht, um die Koalition der Präsidentin zusammenzuhalten. Ihre Regierung zerbricht, als Drill – wieder in aller Unschuld – berichtet, woher er die Koordinaten für die Shar-Welt habe. Na, von gefangenen Shar. Und was wurde aus denen? Sie wurden liquidiert, weil man den Garten brauchte, in dem sie untergebracht waren. Dieser erneute Beweis der ahnungslosen Grausamkeit der Menschen führt dazu, dass sich General Vang an die Macht putscht und den Menschen den Krieg erklärt …
Mein Eindruck
„Menschen“ ist in sieben Millionen Jahren ein sehr relativer Begriff geworden: Drill ist ein Abkömmling der Saurier, und zwar ein ganz besonders hässlicher. Dagegen sind die Shar ja richtig putzige Menschlein, mit denen wir uns identifizieren können. Drill jedoch hält sie für primitiv, weil sie noch an seltsame Dinge wie Moral glauben. Als ob dies im Laufe der Evolution irgendeine Rolle spielen würde. Sie sind wie einst die Saurier, zum Aussterben verurteilt. Was schon ziemlich ironisch ist.
Die eigentliche Kritik des Autors, der im Grunde keine Seite einnimmt, ist jedoch das, was den Shar so widerwärtig erscheint: die ahnungslose Grausamkeit der „Menschen“. Da diese keine Vorstellung mehr von Moral und Prinzipien haben, sondern vor allem durch Protein und Sex – Drills Metahirn quengelt regelmäßig danach – befriedigt werden, muss es etwas anderes sein, das das Verhalten der „Menschen“ steuert. Am Ende ihres letzten Zwiegesprächs erkennt Präsidentin Gram mit bitterer Trauer, um was es sich handelt: Instinkt und Reflex. So weit hat sich also die prächtige „Menschheit“ entwickelt!
Die Übersetzungen
Auf Seite 508ff. ist mehrfach von der iranischen Stadt „Tehran“ die Rede. Sie heißt bei uns Teheran. Man kann diese Schreibweise aber stehen lassen, weil es sich um eine alternative Welt handelt.
Auf der Seite 509 ist von dem „Gott der Trugs“ die Rede, aber gemeint ist Loki, also der „Gott des Trugs“!
Auf Seite 770 heißt es: „Die Welten auf beiden Seiten sind der Sicherheitspfand.“ Also, bei uns in der Schule war DAS Pfand immer sächlich, nicht männlich.
Unterm Strich
Diese Best-of-Auswahl wird ihrem Anspruch durchaus gerecht – was ja nicht selbstverständlich ist. Alle Texte sind durchweg top, ganz besonders die herausragenden Novellen von Robinson, Zelazny, Shepard, Martin und Miller. Alle anderen sind meist sehr bekannt und vielfach abgedruckt, ausgenommen die Stories von Fowler, Lambe und Masson, die man nur selten findet.
Zwei Aspekte fallen auf: Alle Erzählungen sind von nicht-technischen Themen charakterisiert, also meist psychologischer, soziologischer oder biologischer Natur. Das heißt, wenn nicht gerade wieder mal ein alternativer Geschichtsverlauf eine Rolle spielt, wie etwa bei Brin oder Williams. Durch dieses Übergewicht unterscheidet sich diese Auswahl von vielen, die man heute in den USA finden würde. Keine einzige Story von Bear, Benford oder Niven ist hier zu finden, Autoren, die für Hard SF stehen, also naturwissenschaftlich orientierte Science-Fiction.
Was betrüblich zu konstatieren ist, ist das Fehlen jeglicher Beiträge von Philip K. Dick und John Brunner, zwei im Heyne SF Programm nicht gerade unterrepräsentierten Autoren. Heyne hat fast das komplette Werk von Brunner veröffentlicht sowie einige der wichtigsten Arbeiten von Dick. Wieso fehlen sie hier? Vielleicht sind sie ja in „Ikarus 2002“ oder „Fernes Licht“ zu finden. Stay tuned.
Taschenbuch: 782 Seiten
Aus dem Englischen übertragen von diversen Übersetzern
ISBN-13: 978-3453179844|
http://www.heyne.de
_Wolfgang Jeschke (als Herausgeber) bei |Buchwurm.info| [Auszug]:_
[„Titan-1“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=4724
[„Titan-2“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7346
[„Titan-3“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7347
[„Titan-4“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7086
[„Titan-5“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7087
[„Titan-6“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=4327
[„Titan-7“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=4486
[„Titan-8“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=3747
[„Titan-9“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=4274
[„Titan-10“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=3687
[„Titan-11“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=4509
[„Titan-12“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=4538
[„Titan-13“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7350
[„Titan-14“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7348
[„Titan-15“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7351
[„Titan-16“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7349
[„Titan-18“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7353
[„Titan-19“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7352
[„Titan-20“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7354
Manfred Kluge (Hrsg.) – Katapult zu den Sternen. Magazine of Fantasy and Science Fiction 51
_Mit König Artus gegen den Nekromanten!_
Vom traditionsreichen SF-Magazin erscheinen in dieser Auswahl folgende Erzählungen:
1) Die Story von der Dame, der man besser abgeraten hätte, in einem Antigrav-Haus zu wohnen.
2) Die Story von dem Hobby-Prospektor, der seinen Urlaub auf der Venus verbringt und dort sein Glück zu machen hofft.
3) Die Story von den Heimkehrern einer Sternenexpedition, die eine völlig veränderte Erde vorfinden und sich anzupassen haben.
4) Die Story von den Würmern, welche die Erde besuchen, und wie frühere Besucher auch die Menschheit mit ihren Segnungen hätten beglücken können.
5) Die Story von dem Regierungsspezialisten für mysteriöse Fälle, der sich mit dem Fall eines Freundes konfrontiert sieht, der mehr als mysteriös ist.
_Das Magazin_
Das „Magazine of Fantasy and Science Fiction“ besteht seit Herbst 1949, also rund 58 Jahre. Zu seinen Herausgebern gehörten so bekannte Autoren wie Anthony Boucher (1949-58) oder Kristin Kathryn Rusch (ab Juli 1991). Es wurde mehrfach mit den wichtigsten Genrepreisen wie dem HUGO ausgezeichnet. Im Gegensatz zu „Asimov’s Science Fiction“ und „Analog“ legt es in den ausgewählten Kurzgeschichten Wert auf Stil und Idee gleichermaßen, bringt keine Illustrationen und hat auch Mainstream-Autoren wie C. S. Lewis, Kingsley Amis und Gerald Heard angezogen. Statt auf Raumschiffe und Roboter wie die anderen zu setzen, kommen in der Regel nur „normale“ Menschen auf der Erde vor, häufig in humorvoller Darstellung. Das sind aber nur sehr allgemeine Standards, die häufig durchbrochen wurden.
Hier wurden verdichtete Versionen von später berühmten Romanen erstmals veröffentlicht: „Walter M. Millers „Ein Lobgesang auf Leibowitz“ (1955-57), „Starship Troopers von Heinlein (1959), „Der große Süden“ (1952) von Ward Moore und „Rogue Moon / Unternehmen Luna“ von Algus Budrys (1960). Zahlreiche lose verbundene Serien wie etwa Poul Andersons „Zeitpatrouille“ erschienen hier, und die Zahl der hier veröffentlichten, später hoch dekorierten Stories ist Legion. Auch Andreas Eschbachs Debütstory „Die Haarteppichknüpfer“ wurde hier abgedruckt (im Januar 2000), unter dem Titel „The Carpetmaker’s Son“.
Zwischen November 1958 und Februar 1992 erschienen 399 Ausgaben, in denen jeweils Isaac Asimov einen wissenschaftlichen Artikel veröffentlichte. Er wurde von Gregory Benford abgelöst. Zwischen 1975 und 1992 war der führende Buchrezensent Algis Budrys, doch auch andere bekannte Namen wie Alfred Bester oder Damon Knight trugen ihren Kritiken bei. Baird Searles rezensierte Filme. Eine lang laufende Serie von Schnurrpfeifereien, sogenannte „shaggy dog stories“, genannt „Feghoots“, wurde 1958 bis 1964 von Reginald Bretnor geliefert, der als Grendel Briarton schrieb.
Seit Mitte der sechziger Jahre ist die Oktoberausgabe einem speziellen Star gewidmet: Eine neue Story dieses Autors wird von Artikeln über ihn und einer Checkliste seiner Werke begleitet – eine besondere Ehre also. Diese widerfuhr Autoren wie Asimov, Sturgeon, Bradbury, Anderson, Blish, Pohl, Leiber, Silverberg, Ellison und vielen weiteren. Aus dieser Reihe entstand 1974 eine Best-of-Anthologie zum 25-jährigen Jubiläum, aber die Best-of-Reihe bestand bereits seit 1952. Die Jubiläumsausgabe zum Dreißigsten erschien 1981 auch bei Heyne.
In Großbritannien erschien die Lokalausgabe von 1953-54 und 1959-64, in Australien gab es eine Auswahl von 1954 bis 1958. Die deutsche Ausgabe von Auswahlbänden erschien ab 1963, herausgegeben von Charlotte Winheller (Heyne SF Nr. 214), in ununterbrochener Reihenfolge bis zum Jahr 2000, als sich bei Heyne alles änderte und alle Story-Anthologie-Reihen eingestellt wurden.
_Die Erzählungen _
_1) Michael G. Coney: Katapult zu den Sternen (1976)_
Auf dem Planeten Peninsula herrscht Müßiggang wie in Florida. Eine der Freuden besteht jedoch im Schleudersegeln: Ein Mann wird auf ein Schleuderkatapult geschnallt und lässt sich mit 160 Stundenkilometern in die Höhe schnellen, um sodann an einem Gleiter zu segeln. Der entscheidende Punkt bei diesem Start ist jedoch, den Auslösebolzen rechtzeitig zu lösen. Wer das wie der arme St. Clair unterlässt, endet als tote Masse in der See.
Joe Sagar ist unser Mann vor Ort und selbstredend Mitglied im Klub der Schleudersegler. Eines Tages kommt also diese Lady namens Carioca Jones hereingeschneit und will den Klub besuchen. Da ihr ein streitbarer, um nicht zu sagen: umstrittener Ruf vorauseilt – sie agitiert gegen zwangsweise erfolgte Organspenden -, soll ihr der Zutritt verwehrt werden. Der intelligente Seehund an ihrer Seite trägt auch nicht gerade zum Eindruck ihrer Seriosität bei.
Doch sie hat zwei Begleiter bei sich, die die Stimmung ändern: Wayne Traill ist sehr beliebter 3d-Fernsehstar, und mit seiner leutseligen Art im Verein mit seiner beeindruckenden Größe kriegt er die Klubmitglieder dazu, Carioca doch noch Einlass zu gewähren. Es wird ein netter Abend, findet Joe. Und dass kaum jemand Notiz von Waynes unscheinbarer Gattin Irma nimmt, findet er schade.
Die Zeit vergeht, und Carioca versucht Joe wie alle Kerle zu verführen. Sie will ihn mit ihrem Antigrav-Haus beeindrucken, das sie unweit des Strandes von Peninsula gekauft hat. Es hängt an einem Stahlseil, dessen Ende in einem mit intelligenten Haifischen bestückten Pool verankert ist. Gleich daneben stehen noch vier Hochleistungs-Laserstrahler.
Schon bei seiner ersten Einladung merkt Joe, dass hier der Haussegen schief hängt: Wayne betrügt seine Frau Irma offensichtlich mit Carioca, und Irma muss es sich gefallen lassen. Aber wie lange noch, fragt sich Joe. Doch seinen Rückzug aus diesem Antigrav-Haus hat er sich weniger gefährlich vorgestellt.
Wayne Traill folgt einer Einladung des Seglerklubs. Man will ihn überlisten, sich auch mal mit dem Katapult schleudern zu lassen. Hat er den Mumm dazu? Er will gerade einen eleganten Rückzieher machen, als ein Schrei ertönt: Das Stahlseil, an dem das Antigrav-Haus gehangen hat, ist durchtrennt worden – nun saust Carioca Jones hilferufend dem Himmel entgegen!
Da gibt es nur eins für Wayne Traill: Er lässt sich ins halbwegs funktionsfähige Seglerkatapult schnallen und – ab die Post, Carioca hinterher! Wird er den Auslöser rechtzeitig betätigen können, der seit St. Clairs „Unfall“ nicht mehr repariert worden ist?
|Mein Eindruck|
Der Klub der Schleudersegler erinnert an einen viktorianischen Herrenklub. Die Mitglieder haben Respekt vor dem Filmstar, der den Macho verkörpert. Doch dessen Auftreten ist von zweifelhafter Moral. Denn er betrügt seine Frau Irma mit der ebenso glamourösen Carioca. Als Irma das Spielzeug Cariocas, das Antigrav-Haus, in die Luft gehen lässt, will sie dieser Rivalin ebenso wie ihrem aufgeblasenen Mann die Luft rauslassen. Eine klassische Dreiecksgeschichte also.
Der romantisch-dramatische Plot dient nicht nur der Vermittlung einer exotischen Sportart, dem Schleudersegeln, sondern auch den Konsequenzen von Genmanipulation und Organhandel. Gegen Letzteren tritt Carioca, obwohl sie gegen Genmanipulation nichts einzuwenden hat, wie ihr Haustier beweist. Ihre Doppelmoral spiegelt sich in ihrer Affäre mit Wayne wider.
_2) John Varley: In der Schüssel (In the bowl, 1976)_
Kiku ist ein Amateurgeologe vom Mars, der schon einiges Wundersames von den Venussteinen, den Juwelen der Venus-Wüste, gehört hat. Sie sollen eine Menge wert sein, aber auch nur deshalb, weil sie schwer zu bekommen sind. Wie schwer, will Kiku herausfinden.
Zunächst macht er den Fehler, sich ein Ersatzauge aufschwatzen zu lassen – angeblich ein Schnäppchen, aber leider mit einer gewissen Fehlsichtigkeit. Die macht sich auf der Venus zunehmend lästig bemerkbar. Er passiert eine Stadt nach der anderen, bis er endlich die tiefe Wüste erreicht. Nach Last Chance kommt nur noch Prosperity. Hierhin kommen die Pendelbusse nur noch im Wochentakt.
Die einzige Medizinerin weit und breit, die Kiku mit seinem versagenden Billigauge helfen kann, ist Ember. Das Mädchen planscht grade mit seinem zahmen Otter im Dorfbrunnen herum, als Kiku es wegen der nötigen Operation anquatscht. Sie sieht aus wie 18, sagt aber, sie sei schon 13, und das wäre auf der Venus schon fast ein legales Alter. Tatsächlich findet sie sich bereit, ihm das Auge zu reparieren. Als sie aber herausfindet, was er hier draußen im Nirgendwo wirklich vorhat, will sie sofort mit von der Partie sein.
Kommt ja gar nicht in die Tüte, protestiert Kiku sofort, natürlich vergebens. Denn zufällig besitzt Ember auch das einzige funktionierende Fluggefährt weit und breit. Nur mit diesem Schweber könne Kiku über den Grat des Randgebirges in die tiefe Wüste gelangen, wo die wertvollen Venussteine wachsen.
Tja, und so kommt es, dass sich Kiku mit einem listenreichen Mädel und einem zahmen Otter auf den Weg über die Berge macht. Es wird ein Abenteuer, das beide grundlegend verändern soll. Aber das kann auch sein Gutes haben …
|Mein Eindruck|
John Varley sieht in Veränderung immer auch die Chance zu einem Neuanfang. Und dies gilt natürlich auch für Kiku, der ein einsames Leben führt, und für Ember, die endlich von der venusischen Sandkugel runterkommen will. Allerdings braucht es noch etwas Nachhilfe, bevor diese beiden so unterschiedlichen Persönlichkeiten zueinander kommen können.
Dieser Katalysator ist der Venusstein, eine denkwürdige Begegnung in der Wüste, die Kikus Geist verändert – und in Gefahr bringt. Die bodenständige Ember ist nötig, um ihn vor dem Wahnsinn zu bewahren und ihm zu zeigen, was er wirklich braucht: einen lieben Menschen an seiner Seite. Jetzt muss Kiku nur noch herausfinden, ob er Ember lieber als Tochter adoptieren oder doch gleich heiraten soll. Aber auch das wird sich noch zeigen, sobald sie beide erst einmal auf den Mars gelangt sind.
Dem zuversichtlichen Menschen nach Varley-Art ist „nix zu schwör“. Auch in seinen Erzählungen, die in den drei Goldmann-Erzählbänden „Voraussichten“, „Mehr Voraussichten“ und „Noch mehr Voraussichten“ zusammengefasst sind, erweisen sich die Hauptfiguren als Erkunder neuer Zustände und Gegenden. Hier ist es ein gekauftes Organ, das Kiku zur schicksalhaften Begegnung mit Ember – und einem Venusstein – verhilft.
In „Ein Löwe in der Speicherbank“ gerät die Hauptfigur mit einer Sicherheitskopie seines Geistes ins Innere eines Computers und muss sich dort einrichten. In der preisgekrönten Story „In der Halle der Marskönige“ richten sich die Mars-Siedler häuslich in einem Alien-Konstrukt ein – mit entsprechenden Überraschungen. Für solche ist Varley immer gut (gewesen), und das macht seine Storys so vergnüglich, ohne es an Tiefgang fehlen zu lassen.
_3) Brian W. Aldiss: Drei Wege _
Das Forschungsschiff „Bathycosmos“ war zehn Jahre Bordzeit unterwegs, nun kehrt es zur Erde zurück. Doch hier sind wegen der relativistischen Effekte der schnellen Fortbewegung des Schiffes inzwischen 120 Jahre vergangen. Beim letzten Zusammentreffen aller Besatzungsmitglieder hält ihnen die Präsidentin von Korporatien eine erschütternde Ansprache.
Die gute Nachricht zuerst: Inzwischen sei die Große Eiszeit beendet und die meisten Seewege wieder frei. Aber ein neuer Kontinent sei zwischen Neuseeland und dem Ellis-Archipel aufgetaucht. Dieser werde gerade besiedelt. Die schlechte Nachricht: Zwei Atomkriege haben viele Menschenleben gekostet und sämtliche, der Crew bekannten Länder ausradiert oder umgestaltet. Korporatien werde die Rückkehrer aus dem All durch seine Bürokratie schleusen und sie weiterleiten. Wie der Commander feststellen muss, interessiert sich keine Sau für die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sein Schiff gesammelt hat.
Lucas Williamz, A. V. Premchard und Jimmy Dale ahnen noch nicht, was auf sie zukommt. Williamz will zurück ins heimatliche Australien, doch da dieses Land nun im feindlichen Neutralien liegt, müsse er sich erst als Gefangener internieren und dorthin transportieren lassen. Williamz erfährt auf der langen Zugfahrt von den bestinformierten Leuten dieser Weltregion, dass der neue Kontinent namens Seelandia gerade besiedelt werde. Da will er hin.
A. V. Premchard, der Hindu, will nach Indien, logisch. Doch Indien liegt jetzt in der Dritten Welt, von Korporatiern auch abfällig Anarchanien genannt. Folglich muss er ebenfalls Einbußen und Hindernisse hinnehmen. Tatsächlich geht es dort in der Bürokratie immer noch wie im Mittelalter zu, also wie seit Jahrtausenden gewohnt. Die letzten 500 km in sein Dorf Kanchanapara soll er zu Fuß gehen.
Jimmy Dale muss erst wie Williamz eine brutale Phase der Desorientierung durchstehen, bevor er sich wieder auf die Straße traut. Seltsam: Überall sind nur uniformierte oder unscheinbar gekleidete Frauen zu sehen, kein einziger Mann. Als er in einer Bar nach einer Nutte fragt, bekommt er es mit einer kräftigen Lesbe zu tun, die ihn an eine Bulldogge erinnert. Er wehrt sich, so gut er kann, wird aber gleich danach von der – weiblichen – Polizei vermöbelt. Jimmy ist in einer weiblichen Tyrannei gelandet, mit einem weiblichen Hitler an der Spitze.
Williamz wird der Zugang zu Seelandia verwehrt, und zwar, weil seine Urgroßmutter aus Begalen stammte. Dem Rassismus zum Trotz findet er dennoch ins Land seiner Träume: ein Wilder Westen, der nur auf die Eroberung wartet …
|Mein Eindruck|
Die Erzählung zeigt drei Wege der Weiterentwicklung auf, die dem Menschen nach Eiszeit und Atomkrieg bleiben. Williamz errichtet sein eigenes Königreich und sucht sich eine Frau, um eine Dynastie zu gründen. Aber sein Freund A.V. Premchard wählt den kleinen Horizont seines Dorfes, um sein Wissen an die Landbevölkerung weiterzugeben. Er wohnt bei seinem Urenkel in spirituellem Frieden.
Doch Commander Skolokov verkörpert den dritten Weg: Er will in einem neuen Raumschiff der Korporatier, der „Bathycosmos II“, noch weiter hinausfahren, auf eine Reise, die 300 Erdenjahre dauern wird. Williamz lehnt die Teilnahme an dieser Expedition ab: Seine Ziele sind irdischer und praktischer Natur. Also muss Skolokov alleine hinausfahren.
Die drei Wege sind altbekannt, müssen aber immer erneut beschritten werden: den der macht, den des Wissens und den der Spiritualität. Der Autor, der schon 1942 in Hinterindien gegen die japanischen Invasoren kämpfte, kennt sich nicht nur mit Land und Leuten des indischen Subkontinents bestens aus, sondern auch mit deren Mentalität, Religion und Bräuchen. Das verleiht seiner Erzählung einen realistischen Eindruck, aber auch eine bleibende Wirkung.
_4) Bruce McAllister: Victor_
Würmer aus dem intergalaktischen Raum fallen auf die Erde herab, geschützt durch Chitinkokons. Sie wühlen sich bei Nacht in den städtischen Müll. Doch als ein Beleuchter vom Theater seine Lampe auf sie richtet, vermehren sie sich explosionsartig. Die Stadt ist alarmiert, und Professor Stapledon, der Vater von Jane, informiert die Behörden. Die wollen gleich Bomben werfen, doch er sagt Nein. Er ruft Jane und ihren Freund, den Reporter, an, damit sie seine Vogelpfeife suchen. Mit dieser lassen sich Tausende Vögeln auf die Müllkippe locken. Und was machen sie wohl? Sie fressen die Würmer. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Doch die Geschichte geht noch weiter. Jane und ihr Freund, der namenlose Ich-Erzähler, heiraten, das Interesse an der Würmerinvasion flaut ab, drei Kinder werden dem Paar geboren, die Jahre vergehen, es folgt die Scheidung und er bindet sich erneut, an eine Frau, die sich wenigstens dafür interessiert, was er denkt. Er denkt an den Weltraum und an Raumschiffe, was sonst.
|Mein Eindruck|
Diese Story erzählt ungefähr das genaue Gegenteil dessen, was Robert A. heinlein in seinem klassischen Invasionsroman „Invasion der Wurmgesichter / Die Marionettenspieler“ als Horrorszenario an die Wand malte: dass uns die Invasoren übernehmen würden, wenn wir ihnen nicht Einhalt gebieten würden. Das war eine versteckte Warnung vor der Roten Gefahr, dann der Gelben Gefahr oder welcher Farbe auch immer der jeweiligen Regierung gerade missfiel.
Dass die Würmer zur Müllbeseitigung herangezogen hätten werden können, auf diese Idee kam niemand. Man sah stets nur die Gefahr, nie die Chance. Wenigstens wurden keine Bomben geworfen, sondern eine ökologische Lösung gewählt. Auch schon ein Fortschritt.
_5) Sterling E. Lanier: Der Geist der Krone (Ghost of a Crown)_
Irgendwo in London in einem literarischen Klub stellt ein junger Mann namens Simmons die Wahrheit in all diesen Gespenstergeschichten und Legenden, von denen Großbritannien voll zu sein scheint, stark in Frage. Tatsächlich schließen sich seiner Meinung einiger Klubmitglieder an, doch dann tritt Brigadegeneral Donald Ffellowes auf und erzählt eine umwerfende Geschichte, die Simmons‘ Meinung – die dieser gar nicht mehr vehement vertreten will – widerlegen soll. Sie geht folgendermaßen …
Ffellowes arbeitet in einer Spezialabteilung des Kriegsministeriums (wie es damals hieß) und wird von einem alten Schulfreund namens James Penruddock um Hilfe gerufen. Er reist nach Cornwall auf das Anwesen des Grafen, das den Namen Avalon House trägt. James holt seinen Freund Donald am Bahnhof ab und erzählt ihm vom Grund seines Hilferufs. Grässliche Geräusche in der Nacht und wiederholtes nächtliches Sturmtosen brächten die Bediensteten sowie ihn und seine Frau Isobel um den Schlaf. Ein Hausmädchen sei bereits schreckerfüllt abgereist. Noch sei niemand zu Schaden gekommen, doch das könne ja wohl nur eine Frage der Zeit sein, oder?
Bei seiner Ankunft hat Donald Gelegenheit, James‘ bleichen, schwarzhaarigen Bruder Lionel kennenzulernen. Wie stets ist Lionel, dem der Ruf eines perversen, aber fähigen Archäologen vorauseilt, arrogant und abweisend. Er logiert mit James‘ Erlaubnis im Sommerhaus und führt Grabungen in einer alten Burgruine durch, die auf einer Felsklippe über die tosende See ragt. Diesmal gibt ihm jedoch James zu aller Erstaunen Kontra, und Lionel schwirrt schmollend ab.
Schon in dieser Nacht findet Donald die Angaben von James bestätigt: unmenschliches Geschrei, tosender Sturmwind – und den intensiven Duft von Apfelblüten in der Luft. Bemerkenswert. Ganz im Gegensatz zum fauligen Geruch, der aus dem Keller emporsteigt. Was mag dahinter stecken? Donald nimmt Lionel unter die Lupe.
Dieser arbeitet mit zwei finsteren Gesellen, die er seine Assistenten nennt, in den Tiefen der Burgruine. Was mag sich dort nur verbergen? Lionel will Donald vertreiben, redet mit seinen Gesellen in einem rauen Dialekt, den Donald später als Bretonisch identifiziert. Als Lionel den Fehler macht, Hand an Donald zu legen, bricht ihm der Agent des Ministeriums fast das Handgelenk. Er erkennt den glühenden Hass des Bruders auf James; es ist der Hass des Enterbten, der das haben will, wovon er glaubt, es stünde ihm zu: das Land seines Bruders.
Der Begriff Bretagne ist der Schlüssel zu einem Teil des Rätsels. Von alters her bestehen enge Beziehungen zwischen den beiden keltischen Ländern Cornwall und Bretagne, und laut den Legenden, die Sir Thomas Malory und andere aufschrieben, zog einst auch König Artus, der Retter Britanniens vor den Sachsen, in die Bretagne, um dort zu kämpfen. Doch Artus hatte einen dunklen Halbbruder, der ihm sein Reich neidete und schließlich versuchte, ihn zu töten.
Soll sich die alte Geschichte tatsächlich auf Avalon House wiederholen? Als Donald in der nächsten Nacht den unmenschlichen Schrei gefolgt von Pferdewiehern hört, geht er zu James, um ihm zum Kampf zu rufen. Nur dass James ihn bereits gestiefelt und gespornt bereits erwartet. „Der Jäger ist gekommen“, sagt James nur, dann holen sie je ein Schwert und stellen sich der Herausforderung. Doch wer hat den Jäger der Nacht, der nun im dichten Nebel angreift, gerufen und zu ihnen geschickt?
Das Geheimnis kann nur ein Besuch in den Tiefen der Burgruine lüften …
|Mein Eindruck|
Es ist eine Überraschung, dass eine so konservativ gestaltete Erzählung in einer Auswahl aus den siebziger Jahren auftaucht. Und sie hat natürlich beileibe nichts mit Naturwissenschaften zu tun, sondern viel mehr mit Schauergeschichten und Fantasy. Die Folie ist eindeutig die Artus-Sage, die ja ihre pikante Spannung daraus bezieht, dass Artus unwissentlich mit seiner Schwester schläft und so seinen Sohn und Halbbruder Mordred zeugt, der zu seiner Nemesis wird.
Während diese Fantasy-Vorlage nun erneut ausgespielt wird, als handle es sich um eine viktorianische Schauergeschichte, nimmt die Handlung im Innern der Burgruine eine unerwartete Wendung, die neu ist. Denn hier unten in den Tiefen des uralten Gemäuers liegt das Grab jenes dunklen spirituellen Herrschers, der vor den Christen die Inseln beherrschte und von ihnen vertrieben wurde. Sein Name wird an keiner Stelle ausgesprochen, deshalb bleibt dies Spekulation. Man könnte ihn Cernunnos nennen, den Herrn der Wälder, oder Herne.
Lionel alias Mordred schickt sich an, ihn mit schwarzer Magie zum Leben zu erwecken. Fauliger Gestank, missgestaltete Kreaturen erfüllen die Höhle des Grabmals, als James und Donald sich mit ihren Waffen Lionel, dem Nekromanten, entgegenstellen …Mehr darf nicht verraten werden.
Aber es ist erstaunlich, dass der Autor des Post-Holocaust-Klassikers „Hieros Reise“, dieses wunderbar altmodische Garn veröffentlicht hat. Er hätte einen Roman daraus machen können. Wer Sherlock Holmes und die Viktorianer liebt, wird sich hier wie zu Hause fühlen. Und obwohl es an Romantik ein wenig fehlt (Isobel kommt nur im Epilog richtig zu Wort), wäre die Geschichte ein klassischer Fall für die Hörspielreihe GRUSELKABINETT.
_Die Übersetzung_
Es gibt ein paar ärgerliche Druckfehler in diesem schmalen Band. Ich liste sie einfach kommentarlos auf.
Seite 36: „Hole“ statt „Holo“.
Seite 43: Statt Phobos, dem Marsmond, schreibt der Übersetzer der Varley-Story ständig „Phöbos“. Beides sind griechische Wörter, doch „phobos“ bedeutet „Furcht“ und „Phöbus / phoibos“ ist der Name des Lichtgottes Apoll.
Seite 72: „Er legte seinen Arm um seinen Freund, A.V. Premchard sagte sanft …“ Das falsch gesetzte Komma verwirrte mich völlig. Denn den folgenden Dialog-Satz spricht nicht Premchard, sondern Williamz. Daher muss das Komma wie folgt stehen: “ …um seinen Freund Premchard, sagte sanft …“.
Seite 145: „das Geräusch von Wasser, daß irgendwo tropfte.“ Statt „daß“ müsste es „das“ heißen.
Auf Seite 146 verhält es sich genau umgekehrt. In dem Satz „dass ich nichts von der Welt wußte, außer das sie die Kontrolle über mein Handeln an sich gerissen hatte …“ müsste das Wörtchen „das“ ein „daß“ sein. Dann stimmt die (alte) Grammatik.
_Unterm Strich_
Alle Erzählungen bis auf eine sind von hoher Qualität. Sie bieten gute Unterhaltung sowie erstaunliche Ideen. Und Ideen sind ja der Hauptgrund, warum man überhaupt SF-Erzählungen liest. Sonst könnte man ja gleich zu einem Roman greifen. In der SF entstehen Romane aber häufig aus mehr oder weniger langen Erzählungen. Während die Story eine oder zwei ungewöhnliche Einfälle präsentiert, ist es die Aufgabe eines Romans, eine Entwicklung zu schildern.
Während die Erzählungen von den zwei Könnern Coney und Varley mein Interesse fesseln konnten, gelang dies McAllisters Story „Victor“ leider nicht. Nach einem Genre-typischen, starken Auftakt verliert sich der Rest in banalem Geschehen wie etwa Heirat, Kindern, Scheidung und neuer Beziehung. Was soll daran Besonderes sein?
Auch die Erzählung von Brian Aldiss folgt keinem vorgegebenen Story- oder Handlungs-Muster, sondern schildert schon eine Entwicklung, wie es ein Roman täte. Deshalb muss der Leser Geduld aufbringen, während die drei Hauptfiguren ihren jeweiligen Weg verfolgen. Und bei Aldiss, das weiß der erfahrene SF-Kenner, muss man sich stets darauf gefasst machen, dass die Figuren unangenehme Überraschungen erleben. Für Aldiss, eine der wichtigsten Autoren der New Wave in den sechziger Jahren, ist das Leben kein Zuckerschlecken. Einer zahlt immer drauf.
Als Trostpflaster zu diesen beiden Erzählungen erlebte ich dann zu meinem Erstaunen eine gruselige Fantasygeschichte, die von einem SF-Klassiker namens Sterling Lanier kommt. (Er war übrigens der Typ, der es Frank Herbert 1965 überhaupt erst ermöglichte, seinen voluminösen Roman „DUNE“ als Hardcover bei einem Verlag zu veröffentlichen – alle anderen hatten schon abgelehnt.)
Laniers Story versetzt uns zurück in ein quasi-viktorianisches England, so dass man jeden Moment erwartet, einen Gespensterdetektiv auftreten zu sehen. Solche Figuren gab es in der Massenliteratur zuhauf, so etwa auch Aylmer Vance. Tatsächlich ist unser Erzähler Donald Ffellowes so ein Kerl, eine Art james Bond des Esoterischen. Zusammen mit einer Story direkt aus den Artus-Legenden wird noch eine richtige Sword-& Sorcery-Handlung draus. Wirklich erstaunlich – und sehr unterhaltsam.
Im Unterschied zu Isaac Asimov’s SF Magazin hatte das „Magazine of Fantasy and Science Fiction“ keine Berührungsängste zur Fantasy und Schauerliteratur. Ein Glück, denn sonst wäre mir dieser feine Beitrag durch die Lappen gegangen.
|Taschenbuch: 158 Seiten
Erstveröffentlichung im Original: 1976/77/78
Aus dem Englischen von diversen Übersetzern
ISBN-13: 978-3453304826|
[www.heyne.de]http://www.heyne.de
_Mafred Kluge bei Buchwurm.info:_
„Die Cinderella-Maschine“
„Jupiters Amboss. Magazine of Fantasy and Science Fiction 49“
Wahren, Friedel (Hrsg.) – Isaac Asimovs Science Fiction Magazin, 38. Folge
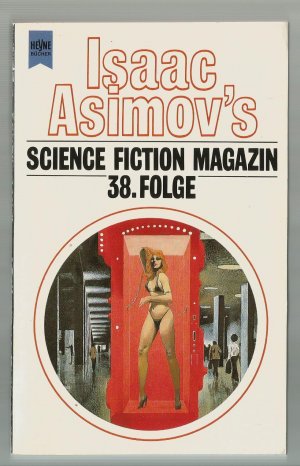
Dieser Auswahlband aus dem Jahr 1991 enthält Erzählungen von Kim Stanley Robinson, George Alec Effinger, Mike Resnick, Michael Kallenberger, Megan Lindholm (= Robin Hobb), James Patrick Kelly und dem deutschen Autor Peter Frey.
Drei Novellen ragen heraus. Effingers Novelle bildet den Anfang seines Roman „Das Ende der Schwere“, Resnicks Novelle „Manamouki“ wurde mit dem begehrten HUGO Award ausgezeichnet und Kelly glänzt mit der Novelle „Mr. Boy“.
Die Herausgeber
Friedel Wahren war lange Jahre die Mitherausgeberin von Heynes SF- und Fantasyreihe, seit ca. 2001 ist sie bei Piper verantwortlich für die Phantastikreihe, die sowohl SF als auch Fantasy veröffentlicht.
Isaac Asimov, geboren 1920 in Russland, wuchs in New York City auf, studierte Biochemie und machte seinen Doktor. Deshalb nennen seine Fans ihn neckisch den „guten Doktor“. Viel bekannter wurde er jedoch im Bereich der Literatur. Schon früh schloss er sich dem Zirkel der „Futurians“ an, zu denen auch der SF-Autor Frederik Pohl gehörte. Seine erste Story will Asimov, der sehr viel über sich veröffentlicht hat, jedoch 1938 an den bekanntesten SF-Herausgeber verkauft haben: an John W. Campbell. Dessen SF-Magazin „Astounding Stories“, später „Analog“, setzte Maßstäbe in der Qualität und den Honoraren für gute SF-Stories. Unter seiner Ägide schrieb Asimov nicht nur seine bekannten Robotergeschichten, sondern auch seine bekannteste SF-Trilogie: „Foundation“. Neben SF schrieb Asimov, der an die 300 Bücher veröffentlichte, auch jede Menge Sachbücher, wurde Herausgeber eines SF-Magazins und von zahllosen SF-Anthologien.
Die Erzählungen
1) Kim Stanley Robinson: Das Ende der Traumzeit (Before I Wake)
Der Wissenschaftler Fred Abernathy erwacht aus einem wunderschönen Traum, weil sein Kollege Winston ihn anbrüllt, er solle gefälligst aufwachen. Aber er ist doch wach, oder etwa nicht? Winston erklärt, dass die Menschen, wie Fred, Wachen nicht mehr von Träumen unterscheiden können, weil ihre Wach- und Schlafphasen völlig durcheinandergeraten sind. Das Magnetfeld der Erde muss in ein starkes Feld kosmischer Strahlung geraten sein, die dies verursacht.
Flugzeuge sind abgestürzt, Auto- und Schiffsverkehr zusammengebrochen. Abernathy holt seine träumende Schwester Jill aus dem niedergebrannten Zuhause ab und bringt sie ins Labor zu Winston und anderen Mitarbeitern des Instituts. Hier versucht Abernathy, unter ständiger Verabreichung von Schmerz, Aufputschmitteln usw., ein Abschirmgerät zu entwickeln. Es gelingt ihm. Doch dankt man es ihm? Nein: Auf einmal gehen alle auf ihn los: Er sei schuld. Aber an was? Als er stürzt, glaubt er eine Treppe hinabzustürzen, doch dann erwacht er. Wirklich?
Mein Eindruck
Der Autor hat die Schlafforschung von 1990 gründlich studiert, und auch heute forscht man eifrig weiter, was im Schlaf passiert. Er geht aber weiter, indem er fragt, wie Bewusstsein entstand, als das Gefühl, wach zu sein und sich zu fragen: „Wer und was bin ich?“ Wozu dient dann aber das Träumen? Möglicherweise kann in diesem Zustand das menschliche Bewusstsein in die Unendlichkeit hinausreichen und sich so seiner spirituellen Seite bewusst werden.
Der Rest der Handlung lässt sich durchaus vernünftig verfolgen, da dies keine Story von Philip K. Dick oder J. G. Ballard ist. Fred erkennt das Problem, bekämpft es und sucht, wie ein guter Wissenschaftler, die Lösung dafür: die Abschirmung des Kopfes gegen die Magnetstrahlung. Der Träger des Helms würde also aufwachen. Ironischerweise ziehen seine Arbeitskollegen es vor weiterzuträumen …
2) George Alec Effinger: Marîd lässt sich aufrüsten (Marîd Changes His Mind)
Der etwa 30-jährige christliche Algerier Marîd Audran lebt als Privatdetektiv im Budayin, dem Rotlichtbezirk einer nordafrikanischen Stadt im 21. Jahrhundert. In den Strip-Klubs findet er seine Kumpel, seine diversen Freundinenn – und leider auch seine Feinde. Die Halbwertszeit eines Lebens ist hier stark reduziert. Seine derzeitige Freundin ist Yasmin, eine Oben-ohne-Tänzerin, aber auch mit Tamiko und Nikki hat er schon nähere Bekanntschaft geschlossen. Marîd ist ein wenig exotisch und wirkt arrogant, weil er sich standhaft weigert, ein Software-Add-on für die Persönlichkeitsmodifikation zu benutzen. Er hat nicht mal eine Schädelbuchse dafür und zieht stattdessen Tabletten vor. Yasmin kennt solche Skrupel nicht, und deshalb ist sie die populärste Tänzerin bei Frenchy’s.
Die Mordserie
Dass die Moddys und Daddys – die Persönlichkeitsmodule und Software-Add-ons – auch Gefahren bergen, zeigt sich, als ein neuer Kunde Marîds vor seinen Augen vor einer James-Bond-Kopie umgenietet wird. Wie taktlos. Leider bleibt es nicht bei diesem Mordopfer. Auch Tamiko und eine ihrer Freundinnen, die sich als Killeramazonen auftakeln, erleiden einen vorzeitigen Exitus. Und ihre und Marîds Freundin Nikki verschwindet spurlos. Schleunigst begleicht Marîds Nikkis Schulden bei Hassan und Abdullah, doch auch dies bewahrt ihn nicht vor einem bösen Verdacht, als Abdullah ebenfalls die Kehle aufgeschlitzt wird.
Diesen Verdacht hegt jedoch nicht die Polizei unter Kommissar Okking, mit dem Marîd schon öfters zu tun hatte, sondern der Obermacker des Rotlichtviertels, Friedlander Bei. Marîd bekommt eine „Privataudienz“ mit der Option auf sofortige Exekution durch die zwei Gorillas dieses Paten. Doch er kann ein hieb- und stichfestes Alibi für Abdullahs Tod vorweisen und springt dem Tod noch einmal von der Schippe. Er erfährt, dass alle Ermordeten in Diensten Friedlander Beis standen, sei es als Kunden oder als Auftragskiller wie Tamiko. Offensichtlich will jemand die Geschäfte des Beis erheblich stören, und das kann dieser nicht zulassen.
Ein neuer Chef
Und an dieser Stelle kommt nun Marîd ins Spiel. Er sei der Einzige, so der Bei, der es schaffen könnte, schlauer als die Polizei und schneller als der Killer zu sein. Der Bei bittet Marîd daher, für ihn den Schuldigen zu finden. Und wenn er bittet, dann hat Marîd das als Befehl aufzufassen. Die Bezahlung ist fürstlich, doch die Sache hat einen Haken: Marîd muss sich aufrüsten lassen. Das schmeckt ihm überhaupt nicht, aber was bleibt ihm anderes übrig? Umsonst ist nur der Tod, und der kostet das Leben. Die eigenen Ärzte des Beis sollen die OP vornehmen. Na schön, willigt Marîd ein, froh, mit dem Leben davongekommen zu sein. Auch seine Freundin Yasmin überredet ihn, sich „verdrahten“ zu lassen.
Verdrahtet
Drei Wochen später – es ist Ramadan – erwacht Marîd mit einem Brummschädel und merkt, dass er im Bett eines recht angenehm aussehenden Krankenhausbettes liegt. Es unterscheidet sich von den Armenzimmern, die er nach einer Blinddarm-OP kennenlernte. Offenbar hat sein neuer Mäzen dafür gesorgt. Der Arzt, Herr Yeniknani, ist sehr besorgt um das Wohl und Wehe von Marîd und erklärt ihm die neuen Implantate. Marîd kann jetzt nicht nur Persönlichkeitsmodule und Software-Add-ons hochladen, um jemand anderes zu sein und zusätzliches Wissen zu erlangen. Nein, er kann noch viel mehr, weil Dr. Lîsani ihm winzige Drähte in tiefe Regionen seines Hirns eingeführt hat, damit Marîd Gefühle wie Hunger, Durst, Schlaf und sexuelle Erregung direkt kontrollieren kann. Allerdings kann er sich nicht selbst einen Orgasmus verschaffen, denn das wäre kontraproduktiv gewesen. Marîd ist beeindruckt.
Sobald er wieder entlassen worden ist, hört er, dass dieser James-Bond-Verschnitt verschwunden ist und dass seine eigene Freundin Nikki tot aufgefunden wurde – in einem Müllsack. Bei ihr findet er ein selbstgebasteltes Moddy, einen Ring und einen Skarabäus, möglicherweise Hinweise auf Herrn Leipolt, einen deutschen Kaufmann, mit dem Nikki zu tun hatte. Als er das Moddy von einer Moddy-Ladenbesitzerin testen lässt, verwandelt sich diese daraufhin in eine reißende Bestie. Marîd ist erschüttert. Aber dieses satanische Moddy kann nicht den oder die Mörder gesteuert haben, denn dafür sind die Morde zu sorgfältig durchgeführt worden. Als er Tamikos Freundin Selima, die dritte ihres Killertrios, hingeschlachtet vorfindet, warnt ihn eine mit Blut geschriebene Botschaft, dass er der Nächste sei.
Mein Eindruck
Auf den ersten Blick entspricht der Roman „Das Ende der Schwere“, den diese Story eröffnet, dem typischen Klischee für einen Cyberpunk-Roman: Modernste Technik steht im krassen Gegensatz zu dem illegalen oder zwielichtigen Milieu, in dem es eingesetzt wird. In der Regel ist der Grund für solchen Technikeinsatz aber der, dass im Untergrund und auf dem schwarzen Markt die moderne Technik – hier Persönlichkeitsmodule – erst voll ausgereizt werden. Das ist bis heute so, wenn man sich zum Beispiel Gadgets, Hacker, Designer-Drogen und das Internet ansieht.
Was den Roman über das Niveau der meisten Cyberpunk-Romane, die zwischen 1983 und 1995 erschienen (also bis zum Start der Shadowrun-Serie, als die Klischees endgültig in Serie gingen), hinausgeht, ist die Hauptfigur. Marîd Audran ist kein jugendliches Greenhorn mehr und hat bereits einige Lebensphasen hinter sich. Er lebt außerhalb der bürgerlichen Lebensgrenzen auf einem Areal, das zwar auf dem Friedhof liegt, aber als Rotlichtbezirk und Vergnügungsviertel genutzt wird. Touristen und Seeleute toben sich hier aus und, wie Audran erfährt, auch zunehmend Politflüchtlinge aus Europa.
Audran hat einen Horizont, den er ständig erweitert, und ein Händchen für Damen und Freunde. Beide sind ihm gleichermaßen treu, denn er weiß, dass er ohne sie nicht in diesem Milieu überleben kann. Er hat sich wie ein Chamäleon der Umgebung angepasst. Obwohl er, wie Friedlander Bei feststellt, Christ ist, befleißigt er sich doch bei jeder sich bietenden Gelegenheit der arabischen Höflichkeits-Floskeln, zitiert den Koran, ruft Allah an und weiß mit arabischen Geschäftsleuten umzugehen, selbst wenn es sich um die größten Halunken handelt. Kurzum: Er ist ein Überlebenskünstler, noch dazu einer mit einem Gewissen und einem (gut versteckten) Herz aus Gold. Sonst würde er nicht nach verschwundenen Freundinnen fahnden.
Das macht ihn aber noch nicht zu einem guten Detektiv. So brüstet er sich zwar mit seiner Fähigkeit, jeden geschlechtsumgewandelten Mann, der nun als Stripperin auftritt, erkennen zu können, doch als er selbst einer hübschen langbeinigen Blondine in der Villa eines Deutschen begegnet, nimmt er sie dummerweise für bare Münze und schläft mit der Hübschen. Am nächsten Morgen klärt ihn „ihre“ Abschiedsnotiz über seinen Irrtum auf: „Sie“ heißt Günther Erich von S. Marîd stöhnt, weil ihm übel wird. Schließlich war er bis jetzt strikt hetero. Und seine Menschenkenntnis hat offenbar schwer nachgelassen. Was, wenn dies auch bei Nikki der Fall wäre?
Die Austauschbarkeit von Körpern und Persönlichkeiten ist mittlerweile völlig geläufiges Standardmotiv in der Science-Fiction. Dazu muss man nur mal Richard Morgans fulminanten SF-Detektivroman „Das Unsterblichkeitsprogramm“ ansehen (siehe meinen Bericht). Diese Motive waren aber anno 1987, also drei Jahre nach der Veröffentlichung von Gibsons epochalem „Neuromancer“ noch an der vordersten Front der SF-Ideen.
3) Michael Kallenberger: Weißes Chaos (White Chaos)
Der Journalist Alan Endridge hat die Aufgabe angenommen, die Biografie des großen Mathematikers Abraham Soleirac zu verfassen. Alan steht der Aufgabe zwiespältig gegenüber. Einerseits hat Soleirac innerhalb der angestaubten Chaostheorie aufregende neue Gleichungen aufgestellt. Andererseits hat er prophezeit, dass sich der Große Rote Fleck des Planeten Jupiter binnen 20 Jahren auflösen werde. Das findet Alan absurd. Und in seinen Interviews mit dem Forscher entzieht sich dieser stets irgendwelcher Festlegung.
Wie auch immer: Alan befindet sich mit seiner Frau Jean, die bei Soleirac Physik studiert, an Bord einer Raumstation, die den Jupiter umkreist. Von hier aus lässt sich Soleirac an einem Stahlseil in einem Tauchboot in den Großen Roten Fleck hinab. Alan fragte den Forscher, was er damit beweisen wolle. Mehr oder weniger den Einfluss des menschlichen Willens auf die Gleichungen, die den Fleck bestimmen. Auch das hält Alan für zweifelhaft.
180 Tage später lässt sich Soleirac im Tauchboot wieder an Bord holen. Offensichtlich hat der geniale Mathematiker den Verstand verloren. Aber seine Exkursion war nicht umsonst: Der Große Rote Fleck in Jupiter-Atmosphäre hat sich nämlich verändert …
Mein Eindruck
Die Geschichte von Soleirac und seinem Biografen Alan schildert auf feinfühlige, kenntnisreiche und psychologisch interessante Weise die Diskrepanz zwischen dem Tun eines Wissenschaftlers und seiner Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Soleirac wird als neuer Einstein und Hawking gefeiert, und Alan hat nicht wenig dazu beigetragen. Doch der Mensch Soleirac selbst ist enigmatisch, vielleicht als Schutzmechanismus. Seit seinem 31. Lebensjahr, so entdeckt Alan, hat Soleirac nichts mehr geleistet.
Davon abgesehen gibt es noch eine weitere Ebene, die sich generell mit der Bedeutung von Theorien zur Erklärung des Universums beschäftigt. Auf dieser Ebene erhält Soleiracs Exkursion zum Großen Roten Fleck einen Sinn: als Kunstwerk. Und als Ausdruck des Aufeinandertreffens von Wille und Gleichung.
4) James Patrick Kelly: Mr. Boy (OT dito)
Die lange Novelle (ca. 80 Seiten) erzählt von ein paar Jungs in einer Zukunft, in der sich jedermann genmanipulieren lassen kann. Der titelgebende Mr. Boy heißt so, weil er, der als Peter Cage vor 25 Jahren geboren wurden, sich hat verjüngen – stunten – lassen. Jetzt hängt er mit anderen 13-Jährigen rum und himmelt eine neue Schülerin an. Seine Mutter hat sich in eine Kopie der Freiheitsstatue verwandeln lassen. In ihrem riesigen Innern isst Mr Boy und hat sein Zimmer. Ein „Genosse“ bzw. Androide erfüllt ihm alle seine kleinen Wünsche.
Der Genosse gibt ihm das Foto einer Leiche: Ein Manager der Firma Infoline wurde von seiner Frau per Kopfschuss getötet. Peter steht auf Leichen, weil sie so „extrem“ sind, ihm also einen Kick verschaffen – und seine Mutter schocken. Allerdings kriegt er genau wegen dieses Fotos mächtig Ärger mit einer Firma namens DataSafe, die es unbedingt zurückhaben möchte.
Die Spur des Fotos zieht sich durch die Story, aber auch die Geschichte von Peters Liebesgeschichte mit Treemonisha. Als er deren Familie kennenlernt, ist das ein Damaskuserlebnis: Die vierköpfige Familie lebt nackt in einem Gewächshaus. Aber das ist noch gar nichts gegen den Augenblick, als er die Wahrheit über seine Mutter erfährt …
Mein Eindruck
Zunächst wirkt der Text, der nun hin und wieder einen Absatz aufweist, als wäre es anstrengend, ihn zu lesen. Aber schon nach wenigen Seiten wird klar, dass es ganz leicht ist, ihm zu folgen. Okay, man muss hinnehmen, dass die Szene mitten im Absatz wechselt, aber das ist in Ordnung, denn auf diese Weise hält die Geschichte ihr Tempo aufrecht, und dieses Tempo ist enorm hoch. In nur 80 Seiten lernen wir eine ganze Jugendkultur kennen und die Entwicklung eines verjüngten Mr. Boy zu einem erwachsenen Mann.
Denn ein Junge kann nicht ewig ein Kind sein, nur um seiner Mutter den Gefallen zu tun, stets von ihr (und ihrem Geld) abhängig zu sein. Nein, ein Junge lernt auch mal ein Mädel kennen, das selbst ebenso wie ihre Familie ganz anders drauf ist als er. Werte verschieben sich, die Realität wird eine andere.
Zur Krise kommt es auf der Geburtstagsparty eines weiteren Schulmädchens, die sogar bis nach Japan übertragen wird. Antike Dinge wie Schallplatten aus Vinyl sowie ein altes Klavier werden hier der Zerstörung zugeführt, auf dass die Vergangenheit vernichtet werde. Ebenso wie das Stunten geht es also um den Umgang mit Alter. Alter ist relativ, und diese Kultur hat das Altern an sich zum Tabu erklärt. Bis Peter den ganzen Betrug dahinter entdeckt …
Diese Kultur ist natürlich die amerikanische und Peters Mutter ist die Verkörperung Amerikas. Daher die Gestalt der Freiheitsstatue. Doch Miss Liberty erweist sich als das genaue Gegenteil von Freiheit, nämlich als die ultimative Kontrolleurin. Auf diesem Umweg kritisiert der Autor seine Kultur, und an dieser hat sich seit 1990 nur wenig verändert. Allenfalls sind die Kontrollen nach der Verabschiedung des Patriot Act 2002 noch strenger geworden.
5) Bruce Sterling: Manamouki (OT dito)
Der kenianische Stamm der Kikuyu hat auf einer künstlichen Welt namens Kirinyaga ein neues Zuhause gefunden und lebt nun nach den alten Traditionen, die in Kenia auf der Erde schon längst durch die westliche Lebensweise abgelöst worden ist. Dies weiß Koriba, der Medizinmann des Dorfes, der auch den einzigen Computer bedient. So erfährt er, dass zwei Neuankömmlinge eintreffen werden. Sie kommen aus Kenia.
Nkobe und seine Frau Wanda entsteigen der Fähre, die sie von der Raumstation heruntergebracht hat. Eigentliche Nkobe ein reicher Mann, überlegt Koriba und fragt sich, warum er auf einer so primitiven Welt leben will, wo es nicht mal fließend Wasser gibt, geschweige denn Wasserklosetts. Es war Wanda, seine hochgewachsene Frau, die ihn dazu überredet hat, stellt sich heraus. Nun, macht Koriba ihr klar, sie muss lernen, wie ein Manamouki zu leben, wie ein weibliches Besitzstück ihres Mannes. Wanda verspricht, es zu versuchen und nimmt sogar einen anderen Namen an, den einer kürzlich Verstorbenen: Mwange.
Aber mit Mwange kommen auch neue Ideen in das Dorf Koribas, und als Erste protestiert die Erste Frau des Häuptlings. Mwanges Kleider seien viel prächtiger als ihre und würdigten sie herab. Sie ist nicht die Letzte, die sich über Mwange beschweren wird, selbst wenn Koriba noch so häufig mit Mwange redet, um sie dazu zu bringen, die Traditionen der Kikuyu zu befolgen. Doch er scheitert letzten Endes an zwei einfachen Gesetzen: Mwange ist unbeschnitten, das ist gegen das Gesetz, und zunächst duldet sie keine zweite Frau in der Hütte Nkobes. Das beschämt die anderen Frauen.
Als Koriba Nkobe und Mwange, die Manamouki, verabschiedet, hat er eingesehen, dass es zwei verschiedene Dinge sind, ein Kikuyu zu sein und einer sein zu wollen. Mwange, die sich wieder Wanda nennt, sagt ihm, dass dies zwar Utopia sein mag, aber dennoch die Stagnation in Reinkultur ist. Koriba seufzt. Und als hätte er es geahnt, beginnen die verrückten Ideen Wandas bereits Wurzeln zu schlagen – die Plagen haben begonnen.
Mein Eindruck
Diese Erzählung aus Resnicks Episodenroman „Kirinyaga“ erhielt 1991 den angesehenen Hugo Gernsback Award von den amerikanischen Lesern. Der Autor macht in anschaulichen Szenen das grundlegende Problem einer Utopie deutlich: Sie muss entweder eine radikale Abkehr vom Vorhergehenden sein, oder ein Rückfall in eine Reinform, die der Stagnation verpflichtet ist, soll sie sich nicht wieder zu jenem ursprünglichen Stadium entwickeln, das die Utopie ja gerade überwinden will.
Wie schon in seinem Roman „Elfenbein“ (siehe meinen Bericht) belegt Resnick, dass er sich mit den Traditionen der drei kenianischen Stämme Massai, Wakamba und Kikuyu bestens auskennt. Jede Szene ist glaubwürdig und leicht verständlich geschildert. Selbst wenn die Probleme der Klienten lachhaft erscheinen, so sind es die Gründe und Folgen keineswegs. Mwange, die Manamouki, wird als verflucht bezeichnet, denn sie ist kinderlos. Schon bald wird sie als Hexe bezeichnet und muss entweder vom Mundumugu, dem Medizinmann, geheilt oder erschlagen werden. Stets geht es um grundlegende Bedingungen des Lebens, also um Leben und Tod.
6) Megan Lindholm: Silberdame und der Mann um die Vierzig (Silver Lady and the Fortyish Man)
Die Silberdame ist Verkäuferin im Kaufhaus Sears. Die 35-jährige Exschriftstellerin verdient gerade mal vier Dollar die Stunde, und keineswegs Vollzeit. Das ist also zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Da fällt ihr ein Mann um die Vierzig auf, der einen Seidenschal kauft, den er gar nicht braucht. Aber er kommt wieder, und nennt sie „Silberdame“. Er hinterlässt ihr zwei Ohranhänger in Form einer eleganten Dame in Silber.
Beim dritten Mal lädt er sie ins mexikanische Restaurant ein, nennt sich Merlin, lässt sie aber sitzen, als er auf die Toilette geht. Immerhin: Sie bekommt drei Teebeutel von ihm, und ein Tee davon, „Verlorene Träume“, entführt sie ins Traumreich. Dort tritt sie als Silberdame auf und er erklärt ihr, dass ein Rivale ihn hinweggezaubert habe. Na, wer’s glaubt. Aber als sie am nächsten Tag die Kristallkugel, in der eingesperrt zu sein er behauptet hatte, durch ein Missgeschick zu Boden wirft, steht er gleich wieder neben ihr. Na, wenn das keine Magie ist!
Sie lässt sich zu ihm fahren, wo sie miteinander auf dem Boden schlafen. Schon wieder verschwindet er spurlos – nur um in ihrem Badezimmer aufzukreuzen. Schon wieder Magie? Sie glaubt nicht daran, aber sie geht gleich noch mal mit ihm ins Bett. Wer weiß, wann er wieder verschwindet …
Am nächsten Tag ist ihre Muse, die sie schmählich im Stich gelassen hatte, zurück und fordert sie neben der Schreibmaschine sitzend ungeduldig zum Schreiben auf. Vielleicht wird’s doch noch was mit der Schriftstellerkarriere.
Mein Eindruck
In der wunderbar witzig erzählten Story um die Frau ca. 35 und den Mann um 40 geht es natürlich um Singles, die es nicht in eine Ehe geschafft haben, aber nicht das Glück oder den Mumm haben, eine lukrative Stellung zu ergattern. Ziemlich gnadenlos beurteilt die Autorin die ein wenig traurige Lebenssituation ihrer Titelheldin, die kaum ihre Rechnungen bezahlen kann, nachdem ihre Muse sie im Stich gelassen hat.
Ist Merlin wirklich DER Obermagier, fragen wir uns. Natürlich nicht. Er behauptet, die Magie sei auch nicht mehr das, was sie mal war. Wie wahr – und dann lässt er die Dame sitzen. Aber vielleicht ist ja doch was dran an seinen Flunkereien. Die Autorin hält diesen Aspekt stets in der Schwebe, denn genau darum geht es ja: Vielleicht sieht die Magie heutzutage ganz anders aus als in den Fantasy- und Ritterepen von anno dunnemals.
Am Schluss hat unsere Lady etwas gewonnen, aber sie kann nicht benennen, was es ist. Ein Glaube, ein Lebensmut? Und wenn man schon von Magie spricht, so ist eine Muse auch nichts anderes als ein magisches Wesen. Und dieses existiert unleugbar. Wie der Text beweist.
7) Peter Frey: Abenddämmerung
Jarosch und seine Tochter Miriam wandern in den Wald, wo sie vor dem Ereignis zu wandern pflegten. Doch seitdem hat sich hier einiges geändert. Während die Vegetation so üppig gedeiht wie eh und jetzt, sind die Nacktschnecken auf Bananengröße angewachsen, die Steinpilze sind widerstandsfähig wie Hartgummi und in einer feuchten Kuhle leuchtet es schwefelgelb …
Mein Eindruck
Welches Ereignis das gewesen sein muss, kann man sich unschwer vorstellen: der Atom-GAU von Tschernobyl aus dem Jahr 1986. Die Wolke des radioaktiven Fallouts zog auch über weite Gebiete der Bundesrepublik hinweg. Die Isotopen reicherten sich in Pilzen und anderen Waldgewächsen an, so dass vor deren Verzehr öffentlich gewarnt wurde. Der Autor extrapoliert lediglich diese Folgen ein wenig und zeigt, welche unheimliche Zukunft auf die kleine Miriam warten könnte.
Die Übersetzung
Die Texte sind durchweg korrekt und gut lesbar übersetzt worden, doch wie so oft tauchen hie und da ulkige Druckfehler auf. So lesen wir auf Seite 7 von einer „Stürmbö“ und auf Seite 17 von einer „Dünnung“ (statt „Dünung“). Auf Seite 219 steht der seltsame, kurze Satz. „Er zielt inne.“ Erst wenn man das Z durch ein H ersetzt, erhält der Satz einen Sinn: „Er hielt inne.“
Unterm Strich
Drei bedeutende Novellen stehen in dieser 38. Auswahl teils herausfordernden, teils erheiternden Texten. Diese drei Novellen sind Effingers „Marîd lässt sich aufrüsten“, das später den Auftakt zu seinem Roman „Das Ende der Schwere“ bildete und einen Abgesang auf den Cyberpunk darstellt. Marîd ist zwar „verdrahtet“, doch er ist kein Rebell, sondern Handlanger eines Mafioso. Wo ist der „Neuromancer“, wenn man ihn braucht?
Der zweite zentrale Text ist für mich Resnicks „Die Manamouki“, das später ein wichtiges Kapitel seines noch unübersetzten Episodenromans „Kirinyaga“ (siehe meinen Bericht dazu) bildete. Hier versucht eine Kenianerin Teil der utopischen Gesellschaft auf Kirinyaga zu werden, aber ihr Ansinnen erweist sich als unmöglich umzusetzen – aber aus unerwarteten Gründen.
In der dritten Novelle entdeckt „Mr. Boy“, dass nicht nur seine Jugendlichkeit eine selbstbetrügerische Lüge ist, sondern dass seine Mutter, das fürsorgliche Monster, gute Gründe gehabt hat, ihn in seiner Jugend zu belassen. Mutter, dass ist Amerika und das eigentliche „Alien“, wie schon Lt. Ellen Ripley auf der „Nostromo“ erkennen musste.
Die Texte von Kim Stanley Robinson und Michael Kallenberger sind in ihrer Nichtlinearität und Komplexität Herausforderungen an den Leser, aber dennoch lohnenswert. Die einzige Fantasy-Story könnte Megan Lindholm alias Robin Hobb beigesteuert haben – falls es darin wirklich um Magie geht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Der letzte Text, obligatorischerweise von einem deutschsprachigen Autor/Autorin, warnt vor den Folgen der Super-GAUs in Tschernobyl: Der ach so urdeutsche Wald nimmt inzwischen unheimliche Erscheinungsformen an und wirkt wie von einem anderen Planeten. Die Idee ist zwar bieder, aber ökologisch engagiert – und handwerklich einwandfrei, ohne jedes Pathos ausgeführt.
Kurzum: Dieser Auswahlband lohnt sich für jeden Freund von hochwertiger Phantastik, insbesondere aber für Kenner des Genres. Neueinsteiger könnten mit Robinson und Kalllenberger ein wenig Mühe haben, aber besonders die Resnick-Story entschädigt sie dafür vollauf. Lindholm und Frey bieten hingegen leicht verständliche Kost.
Taschenbuch: 301 Seiten
Originaltitel: Asimov’s Science Fiction Magazine (1989-91)
Aus dem Englischen von diversen Übersetzern
ISBN-13: 978-3453053779
Heyne:http://www.heyne.de
Friedel Wahren als Herausgeber bei |Buchwurm.info|:
[„Tolkiens Erbe – Elfen, Trolle, Drachenkinder“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=2893
Manfred Kluge (Hrsg.) – Jupiters Amboss. Magazine of Fantasy and Science Fiction 49
_In den Wolken des Jupiter_
Vom traditionsreichen SF-Magazin „Magazine of Fantasy and Science Fiction“ erscheinen in dieser Auswahl folgende Erzählungen:
1) Die Story von den Menschen und Mutanten auf der Station im Jupiter-Orbit, die den Riesenplaneten beobachten, um rätselhafte Signale aus dem All entziffern zu lernen.
2) Die Story von den Besuchern vom Prokyon, die staunend und fassungslos die Lebensgewohnheiten der Menschen studieren.
3) Die Story von dem Gesandten des Bischofs, der sich zu tief in die Berge vorgewagt hatte, in denen noch andere Götter an der Macht sind.
4) Die Story von dem passionierten Angler und der Flunder, bei der er ein paar Wünsche frei hatte.
5) Die Story vom Großvater, der aus lauter Sturheit weiterlebte, obwohl er schon längst gestorben war.
_Das Magazin_
Das „Magazine of Fantasy and Science Fiction“ besteht seit Herbst 1949, also rund 58 Jahre. Zu seinen Herausgebern gehörten so bekannte Autoren wie Anthony Boucher (1949-58) oder Kristin Kathryn Rusch (ab Juli 1991). Es wurde mehrfach mit den wichtigsten Genrepreisen wie dem HUGO ausgezeichnet. Im Gegensatz zu „Asimov’s Science Fiction“ und „Analog“ legt es in den ausgewählten Kurzgeschichten Wert auf Stil und Idee gleichermaßen, bringt keine Illustrationen und hat auch Mainstream-Autoren wie C. S. Lewis, Kingsley Amis und Gerald Heard angezogen. Statt auf Raumschiffe und Roboter wie die anderen zu setzen, kommen in der Regel nur „normale“ Menschen auf der Erde vor, häufig in humorvoller Darstellung. Das sind aber nur sehr allgemeine Standards, die häufig durchbrochen wurden.
Hier wurden verdichtete Versionen von später berühmten Romanen erstmals veröffentlicht: „Walter M. Millers „Ein Lobgesang auf Leibowitz“ (1955-57), „Starship Troopers von Heinlein (1959), „Der große Süden“ (1952) von Ward Moore und „Rogue Moon / Unternehmen Luna“ von Algus Budrys (1960). Zahlreiche lose verbundene Serien wie etwa Poul Andersons „Zeitpatrouille“ erschienen hier, und die Zahl der hier veröffentlichten, später hoch dekorierten Stories ist Legion. Auch Andreas Eschbachs Debütstory „Die Haarteppichknüpfer“ wurde hier abgedruckt (im Januar 2000), unter dem Titel „The Carpetmaker’s Son“.
Zwischen November 1958 und Februar 1992 erschienen 399 Ausgaben, in denen jeweils Isaac Asimov einen wissenschaftlichen Artikel veröffentlichte. Er wurde von Gregory Benford abglöst. Zwischen 1975 und 1992 war der führende Buchrezensent Algis Budrys, doch auch andere bekannte Namen wie Alfred Bester oder Damon Knight trugen ihren Kritiken bei. Baird Searles rezensierte Filme. Eine lang laufende Serie von Schnurrpfeifereien, sogenannte „shaggy dog stories“, genannt „Feghoots“, wurde 1958 bis 1964 von Reginald Bretnor geliefert, der als Grendel Briarton schrieb.
Seit Mitte der sechziger Jahre ist die Oktoberausgabe einem speziellen Star gewidmet: Eine neue Story dieses Autors wird von Artikeln über ihn und einer Checkliste seiner Werke begleitet – eine besondere Ehre also. Diese widerfuhr Autoren wie Asimov, Sturgeon, Bradbury, Anderson, Blish, Pohl, Leiber, Silverberg, Ellison und vielen weiteren. Aus dieser Reihe entstand 1974 eine Best-of-Anthologie zum 25-jährigen Jubiläum, aber die Best-of-Reihe bestand bereits seit 1952. Die Jubiläumsausgabe zum Dreißigsten erschien 1981 auch bei Heyne.
In Großbritannien erschien die Lokalausgabe von 1953-54 und 1959-64, in Australien gab es eine Auswahl von 1954 bis 1958. Die deutsche Ausgabe von Auswahlbänden erschien ab 1963, herausgegeben von Charlotte Winheller (Heyne SF Nr. 214), in ununterbrochener Reihenfolge bis zum Jahr 2000, als sich bei Heyne alles änderte und alle Story-Anthologie-Reihen eingestellt wurden.
_Die Erzählungen _
_1) Gregory Benford & Gordon Eklund: Jupiters Amboss_
Die Menschen haben von Aliens eine rätselhafte Botschaft erhalten: ein komplexes mit den Abmessungen 29×47 (Primzahlen). Ein Himmelskörper weist auf einen großen Gasplaneten hin. Da der nächste greifbare Gasriese der Planet Jupiter ist, schicken die Menschen eine Expedition aus und errichten in der Umlaufbahn des Riesenplaneten eine Station, den Orb. Von hier aus wollen sie unter der Leitung des Weltraum-Veteranen Bradley die Gegend erkunden. Die Resultate sind gleich null. Doch der Buddha-Anhänger Bradley nimmt es mit Gleichmut.
Nicht so hingegen die genmanipulierte Forscherin Mara. Auch sie kommt von der Erde und wuchs dort bei einer langweiligen Pflegefamilie auf, bevor sie nach New York City ausriss und schließlich mit 26 auf den Orb kam. Ihre Respektlosigkeit erregt viel Anstoß, besonders bei engstirnigen Crewmitgliedern wie Rawlins. Der zweite Mutant, den Rawlins im Visier hat, ist Maras Schicksalsgenosse Corey, ein Gehirn, das in einer Metalltruhe eingesperrt ist. Mara hält Corey für eine Frau, aber da irrt sie sich.
Irgendjemand hat es auf Maras Leben abgesehen. Schon zwei Unfälle, die sie auf Sabotage zurückführt, hat sie mit knapper Not überlebt. Bradley beruhigt sie. Er hat andere Sorgen. Die politische Situation auf der Erde ändert sich zu Ungunsten der Manips, der genmanipulierten. Der Weltkongress erkennt allen manips die Bürgerrechte ab und erklärte sie zu unerwünschten Vogelfreien. Die Reaktion bleibt nicht aus, wie Mara vorausahnt: Die Manips der Erde – es sind weniger als 400 – drohen damit, Tokio in die Luft zu jagen, sollte der Beschluss nicht rückgängig gemacht werden. Bradley muss Mara Hausarrest verpassen, doch Rawlins will mehr: die Liquidierung der „Abscheulichkeiten“.
Das will Bradley verhindern, denn in seinen Augen sind Mara und Corey ihre einzige Hoffnung, die Botschaft der Fremden zu entschlüsseln. Corey hat mal mit Delphinen kommuniziert, also in einem ganz anderen Medium: unter Wasser. Und Mara beherrscht die Mathematik. Zusammen hecken sie den Plan aus, Corey auf eine Exkursion in die Jupiter-Atmosphäre zu schicken. Seine Gondel soll an einem Ballon hängen. Mara soll in einem Beiboot folgen und ihn notfalls bergen.
Während die 300 Mann starke Crew an Bord des Orbs dem Wagnis gespannt folgt, entdeckt Corey in seiner Gondel tatsächlich Aliens in den unteren Schichten der turbulenten Jupiter-Atmosphäre: silbrige Kugeln. Sie nutzen Elektromagnetismus, um akustische Signale zu erzeugen und betören den Besucher mit ihrem elektronischen Gesang. Doch dann wird ihre Annäherung unvermittelt zur Gefahr …
|Mein Eindruck|
Dieser Kurzroman gewann 1975 unter dem Titel „If the Stars Are Gods“ den begehrten NEBULA Award der amerikanischen SF-Autoren und -Kritiker, und 1977 erschien der erfolgreiche Roman dazu (dt. als „Der Bernstein-Mensch“). Dass sich der wissenschaftlich orientierte Benford mit dem Planeten Jupiter bestens auskennt, hatte er 1975 mit dem Jugendbuch „The Jupiter Project“ bewiesen (dt. bei Boje, 1978). Dieses Wissen kommt ihm bei „Jupiters Amboss“ sehr zugute.
Der Schauplatz erinnert an Arthur C. Clarkes klassische Novelle „Begegnung mit Medusa“, aber der Handlungsverlauf ist klassischer Benford. Bradley, der Stationsleiter, muss sich gegen bornierte und fanatisierte Mitarbeiter durchsetzen, um überhaupt einen Fortschritt in seiner Forschung, der Mission, zu erzielen. (Dieses Motiv taucht noch mehrmals bei Benford auf.) Aber er muss auch seine Hand über die beiden „Mutanten“ halten, die eben diesen Durchbruch erzielen könnten.
Und hier wird die Story sehr aktuell. Denn die Genmanipulierten sind ja nichts weiter als eine Zumutung, die das Andersartige an den alten Adam stellt. Uralte Ängste werden wach, Ängste vor genetischer Vermischung und Infektion, vor rassischer Unterlegenheit und vor allem religiös Andersartigen, das „des Teufels“ ist (der Antichrist also?). Diese Angst bedroht auch die heutige globalisierte Gesellschaft, in der Rassen- und Religionskonflikte an der Tagesordnung sind.
Doch Mara ist nicht wie Corey. Das Gehirn im Metallgehäuse ist wesentlich nichtmenschlicher als Mara, und Mara entdeckt auf die harte Tour, wie menschlich sie selbst doch ist – trotz aller Abstoßungsreaktionen der menschlichen Rasse gegen Ihresgleichen. Die beiden Autoren entwickeln das Szenario an Bord des Orbs ebenso behutsam wie die Entdeckungen in der Außenwelt. Keine Sensationshascherei macht die Story unglaubwürdig. Das kann jedoch zu Ungeduld bei jüngeren Lesern führen.
_2) Frederik Pohl: Der Mutterwahn (The Mother Trip)_
Die Erzählung spielt vier Versionen des klassischen Alienbesuchs durch. Sie ist also nicht faktisch orientiert, sondern spekulativ. – Also, mal angenommen, ein Mutterschiff vom Prokyon erreicht den erdnahen Raum und sucht Lebensraum. Denn an Bord hat das Mutterwesen – daher der Name „Mutterschiff“ – Mawkri ein ganzes Gelege von mehreren hundert Jungen. Der Job des Männchens Moolkri ist es nun, den potentiellen Lebensraum auf seine Eignung hin auszukundschaften.
In der ersten Version geht alles schief, denn die menschlichen Bewohner dieser Welt sind einfach viel zu paranoid, um Single-Männer allein auf den Straßen zu dulden. Der Planet wird vernichtet. In Version zwei befielt man den menschen, sich zu unterwerfen. Diese reragieren damit, dass sie das Mutterschiff abschießen. So weit so schlecht.
Version drei wirkt am hoffnungsvollsten, denn das Mutterschiff beschließt, erst einmal zu beobachten, was das für Wesen sind. Vielleicht kann man ja mit ihnen Freundschaft schließen und von ihnen lernen. Tatsächlich stößt eine der Beobachtungssonden auf eine 16-köpfige Kommune in den Bergen von Idaho oder Oregon, die ein verlassenes Haus besetzt hat und nun dabei beobachtet werden kann, wie sie nackt in einem See Rituale vollführt. Deren Sinn dem fremden Beobachter natürlich vollständig entgeht. Erste Stimmen werden an Bord laut: „Sie können einfach nicht anders!“ Hat man so was schon gehört? Verständnis für Aliens!
Die vierte Variante sieht vor, dass das Mutterschiff nie abfliegt. Vielmehr ist die Raumfahrt noch gar nicht erfunden. Das ist die deprimierendste Version. Schwamm drüber.
|Mein Eindruck|
Man braucht nur mal die Perspektive umzukehren, und schon werden wir selbst als Aliens sichtbar, die sich in die Lage von Besuchern auf einer fremden Welt versetzt sehen können. Es gibt, wie gesagt, für den Besuchsverlauf drei Varianten, vorausgesetzt, man kann den Planeten überhaupt verlassen. Die drei Varianten sind klassische Verhaltenspsychologie: Furcht und Aggression, Aggression und Vernichtetwerden, oder drittens Beobachten, Hoffen und auf ein anderes Mal warten.
Bei einem Satiriker wie Fred Pohl, einem Urgestein der SF, muss man darauf gefasst sein, dass er die Szenarien nicht ganz ernst meint. Aber er hält uns eindeutig den Spiegel vor, wie es ein Schelm tun darf. Wider Erwarten ist die Story aber nicht sonderlich lustig, sondern schwankt zwischen schwarzem Humor und leichter Ironie.
_3) Ursula K. Le Guin: Das Hügelgrab (The Barrow)_
Der Gesandte des Bischofs von Solariy ist nach Malafrena in die Berge gekommen, um bei herzog Greyga nach dem Rechten zu sehen. Dessen Priester Egius erweist sich zum Entsetzen des Gesandten als Arianer. Ketzerei! Dem entgegnet der Herzog, dass dies noch gar nichts gegen das Heidentum der Barbaren in den Bergen sei, die noch dem Gott Odne huldigen. Man könne noch ihre Hügelgräber am Wegrand sehen, die mit den Opfersteinen für Odne.
Am nächsten Tag hat sich die Stimmung des Herzogs merklich verdüstert, bemerkt der Wanderprediger nun furchtsam. Schon seit zwei schier endlosen Tagen liegt nämlich Galla, des Herzogs 17-jährige Gattin im Kindbett und soll seinen Erben zur Welt bringen. Die Hebammen sind abweisend, genauso kalt und bissig wie die eisige Nacht draußen.
Am Abend hält es der Herzog nicht mehr aus und schnappt sich den Gesandten. Mit drohend erhobenem Schwert zwingt er ihn zu jenem düsteren Hügelgrab an der Straße in die Berge, das Odne geweiht ist. Kaum hat er den Prediger erschlagen, dreht der Wind, die Kälte weicht, und das Kind wird geboren. In den Annalen der Kirche von Solariy aber werden Herzog Freyga und sein Sohn als Kämpfer für den christlichen Glauben gepriesen.
|Mein Eindruck|
Auch diese Erzählung belegt, was für eine fantastisch gute Erzählerin Ursula K. Le Guin ist. (Siehe auch meinen Bericht zu „Die zwölf Striche der Windrose“.) Mit wenigen Szenen erschafft sie eine ganze Kultur und gleich drei Religionsstufen: das sogenannte Heidentum, das orthodoxe Christentum und die ketzerische Variante des Arianismus.
Zudem lässt sie die drei sich auseinanderentwickeln, so dass der heidnische Unterboden des Christentums sichtbar wird: das Blutopfer an die Götter, so dass genau zu Ostern der Winter endet und der Weg für den Frühling frei wird. Die Ironie dabei: Erst muss der Herzog den alten Göttern opfern, bevor er als Kämpfer für den „Weißen Jesus“ hervortreten und gelobt werden kann. Hier kritisiert die Autorin Legendenbildung und Heiligengeschichtsschreibung.
Die Handlung ist in Le Guins Fantasieland Malafrena verlegt, in dem auch ihr gleichnamiger Roman spielt (siehe meinen Bericht). Es liegt irgendwo in Südosteuropa.
_4) Richard Frede: Theorie und Praxis ökonomischer Entwicklung: Der Metallurg und seine Frau_
Horowitz arbeitet als Metallurg in der Nähe von New York und kann sich bloß ein kleines Apartment leisten. Seine Frau Betsy beklagt sich, dass ständig die Klimaanlage ausfalle. Auch ansonsten ist sie stets unzufrieden, vor allem mit seinem geringen Gehalt, von dem sie sich keine Kinder leisten könnten. Sie beneidet die anderen Gattinnen, die in noblen Wohnungen in der Fifth Avenue oder Kalifornien wohnen.
Regelmäßig fährt er mit seinen Kollegen in den Long Island Sund zum Angeln. Diesmal angelt er einen Fisch, der sprechen kann. Der Fisch sagt, er sei ein verzauberter Geschäftsmann und dass er Horowitz einen Gefallen schulde. Kaum hat Horowitz den Fisch vom Haken gelassen und seiner Frau davon erzählt, als sie ihn auffordert, den Gefallen einzufordern. Der Fisch ist einverstanden, ihr ein Apartment in der Innenstadt zu besorgen.
Der Aufstieg von Betsy Horowitz zur Senatorin ist unaufhaltsam, doch als sie auch noch Präsidentin werden will, streikt der Fisch …
|Mein Eindruck|
Unglaublich, dass das traditionsreiche Magazin ein freches Plagiat vom Märchen „Der Fischer un sine Fru“ abdruckt! Offenbar war man 1977 noch nicht mit deutschen Märchen vertraut. Wie auch immer die Folie auch deutlich sein mag, so ist doch die Stoßrichtung deutlich: Der amerikanische Traum vom sozialen Aufstieg, wie ihn die stets unzufriedene Betsy träumt, ist nur hohle Fassade. Horowitz selbst macht’s richtig: Er wünscht sich sein bescheidenes Apartment zurück und lässt sich von der nimmersatten Betsy scheiden, woraufhin er wohl glücklich bis ans Ende seiner Tage lebt.
_5) Robert Bloch: Altersstarsinn (A Case of Stubborns)_
Jethro Tolliver sitzt gerade mit seiner Familie trauernd am Frühstücksstisch, als Opa Tolliver die Treppe herunterkommt und sich an den Tisch setzt. Dabei ist er doch gestern an einem Herzinfarkt gestorben – bei 90 Jahren auch kein Wunder, oder? Während allen der Appetit vergeht, wagt nur Klein Susie, die Wahrheit auszusprechen. Doch Opa Tolliver widerspricht sofort vehement und sturköpfig wie immer. Er stammt aus Missouri und will jetzt auch hier in Tennessee erst einmal einen Beweis dafür haben, dass er angeblich tot ist.
Den Leichenbestatteter Bixbee können sie noch wegschicken, aber Doc Snodgrass muss sich selbst per Inaugenscheinnahme vom lebendigen Zustand jenes Mannes überzeugen, von dem er schon den Totenschein ausgestellt hat. Da, alles schwarz auf weiß! Opa Tolliver tut das alles mit einer anzüglichen Bemerkung auf die häufige Trunkenheit des Mediziners ab.
Auch Reverend Peabody, den Ma geholt hat, ergeht es nicht besser. Er zieht erschüttert mit einer ganzen Flasche besten Tennessee-Whiskys ab. Was sollen sie nur tun, jammert Ma und Jody kann’s nicht mehr mit ansehen. Es ist höchste Zeit, was zu unternehmen, denn Opa beginnt schon zu stinken und wird von Schmeißfliegen umschwirrt. Jody ringt Ma und Dad die Erlaubnis ab, die Waldhexe zu besuchen. Er nimmt sein Sparschwein aus dessen Versteck mit, denn wer etwas von einer Hexe will, der muss ihr auch was geben. Das weiß doch jeder.
Die alte Frau lebt in einer Felshöhle am Grunde der Geisterschlucht. Sie hat sogar eine sprechende Eule, die Jody unheimlich anspricht. Das Gesicht der Hexe ist schwarz wie die Nacht. Nach einer Weile hat Jody ihr sein Anliegen erklärt und ihr sein Erspartes überreicht. Immerhin 87 Cent und eine Wahlkampfplakette von Präsident Coolidge.
Die Hexe überlegt eine Weile, bevor ihr die rettende Idee kommt. Sie gibt Jody das richtige Ding mit und erklärt ihm, wie er es anzuwenden hat. Der Junge rast los, denn die Nacht bricht herein. Was hat er nur bei sich, das Opa Tolliver endlich vom Totsein überzeugen kann?
|Mein Eindruck|
Ha, und ich werde den Teufel tun und es hier hinausposaunen! Auf jeden Fall erzielt dieses Ding den gewünschten Zweck. Im allerletzten Satz las ich dann die Pointe – und es schüttelte mich vor Ekel und Schauder. Gleichzeitig musste ich über meine eigene Reaktion lachen und über das Können des bekannten Autors von „Psycho“ und anderen Klassikern der Schauerliteratur.
Robert Bloch war ein Zeitgenosse von H. P. Lovecraft, der dem jungen Star-Autor seines Zirkels wertvolle Tipps auf den Weg gab (HPL war, neben Tolkien, einer der fleißigsten Briefschreiber des 20. Jahrhunderts.) Bloch erlebte demzufolge noch den Schauplatz seiner Geschichte in Aktion und Technicolor.
Die Tollivers leben in den Südstaaten auf einer Farm, die noch Schweine und Kühe besitzt. Wenigstens gibt es schon Autos, denn Präsident Coolidge hat bereits sein Amt angetreten. Calvin Coolidge war laut Wikipedia von 1923 bis 1929 der 30. Präsident der Vereinigten Staaten, also der Vorgänger von Herbert Hoover (1930-33) und Franklin Delano Roosevelt (1933-45). Deshalb fahren der Arzt und der Leichenbestatter per Motorvehikel vor.
Der Ton der Story lässt sich nicht anders als hemdsärmelig beschreiben. Hier war ein Yankee am Werk, kein gottesfürchtiger Ire oder Italiener (jener Zeit), und das heißt, dass die Fakten respektlos auf den Tisch geknallt werden. Die einsetzende Leichenstarre wird noch als „Rigger Mortis“ verunglimpft, und dass man als ultimatives Mittel zu einer schwarzhäutigen (Achtung: Rassentrennung!) Hexe in den Wald gehen muss, ist auch in nördlichen Bereiten, etwa in Stephen Kings Maine oder in HPLs Rhode Island, nicht ganz unbekannt.
Jedenfalls hat mir diese Geschichte einen gruseligen Spaß beschert. Und wem sich bei der Lektüre die Fußnägel aufrollen, ist selber schuld.
_Die Übersetzung_
Ich fand zwei Unregelmäßigkeiten, was doch recht wenig ist. Auf Seite 124 versteckt sich ein Druckfehler in dem Satz: „Neben der Straße ragte ein Buckel auf, kaum mannshoch, in der Form eines Grabens.“ Nun ist ein Graben per definitionem eine Vertiefung statt einer Erhöhung, kann also nicht mannshoch sein. Richtig sollte es also heißen: „in der Form eines Grabes“ oder „eines Grabhügels“.
Die zweite Unregelmäßigkeit ist ein ganzer Absatz, der so durcheinander konstruiert wurde, dass er kaum einen Sinn ergibt. Der Satz stammt aus der Fred-Pohl-Story.
„Deshalb überrascht es sie ungemein, als alle sechs Nationen, die über ein Arsenal von Atomraketen verfügen, endlich zu einem gemeinsamen Ziel vereinigt, nachdem sie bei einer Beratung mittels ihrer geheimen Direktleitungen einen Zeitpunkt festgesetzt haben, gleichzeitig den Beschuss auf das in der Kreisbahn befindliche Raumschiff Mooklris, Mawkris und des Geleges eröffnen.“
Häh??! Dunkel ist der Sinn. Wohl dem, der ihn findet. Hätte der Übersetzer zwei Sätze draus gemacht, wäre wohl klar geworden, dass sich die Nationen erst einigten und dann die Raketen abfeuerten.
_Unterm Strich_
Eine Novelle wie „Jupiters Amboss“, die zwei Drittel eines Buches einnimmt, ist natürlich dessen Haupt- und Prunkstück. Obwohl ich ihr nur vier von fünf Punkten geben würde, lohnt es sich doch, in dieses Szenario zu versetzen. Noch lieber würde ich den Roman dazu lesen.
Danben verblassen die anderen Storys ziemlich, und nur die Erzählungen von Ursula Le Guin und Robert Bloch wissen daneben zu bestehen. Die Le Guin ist sowieso überragend in fast allem, was sie veröffentlicht hat, und hier entführt sie den Leser in jene Übergangszeit vom Heidentum zum Christentum.
Den Vogel schießt hingegen Robert Blochs makaber-spaßige Schauergeschichte um den Opa ab, der nicht zugeben wollte, dass er schon gestorben war. Nur die List einer Waldhexe kann ihn davon überzeugen, dass es wirklich an der Zeit sei, sich hinzulegen und den geist aufzugeben. Die Pointe ist schlichtweg unbezahlbar.
Taschenbuch: 157 Seiten
Erstveröffentlichung im Original: 1976/77
Aus dem Englischen von diversen Übersetzern
ISBN-13: 978-3453304826
www.heyne.de
John Scalzi – Der wilde Planet
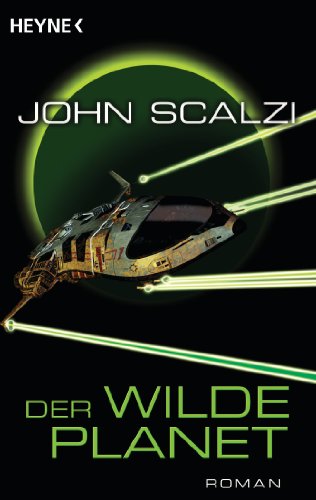
John Scalzi – Der wilde Planet weiterlesen
Wolfgang Jeschke, Robert Silverberg (Hrsg.) – Titan-15
_Gebt dem Poeten eine Marsprinzessin!_
In der vorliegenden ersten Ausgabe des Auswahlbandes Nr. 15 von „Titan“, der deutschen Ausgabe von „Science Fiction Hall of Fame“, sind viele amerikanische Kurzgeschichten gesammelt, von bekannten und weniger bekannten Autoren.
Die Kriterien der deutschen Bände waren nicht Novität um jeden Preis, sondern vielmehr Qualität und bibliophile Rarität, denn TITAN sollte in der Heyne-Reihe „Science Fiction Classics“ erscheinen. Folglich konnten Erzählungen enthalten sein, die schon einmal in Deutschland woanders erschienen waren, aber zumeist nicht mehr greifbar waren. TITAN sollte nach dem Willen des deutschen Herausgebers Wolfgang Jeschke ausschließlich Erzählungen in ungekürzter Fassung und sorgfältiger Neuübersetzung enthalten. Mithin war TITAN von vornherein etwas für Sammler und Kenner, aber auch für alle, die Spaß an einer gut erzählten phantastischen Geschichte haben.
_Die Herausgeber _
1) Wolfgang Jeschke, geboren 1936 in Tetschen, Tschechei, wuchs in Asperg bei Ludwigsburg auf und studierte Anglistik, Germanistik sowie Philosophie in München. Nach Verlagsredaktionsjobs wurde er 1969-1971 Herausgeber der Reihe „Science Fiction für Kenner“ im Lichtenberg Verlag, ab 1973 Mitherausgeber und ab 1977 alleiniger Herausgeber der bis 2001 einflussreichsten deutschen Sciencefiction-Reihe Deutschlands beim Heyne Verlag, München. Von 1977 bis 2001/02 gab er regelmäßig Anthologien – insgesamt über 400 – heraus, darunter die Einzigen mit gesamteuropäischen Autoren.
Seit 1955 veröffentlicht er eigene Arbeiten, die in ganz Europa übersetzt und z.T. für den Rundfunk bearbeitet wurden. Er schrieb mehrere Hörspiele, darunter „Sibyllen im Herkules oder Instant Biester“ (1986). Seine erster Roman ist „Der letzte Tag der Schöpfung“ (1981) befasst sich wie viele seiner Erzählungen mit Zeitreise und der Möglichkeit eines alternativen Geschichtsverlaufs. Sehr empfehlenswert ist auch die Novelle „Osiris Land“ (1982 und 1986). Eine seiner Storysammlungen trägt den Titel „Schlechte Nachrichten aus dem Vatikan“.
2) Robert Silverberg
Robert Silverberg, geboren 1936 in New York City, ist einer der Großmeister unter den SF-Autoren, eine lebende Legende. Er ist seit 50 Jahren als Schriftsteller und Antholgist tätig. Seine erste Erfolgsphase hatte er in den 1950er Jahren, als er 1956 und 1957 nicht weniger als 78 Magazinveröffentlichungen verbuchen konnte. Bis 1988 brachte er es auf mindestens 200 Kurzgeschichten und Novellen, die auch unter den Pseudonymen Calvin M. Knox und Ivar Jorgenson erschienen.
An Romanen konnte er zunächst nur anspruchslose Themen verkaufen, und Silverberg zog sich Anfang der 60er Jahre von der SF zurück, um populärwissenschaftliche Sachbücher zu schreiben: über 63 Titel. Wie ein Blick auf seine „Quasi-offizielle Webseite“ www.majipoor.com enthüllt, schrieb Silverberg in dieser Zeit jede Menge erotische Schundromane.
1967 kehrte er mit eigenen Ideen zur SF zurück. „Thorns“, „Hawksbill Station“, „The Masks of Time“ und „The Man in the Maze“ sowie „Tower of Glass“ zeichnen sich durch psychologisch glaubwürdige Figuren und einen aktuellen Plot aus, der oftmals Symbolcharakter hat. „Zeit der Wandlungen“ (1971) und „Es stirbt in mir“ (1972) sind sehr ambitionierte Romane, die engagierte Kritik üben.
1980 wandte sich Silverberg in seiner dritten Schaffensphase dem planetaren Abenteuer zu: „Lord Valentine’s Castle“ (Krieg der Träume) war der Auftakt zu einer weitgespannten Saga, in der der Autor noch Anfang des 21. Jahrhunderts Romane schrieb, z. B. „Lord Prestimion“.
Am liebsten sind mir jedoch seine epischen Romane, die er über Gilgamesch (Gilgamesh the King & Gilgamesh in the Outback) und die Zigeuner („Star of Gypsies“) schrieb, auch „Tom O’Bedlam“ war witzig. „Über den Wassern“ war nicht ganz der Hit. „Die Jahre der Aliens“ wird von Silverbergs Kollegen als einer seiner besten SF-Romane angesehen. Manche seiner Romane wie etwa „Kingdoms of the Wall“ sind noch gar nicht auf Deutsch erschienen.
Als Anthologist hat sich Silverberg mit „Legends“ (1998) und „Legends 2“ einen Namen gemacht, der in der Fantasy einen guten Klang hat. Hochkarätige Fantasyautoren und -autorinnen schrieben exklusiv für ihn eine Story oder Novelle, und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Der deutsche Titel von „Legends“ lautet „Der 7. Schrein“.
_Die Erzählungen_
_1) Judith Merril: „Nur eine Mutter“ („That Only a Mother“, 1948)_
Das Jahr 1953 ist ein Kriegsjahr, und Maggies Mann Hank tut als Soldat in irgendeinem Bunker Dienst. Daher bringt sie ihr Baby ohne ihn zur Welt. Kurz nur hat sie sich Sorgen wegen der Radioaktivität der Gegend gemacht, die sie und Hank vor ein paar Monaten durchfuhren, aber es wird schon schiefgehen. Und Henrietta, ihre Tochter, ist wirklich perfekt.
Dass Henrietta mit zehn Monaten schon vollständige Sätze wie eine Vierjährige bilden kann, findet Maggie entzückend, denn so ist sie nicht mehr so allein. Und die Kleine singt wie ein Engel. Endlich, nach 18 Monaten Abwesenheit, kommt auch Hank nach Hause, fast schon ein Fremder. Die sprechende Tochter versetzt auch ihn in gute Laune, doch schaut er sich ihren Körper etwas genauer an …
|Mein Eindruck|
Die kurze Erzählung lässt den Leser geschockt zurück. Nicht nur, weil das Baby weder Arme noch Beine hat, sondern auch weil seine Mutter dies für völlig normal hält – oder in einer Art wahnsinniger Verdrängung ausgeblendet hat. Sowohl die Mutation als auch der Wahnsinn sind eine Folge des Atomkriegs – und diese Story ist eine der eindringlichsten und meistabgedruckten zu diesem Thema, insbesondere deshalb, weil sie als eine wenigen die weibliche Perspektive berücksichtigt.
_2) Cordwainer Smith: „Checker sind passé“ („Scanners Live in Vain“, 1948)_
In ferner Zukunft beherrschen die Lords der sogenannten „Instrumentalität“ die Erde. Die Menschen leben zumeist in geschützten Städten, mit Ausnahme der „Heillosen“, die in der Wildnis den Bestien ausgesetzt sind. Die hochentwickelte Technologie der Lords hat Raumschiffe erschaffen, die die verschiedenen Erden miteinander verbinden. Doch um die Raumschiffe gefahrlos betreiben zu können, mussten zwei neue Gattungen der Spezies Mensch geschaffen werden: die nichtintelligenten Habermänner und die intelligenten Checker.
Ein Phänomen, das „Die große Pein des Weltraums“ genannt wird, lässt Normalsterbliche während des Raumflugs sterben: Ihr Körper verkraftet die Pein nicht, die entweder radioaktive Strahlung oder Kälte oder beides sein könnte. Mit Hilfe des Habermann-Apparats werden Menschen, die sich dazu bereiterklärt haben, ihrer Organe und Haut entkleidet und diese durch künstliche Apparate und Stoffe ersetzt. Das Ergebnis dieser Umwandlung sind zunächst die Habermänner; sie steuern die Schiffe durch die große Pein, denn ihre Nerven sind tot: Sie hören, sehen, tasten usw. nur durch Apparate.
Die Checker (oder, laut der Suhrkamp-Übersetzung, Seher) sind eine Weiterentwicklung der Habermänner, denn sie verfügen erstens über die Fähigkeit, einander und Menschen von den Lippen ablesen zu können und sich in ihrer geheimen Bruderschaft mit Zeichen zu verständigen. Es gibt nicht mehr als sechs Dutzend von ihren. Außerdem steht ihnen die Methode des Cranchierens zur Verfügung, um ihre Beschränkungen zu überwinden und menschliche Gefühle zu empfinden: Sie können selbst sprechen. Leider hält dieser Sonderzustand nie länger als ein paar Stunden oder Tage an.
Martel ist Sehr Nr. 34 und als einziger der Checker verheiratet; es ist ihm gelungen, Luci in einem gecranchten Zustand der andauernden Überlastung zu freien und zur Frau zu gewinnen. Luci liebt ihn wirklich, obwohl sie oftmals monatelang auf seine Rückkehr von einem Raumflug ins Auf-und-Hinaus warten muss. Seine engsten Freunde sind Taschang und Parizianski.
Martel hat gerade gecrancht, als ihn ein Notruf der höchsten Dringlichkeit vom Obersten Seher Vomact erreicht: Er soll in gecranchtem Zustand an einem Geheimtreffen der Checker teilnehmen. Rund 40 erstaunte Checker erfahren von Vomact, dass es einem gewissen Adam Stone, einem Menschen, gelungen sei, die „Große Pein“ auf einem Raumflug zu überwinden. Das bedeute, dass fortan Habermänner und Checker passé seien. Sofort wird der Tod dieses Mannes gefordert. Vomact lässt darüber abstimmen.
Martel ist darüber nicht nur empört, sondern auch besorgt. Was die Checker vorhaben, sei Mord, ruft er – doch keiner hört ihn. Doch was noch schlimmer sei: Die Eigenmächtigkeit der Checker greift in das rechtliche Territorium der Lords der Instrumentalität ein, und das werden diese nicht hinnehmen. Die Folge des Mordes könnte die Auflösung des Ordens der Checker sein – und sogar ihre komplette Eliminierung, als wären sie nichts weiter als dumme Habermänner!
Nur Tschang stimmt nicht für den Tod, während Martel durch Vomact für disqualifiziert erklärt wird – er sei ja gecrancht und somit unzurechnungsfähig und dienstunfähig. Parizianski wird zum Henker bestimmt und losgeschickt. Sobald man Martel wieder losgelassen hat und er mit Tschang hat sprechen können (der jede Hilfe verweigert), eilt Martel in die befestigte Stadt, um Adam Stones Leben zu retten. Wird er noch rechtzeitig am zentralen Raumhafen eintreffen, um das Verbrechen zu verhindern, das über das Schicksal von Welten entscheidet?
|Mein Eindruck|
Das Universum der Instrumentalität, das Cordwainer Smith erschuf, hat nicht Seinesgleichen, und deshalb erfordert es erst einmal ein wenig Mühe, sich hineinzufinden. Wir sind heute allerdings daran gewöhnt, in Begriffen wie Robotern, Androiden oder Replikanten zu denken, weil Philip K. Dick und Isaac Asimov diese Bereiche erschlossen haben. Deshalb ist eine Umstellung nötig, um uns „Habermänner“ als Roboter und „Checker“ als Androiden vorzustellen. Selbst wenn dies sehr ungenaue Übereinstimmungen sind, können sie doch als Einstieg in die Vorstellungswelt dienen.
Eine ganze Weile war mir allerdings der Unterschied zwischen Habermännern und Checkern nicht klar, bis nach etlichen Seiten eben diese Unterschiede aufgelistet wurde – natürlich nicht fein säuberlich als Checkliste, sondern mitten im Erzähltext. Und ich hoffe, ich habe alles richtig verstanden. Auch der Begriff der „Großen Pein“ ist schwammig und nur durch Vermutung zu erschließen. Merkwürdig, dass eine so fortschrittliche Technik wie die des überlichtschnellen Raumflugs (sonst würden die Flüge Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauern!) nicht in der Lage ist, solchen Phänomenen auf den Grund zu gehen.
Mitten in der Versammlung der Checker hatte ich den Eindruck, dass es eigentlich keine Handlung im üblichen Sinne gibt. Doch das stellte sich zum Glück als Irrtum heraus, denn der unabdingbare Konflikt, der eine Handlung antreibt, entsteht im Verlauf dieser Versammlung, bis sich am Schluss Martel zum Verrat entschließt. Das Finale ist geprägt von Erkenntnis und Konfrontation, wie es sich gehört. Dadurch gerät die ungewöhnliche SF-Story – der Autor bot sie den führenden Magazinen seiner Zeit vergeblich an – doch noch in ein zufriedenstellendes Fahrwasser.
Hinweis: „Checker sind passé“ ist Teil 2 des Story-Zyklus „Sternenträumer“, der bei Suhrkamp als Taschenbuch komplett vorliegt. Bei Suhrkamp heißt die Geschichte „Seher leben vergeblich“ und ist sehr stilvoll und fehlerfrei übersetzt. Davon kann in der Heyne-Fassung keine Rede sein. Deshalb empfehle ich dringend die Suhrkamp-Version.
_3) Fritz Leiber: „Maskenball“ („Coming Attraction“, 1950)_
Ein Engländer ist auf Mission in einem postnuklearen New York, das seit der Atombombenexplosion nur noch „Inferno“ genannt wird. Trotzdem leben noch Menschen dort. (Damals hielt man Radioaktivität für nicht so zerstörerisch.) Unser Mann hat die Geistesgegenwart, eine junge Frau vor den Autorowdys der Stadt retten zu können. Sie bittet ihn zu einem Stelldichein. Dort stellt sich heraus, dass sie einen Pass will, um das Land zu verlassen. Ihr Freund jedoch, ein Ringer, weiß dies zu vereiteln. Enttäuscht verlässt der Brite die Stätte dieser Offenbarung und denkt an die Rückkehr in die Heimat. Obwohl es dort auch nicht viel besser zugeht.
|Mein Eindruck|
In einer kurzen Erzählung gelingt es dem Autor, eine ganze Welt erstehen zu lassen. Das nukleare Wettrüsten hat nicht nur zu Raketenbasen der Amis und Sowjets auf dem Mond geführt, sondern auch zu vereinzelten Atomexplosionen auf der Erde, so etwa in New York. Banden treiben ihr Unwesen, und junge Frauen ringen zum Vergnügen der Zuschauer mit schwachen Männern. Amerikanische Frauen (nicht britische) tragen neuerdings Masken, nicht etwa wie im Islam, sondern um sich vor männlicher Zudringlichkeit zu schützen. Was sie aber nicht daran hindert, ihre anderen Reize zur Schau zu stellen. Rowdys machen sich einen Sport daran, mit Angelhaken bewehrte Autos s dicht an Frauen heranzusteuern, bis die Haken den Rock des Opfers herabreißen – eine seltsame Trophäenjagd.
Literarisch nimmt die Story die Stadt-Abenteuer von Harlan Ellison, Jack Womack und des Cyberpunk vorweg. Was noch zu diesem Low-life fehlt, ist die High-Tech.
_4) Tom Godwin: „Die unerbittlichen Gesetze“ („The cold Equations“, 1954)_
Dies ist eine der bekanntesten und umstrittensten Storys in der klassischen SF überhaupt. Eine blinde Passagierin muss über Bord gestoßen werden, weil das winzige Raumschiff, dessen Frachtgewicht und Brennstoffvorrat exakt bemessen sind, sonst nicht an seinem Ziel ankommen würde. Durch ihr Zusatzgewicht würde das Schiff mehr Treibstoff als bemessen verbrauchen. Nicht nur würde dadurch das Schiff mangels Bremskraft auf den Planeten stürzen, sondern auch die Forschungsgruppe, die auf die Fracht angewiesen ist, wäre zum Untergang verdammt: Das rettende Serum würde sie nicht erreichen.
Der Pilot hat die Entscheidung zu fällen, wenn er opfert: Das Schiff, das Serum und die Forscher – oder Marilyn Lee Cross. Ist es das Leben des Mädchens wert, dass so viele Menschen sterben müssen? Die Antwort der phsysikalischen Gesetze lautet nein. Aber er kann etwas für sie und den Bruder, den sie auf dem Planeten besuchen wollte, tun: Sie können per Funk voneinander Abschied nehmen. Es ist ein sehr bewegender Funkkontakt. Danach ist sie gefasst, sieht ihrem Schicksal ins Auge und geht freiwillig in die Luftschleuse …
|Mein Eindruck|
Weil dieser Ausgang der Story viele Leser und Autoren auf die Palme brachte, schrieb ein Autor – mir ist sein Name entfallen – eine alternative Story, in der die Sache gut ausgeht. Warum zum Beispiel hat das NES-Rettungsboot nicht genug Treibstoff an Bord, um zu seinem Kreuzer, dass es ausgesetzt hat, zurückkehren zu können? Warum kann das NES-Boot nicht die Atmosphäre des Planeten nutzen, um abzubremsen? Oder warum macht der Pilot nicht wenigstens ein Foto von Marilyn Lee Cross und entnimmt ihr Erbgut, damit man sie wieder klonen kann? Daran dachte wohl im Jahr 1954 noch niemand.
_5) Roger Zelazny: „Dem Prediger die Rose“ („A Rose for Ecclesiastes“, 1963)_
Eine Expedition ist auf dem Mars gelandet, auf dem eine uralte menschliche Zivilisation entdeckt worden ist. Sie verfügt über eigene Sprache und eigene Dichtung. Das ist der Grund, warum der bekannte Dichter und Semantiker Gallinger, der Ich-Erzähler, hierher gekommen ist. Er will die Hochsprache erlernen und die heilige Dichtung dieses Volkes studieren, in der Hoffnung, ihr Geheimnis zu lüften: Warum gibt es nur noch so wenige Marsianer?
In der alten Festung Tirellian steht ein uralter Tempel, doch bislang durften Menschen nur dessen Vorhalle betreten. Die älteste Mutter der Marsianer gewährt ihm Zutritt zur nächsten Halle, und ihm gehen die Augen über: Kunstschätze, Mosaiken, Schriften! In seinem Eifer erlernt er die Hochsprache binnen drei Wochen und beginnt, die heiligen Schriften zu lesen. So erfährt er von den Göttern der Marsianer, von Malann, Tamur und von Locar. Vor allem von Locar, dem der Tanz so heilig ist, dass es 2224 Variationen davon gibt.
Die Älteste lässt Gallinger bei einer Vorführung zusehen. Eine junge Frau, wie ihm scheint, Braxa, setzt mit ihrem Körper die Bewegungen des Marswindes um, doch sie ist kein Derwisch, erinnert ihn höchstens an indische Tempeltänzerinnen. Aber ihr Tanz ist kein Ritual, sondern purer Ausdruck. Gallinger ist verzaubert. Und hat sich in Braxa unversehens verliebt, sodass er ein Gedicht über sie schreibt.
Eines Nachts kommt sie zu ihm, damit er ihr sein Gedicht vorliest. Daraus wird mehr, denn er zitiert das Lied Salomos, und die beiden schlafen miteinander. Viele Nächte lang – bis Braxa plötzlich nicht mehr zurückkehrt. Gallinger macht sich auf die Suche nach der Verschwundenen, denn er ist besorgt. Braxa hat ihm offenbart, woran die Marsianer leiden: Die Männer sind durch „eine Pest, die nicht tötet“, und die der Regen (!) Locars brachte, unfruchtbar geworden. Doch wie steht es mit den Frauen? Ist Braxa von ihm schwanger, dann muss er sein Kind am Leben erhalten.
Seine Suche passt in das Muster einer uralten Prophezeiung der Marsianer, doch um sie zu erfüllen, darf er sie nicht kennen. Als er Braxa endlich gefunden hat, beschließt er, das Schicksal der Marsianer zu ändern, denn sonst ist sein Kind verloren – und seine Liebe …
|Mein Eindruck|
Der frühe Zelazny aus der Mitte der sechziger Jahre beeindruckt immer wieder durch assoziativen Stil mit zahlreichen Anspielungen. Aber das ist nicht bloßes Bildungsgeprotze und Wortgeklingel, sondern eine zweite Bedeutungsebene unter der vordergründigen Handlungsebene. Warum sonst sollte Gallinger, immerhin ein belesener Dichter, sich als Hamlet fühlen und den Expeditionsleiter Emory als „Claudius“, also als verbrecherischen Stiefvater titulieren?
Auch Anspielungen auf Darstellungen von Hölle und Paradies bei Dante, Vergil und Milton tauchen nicht von ungefähr auf, sondern weil es um die Interpretation der marsianischen Situation geht: Ist der Mars eine Hölle, und wenn ja, wodurch? Und welche Rolle können die Erdlinge dabei spielen? Sind sie Retter oder das Verhängnis für den Roten Planeten?
Aber die Geschichte ist auch eine tragische Lovestory, die süß beginnt und bitter zu werden droht. Damit es nicht zum Äußersten kommt und Gallinger nicht seine Marsprinzessin verliert, muss er etwas ganz Außerordentliches leisten: Er muss die Marsgötter verhöhnen und dem Wüstenplaneten etwas Unerhörtes schenken: eine rote Rose – denn auf dem Mars hat es nie Blumen gegeben.
Ein Faktor fehlt noch: der Prediger. Gallinger war in jungen Jahren auf dem Priesterseminar, denn er sollte die Fußstapfen seines priesterlichen Vaters treten. Stattdessen wurde er zwar Poet, doch er kennt die Bibel immer noch in- und auswendig, so auch das Buch des Predigers Salomo („Ecclesiastes“ in Englisch). Der erklärte alles Sein und Tun des Menschen für eitel Blendwerk und völlig vergebens. Gallinger nun predigt dem Marsvolk das Gegenteil, denn wie sonst kämen die Erdlinge zum Mars und könnten ihm Blumen schenken, Symbole von Leben und Schönheit? Braxa darf nicht sterben – und die Marsianer auch nicht! Wie wird die Entscheidung der ältesten Mütter ausfallen?
|Schwächen|
Natürlich ist dieser Rote Planet nicht der Mars, den wir durchs Fernrohr sehen können. Sonst könnten die Menschen hier gar nicht atmen, es wäre viel zu kalt und die Weltraumstrahlung würde sie krankmachen. Es ist vielmehr der Mars, den wir aus der Literatur kennen, aus den Marsabenteuern von TARZAN-Erfinder Edgar Rice Burroughs und den Storys von Stanley G. Weinbaum oder Robert A. Heinlein. Sogar die obligatorische Marsprinzessin ist vorhanden: Braxa, die Tänzerin des Locar. Seltsam ist allerdings ist, dass der Autor überhaupt nicht auf die große Mars-Schlucht Valles Marineris eingeht und den Riesenvulkan Mons Olympus nicht erwähnt, sondern nur einen kleinen Vetter des 25-Kilometer-Berges.
Das alles tut der Aussage der Geschichte aber offenbar keinen Abbruch, sondern hätten die SF-Freunde sie nicht zur sechstbesten SF-Story aller Jahre vor 1965 gewählt. Und das will angesichts der Klassiker von Asimov, Heinlein, Sturgeon und van Vogt was heißen. Denn ganz nebenbei liefert die Story eine Erklärung für die entvölkerte und wüstenartige Oberfläche des Mars: eine kosmische Katastrophe, die „Pest, die nicht tötet“ …
_Die Übersetzung_
Es ist ja bekannt, dass Taschenbuchübersetzungen auch schon im Jahr 1980 schlecht bezahlt worden sein müssen, aber deswegen kann der Käufer dennoch eine einwandfreie Übersetzung erwarten. Auf Seite 121 wurde aus „Menschen“ die Kurzform „Menchen“, und eine Seite weiter erwartet uns das Wörtchen „Hamben“. Da es nicht erklärt wird und es kein deutschen Wort „Hambe“ gibt, liegt der Verdacht nahe, dass es sich um eine Fehlschreibung handelt. Ersetzt man das H durch ein J, ergibt sich der literarische Fachbegriff „Jamben“, die Merhzahl von „Jambus“, einem Versmaß. Dies passt viel besser zu einem Dichter wie Gallinger.
Bei einem Vergleich der Heyne-Übersetzung von „Checker sind passé“ mit der Suhrkamp-Übersetzung „Seher leben vergeblich“ ergibt sich, dass Suhrkamps Rudolf Hermstein sowohl stilistisch als auch im Wortlaut das Original „Scanners live in vain“ sehr viel genauer und kunstvoller übertragen hat. Hier wird auch das Pathos des Geheimordens der Seher deutlich, dem die Individualerfahrung Martel gegenübergestellt wird. Der Konflikt wird deshalb auch sprachlich sinnfällig gemacht und leuchtet dem Leser ein.
Ich habe zudem festgestellt, dass das Lesen der winzig gedruckten Heyne-Sätze dazu verleitet, über die Sätze zu huschen. Das ist dem Verstehen des Textes sehr abträglich, denn hier zählt wirklich jedes Wort. Dem Freund der SF-Literatur sei also die Suhrkamp-Fassung wärmstens empfohlen, die sich in dem Erzählband „Sternenträumer“ findet.
_Unterm Strich_
Wieder bietet der Band eine Auswahl von Top-Stories. Judith Merrils Story von 1948 ist eine Reaktion auf die Atombombe von Hiroshima, „Checker sind passé“ ausd dem gleichen Jahr ist eine Vision der Ablösung des Menschen durch Roboter und Androiden. Fritz Leiber stellt sich ein radikal verändertes New York City vor, während Tom Godwin wie Cordwainer Smith an der Menschlichkeit der Raumfahrt-Utopien zweifelt.
Diesem Skeptizismus stellt Roger Zelazny ganz klar eine poetisch-hoffnungsvolle Vision in „Dem Prediger die Rose“ entgegen, die für raumfahrende Menschen erstens eine Marsprinzessin bereithält und zweitens das Heil für eine fremde Welt entgegen. Ersetzt man „Mars“ durch „Ausland“, so ergibt sich ein Bild von der Utopie des amerikanischen Friedenskorps, das allen Ländern der Dritten Welt im Auftrag JFKs die helfende, heilende Hand reichen wollte. Der Vietnamkrieg, der just im Jahr 1965 mit den ersten US-Gefechten begann (siehe „Wir waren Helden“ mit Mel Gibson), machte dieser Utopie den Garaus.
Insgesamt sind diese Erzählungen also Texte, die jeder Freund der SF-Literatur als den klassischen Kanon kennen sollte. Speziell die Novelle „Dem Prediger die Rose“ habe ich in keiner anderen Anthologie wiedergefunden – sie liegt nur hier auf Deutsch vor.
Fazit: vier von fünf Sternen wg. Punktabzug für die Übersetzung.
Taschenbuch: 159 Seiten
Originaltitel: Science Fiction Hall of Fame, Bd. 1, 1970; Heyne, 1980, München, Nr. 06/3787
Aus dem US-Englischen von Heinz Nagel|
www.heyne.de