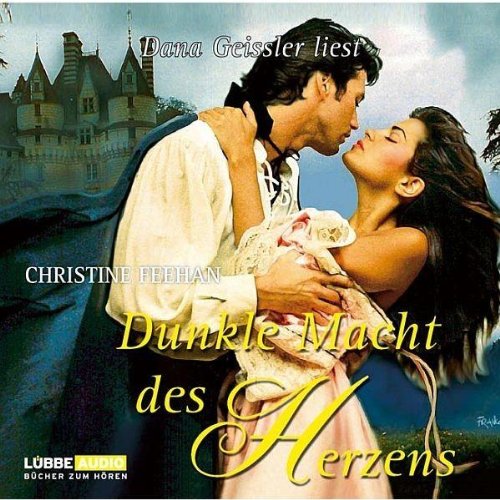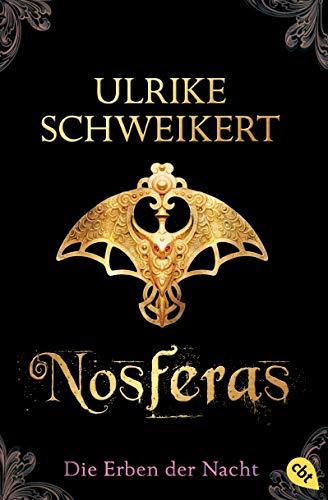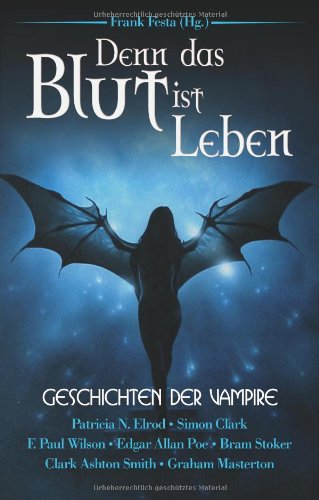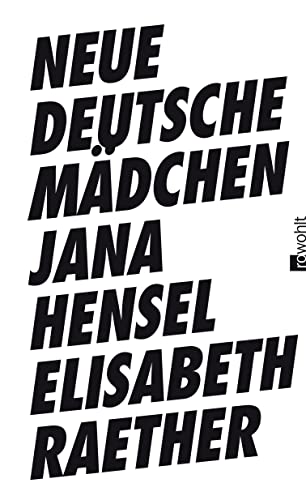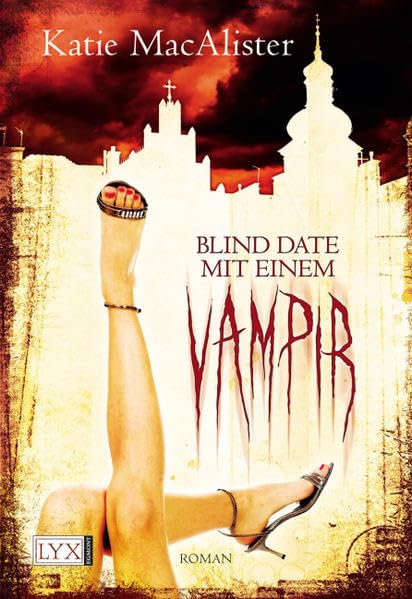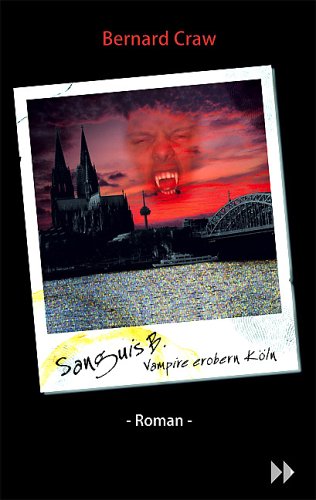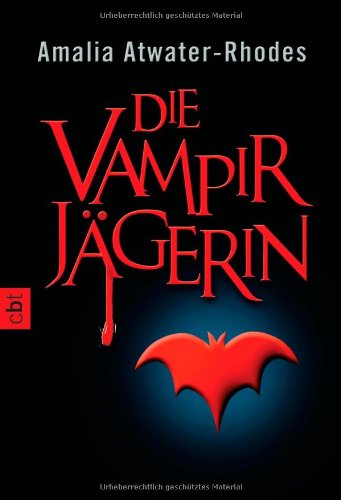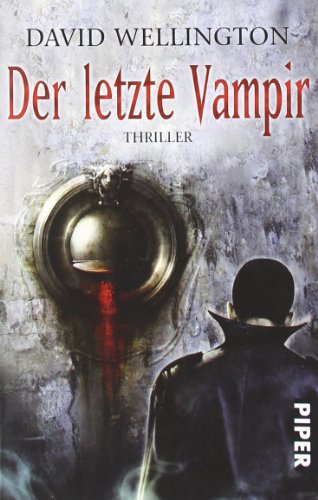Shea O’Halloran ist Amerikanerin und Chirurgin. Eigentlich ist sie aber das Lovechild der missglückten Beziehung eines Karpathianers und ihrer Mutter, was sie selbst zur Halb-Karpathianerin macht. Da sie bisher sicher noch nichts von Rumänien oder den Karpaten gehört hat und ihre Mutter schon seit Jahren tot ist, hat sie natürlich keine Ahnung von ihrem zweifelhaften Glück. Der Leser dagegen weiß sofort: Shea ist das nächste Opfer, das sich Schnulzen-Autorin Christine Feehan ausgesucht hat, um es mit einem wilden, ungezügelten und wahnsinnig männlichen Karpathianer zu verkuppeln.
Über Jahre hinweg hat sie Visionen von einem gequälten und gefolterten Mann. Shea findet das eigenartig, macht sich aber keine größeren Sorgen. Erst als ein paar Vampirjäger in ihrem Büro auftauchen (diese Dilettanten erinnern mehr und mehr an die Amateure aus „Fright Night“, sind aber leider lange nicht so unterhaltsam oder amüsant) und sie das Tagebuch ihrer Mutter zur Hand nimmt, um darin zu lesen, dass ihr verschollener Vater deren Blut getrunken hat (wir ignorieren der Einfachheit halber die Frage, wie Shea das noch nie auffallen konnte), beginnt es in ihrem Hirn zu arbeiten. Sie begibt sich nach Rumänien, angeblich, weil sie hofft, dort ein Heilmittel für ihre seltsame Blutkrankheit (hier darf die geneigte Leserin gern einmal mit den Augen rollen) zu finden. So richtig erklärt Feehan zwar nicht, wieso Shea nun gerade zu diesem Zeitpunkt unbedingt nach Rumänien muss, aber die Hauptsache ist schließlich, dass Shea am richtigen Ort ist, um sofort den Mann zu befreien, der so lange ihre Träume heimgesucht hat.
Es stellt sich heraus, dass es sich um einen gepfählten und praktisch lebendig begrabenen Vampir, pardon: Karpathianer, handelt. Jaques ist, verständlicherweise, etwas neben der Spur, und während die brillante Chirurgin versucht, das Leben des so armselig Zugerichteten zu retten, bringt er sie wiederholt fast um. Trotzdem verlieben sie sich natürlich unsterblich ineinander, und als Jacques halbwegs wiederhergestellt ist, machen die beiden sich daran, die Vampirjäger zu finden und ihnen das Handwerk zu legen. Dabei kommen ihnen irgendwann Raven und Mikhail zu Hilfe, und somit ist auch für Wiedererkennungswert innerhalb der Serie gesorgt. Raven ist mittlerweile schwanger, pikanterweise mit der (zukünftigen) Gefährtin Gregoris, was zu einigen unappetitlichen Szenen führt, in denen Gregori von seiner Liebe (oder sagen wir: Lust) zu diesem Fötus übermannt wird. Da kann es den Leser nur noch schütteln.
Natürlich geht alles gut aus, Shea und Jacques finden zueinander – immer und immer wieder, sodass der Mittelteil des Hörbuchs eigentlich nur aus aneinandergereihten Sexszenen besteht, die nur den Zweck haben, die Leserin von der ungeheuren Potenz des Protagonisten zu überzeugen. Das ist natürlich keineswegs abendfüllend, und so ist auch „Dunkle Macht des Herzens“, genau wie der Vorgänger [„Mein dunkler Prinz“, 5240 ein Hörbuch, das die Welt nun wirklich nicht gebraucht hat.
Dabei muss man zugeben, dass Feehan auf ihre Hauptcharaktere ein wenig mehr Zeit verwendet als noch im Erstling. Wir erfahren tatsächlich ein bisschen über Shea, was sie etwas greifbarer erscheinen lässt. Letztlich ist sie aber auch nichts weiter als eine Schablone: unerfahren, naiv, furchtsam, aber im Grunde bereit, für „ihren“ Mann ihr Leben zu lassen. Damit ist sie ein fragwürdiges Vorbild für die Leserin, die offensichtlich angehalten ist, jegliche Bildung, die sie (eventuell) genossen hat, über Bord zu werfen und sich stattdessen ihrem Mann zu unterwerfen, um ihm Kinder zu gebären. Schaurig.
Feehans Held Jacques hat einige Ecken und Kanten, hervorgerufen durch das jahrelange Verbuddeltsein. Offensichtlich hat er sich eine ziemliche psychische Störung eingefangen, und so schwankt er ständig, ob er Shea nun fressen oder flachlegen soll. Diese Abgründe in Jacques‘ Charakter könnten ihm sprichwörtliche Tiefe geben, wenn Feehan es verstünde, sie vernünftig auszuloten. Stattdessen ist sie unfähig, seine Qual als etwas anderes als nervtötende Unausgeglichenheit erscheinen zu lassen. Seine Stimmungsschwankungen sind kaum mehr als ein Ausdruck dafür, dass sich Feehan nicht entscheiden kann, wohin sie mit dem Charakter eigentlich will. Im Geiste ist er ein Neanderthaler (ein Wort, das Feehan selbst gern in Zusammenhang mit ihren Karpathianern benutzt), ausgestattet mit einer unberechenbaren Aggressivität – etwas, das Feehan fälschlicherweise mit Leidenschaft gleichsetzt. Er ist die starke Schulter, an die sich das plötzlich erschwachte Weibchen vertrauensvoll lehnen darf, während er, leicht dem Wahnsinn anheimgefallen, sämtliche Bösewichte der Welt von ihr fernhält.
Es wird schnell klar, dass Christine Feehan hier „Mein dunkler Prinz“ noch einmal aufrollt. Mit anderen Charakteren erzählt sie in „Dunkle Macht des Herzens“ noch einmal exakt die gleiche Geschichte, offensichtlich für Leserinnen, die es bevorzugen, immer wieder dasselbe vorgesetzt zu bekommen. Beide Geschichten sind deckungsgleich und lassen sich schlicht auf folgende Formel reduzieren: Amerikanerin, sexuell unerfahren, gerät an lüsternen Typen, der sie sofort zu seiner unsterblichen Geliebten erklärt. Den beiden stellen sich ein paar konstruierte Konflikte in den Weg, die fix gelöst werden, damit die Protagonisten nach erfolgreichem Tagwerk in die Kissen sinken können. Gähn.
Feehan hat vielleicht etwas an ihrer Charakterdarstellung gefeilt, aber auch in „Dunkle Macht des Herzens“ ist sie unfähig, tragfähige Handlungen und Probleme zu erfinden. Stattdessen bietet sie Luftblasenkonflikte, die allein durch ausgiebiges Reden gelöst werden und deren Konfliktpotenzial offenbar von den Charakteren, nicht aber vom Leser verstanden wird. Und so zaubert sie gegen Ende dann auch überraschend einen Bösewicht aus dem Hut, der in einem lang angelegten Monolog erklärt, warum er eigentlich böse ist. Man möchte der Autorin zurufen, dass solcherart unbeholfene Auflösung heutzutage höchstens noch ironisch gebrochen präsentiert wird. Feehan meint diese Szene aber durchaus ernst, offensichtlich, weil sich hier ihre schriftstellerische Begabung erschöpft. Es ist ihr einfach unmöglich, ihre (ohnehin kaum vorhandene) Handlung überraschend oder raffiniert zu gestalten. Folglich ist „Dunkle Macht des Herzens“ nur etwas für sehr unbedarfte Seelen, die sich damit zufrieden geben, immer und immer wieder dasselbe Menu aufgetischt zu bekommen.
Es scheint, als verlöre auch die Sprecherin des Hörbuchs – Dana Geissler – mit zunehmender Laufzeit das Interesse an der Geschichte. Von Zeit zu Zeit finden sich (zugegeben kurze) Sprech- oder gar Übersetzungspatzer, die von der Produktion nicht ausgebügelt wurden. In manchen Fällen ist sich Geissler bis zum Ende des Satzes wohl auch nicht ganz sicher, welchen Charakter sie gerade spricht. Wobei anzumerken wäre, dass gerade die Männer ihr überhaupt nicht gelingen. Vor allem Mikhail klingt so heiser und krächzend, dass sich beim Hören unweigerlich ein Hustenreflex einstellt.
Kurzum, „Dunkle Macht des Herzens“ ist minimal besser gelungen als „Mein dunkler Prinz“. Auf beide Hörbücher kann man aber dennoch getrost verzichten.
|Originaltitel: Dark Desire, 1999
299 Minuten auf 4 CDs
Bearbeitete Fassung
ISBN 978-3-7857-3601-2|
http://www.luebbeaudio.com
http://www.christinefeehan.com