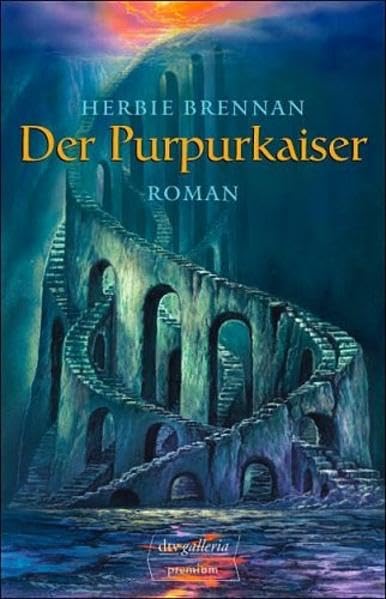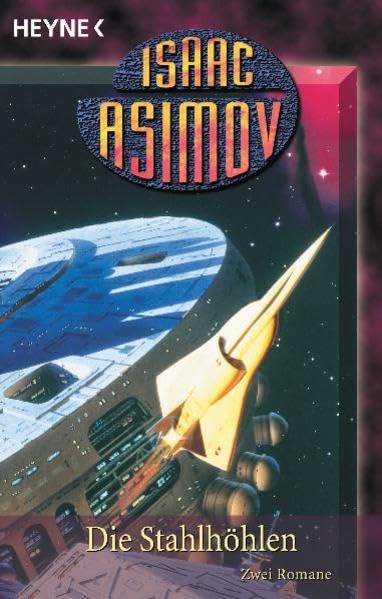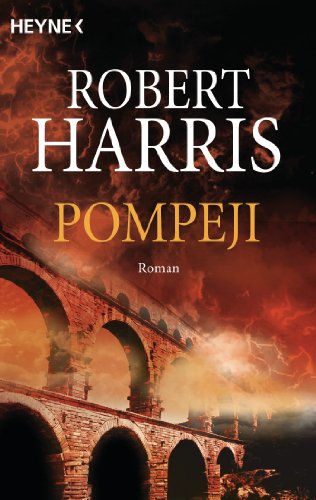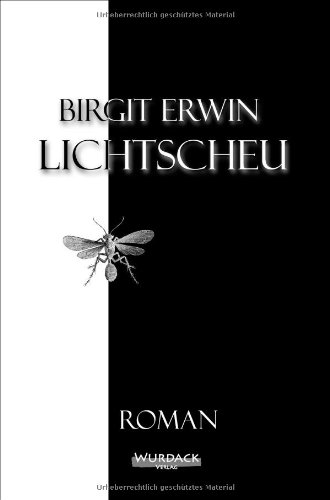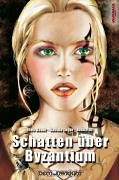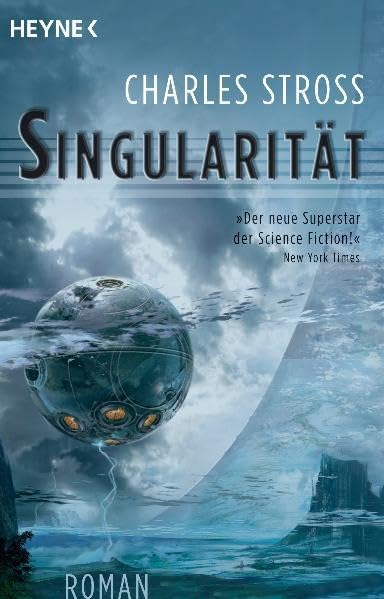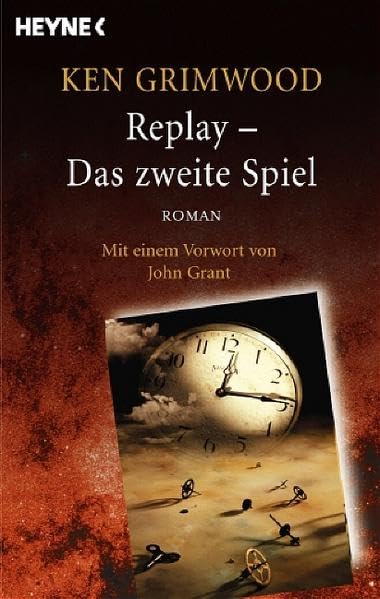In einem verschlafenen irischen Fischerdorf erwacht Duane Fitzgerald – blind und bewegungsunfähig bis auf seinen Arm. Obwohl er mit einem Kantholz auf sich einprügelt – eine bisher oft erfolgreiche Methode – bleibt er hilflos. Glücklicherweise berührt er zufällig ein bisher unbekanntes Implantat unter seiner Bauchdecke und ein Zucken lässt seinen Körper erbeben. Dieses ihm neue Implantat (obwohl er doch eigentlich seinen Bauplan auswendig kennt) scheint den Stromausfall zu bewirken, also greift Duane nach dem erreichbaren Taschenmesser, klappt die Ahle heraus (was sich in seinem Zustand als besonders kompliziert erweist) und durchstößt die Bauchdecke. Normalerweise würde ein internes System Enzyme ausschütten, die für Schmerzunempfindlichkeit gesorgt hätten, aber leider ist dieses ja derzeit inaktiv. Duane bleibt nichts anderes übrig, als sich unter Schmerzen mit der Ahle in den Eingeweiden herumzuwühlen, um den Wackelkontakt am Implantat zu beseitigen.
Andreas Eschbach
Geboren am 15.9.1959 in Ulm. Verheiratet, ein Sohn.
Studierte in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik, wechselte aber noch vor dem Abschluss in die EDV-Branche, arbeitete zunächst als Softwareentwickler und war von 1993 bis 1996 geschäftsführender Gesellschafter einer EDV-Beratungsfirma. Nach fast genau 25 Jahren in Stuttgart lebt er seit September 2003 mit seiner Frau in der Bretagne. Quelle: http://www.andreaseschbach.de/
Klar ist Duane Fitzgerald, der Ich-Erzähler des Romans, ein Cyborg – eine kybernetisch-organische Mixtur, fabriziert und entwickelt von amerikanischen Militärs, um als unbesiegbarer Steel-Man mit einigen Gleichartigen eine Sondereingreiftruppe zu bilden. Eschbach verknüpft intelligent die Zeitgeschehnisse mit seiner Geschichte. So wurde der erste Golfkrieg durch die USA nur so in die Länge gezogen, um die Steelmen rechtzeitig einsatzbereit zu machen – bis dato waren sie lediglich gut ausgebildete Marines mit einem künstlichen Arm. Erst als offensichtlich wurde, dass das Projekt nicht mit der nötigen Geschwindigkeit voranschritt, ging die Army zu der bekannten letzten Phase des Krieges über – ohne Steelmen.
Es ist ein absolut geheimes Projekt, über Jahre und mehrere Präsidentenlegislaturen hinweg in der Entwicklung. Ist es vorstellbar, dass sich so etwas – als Projekt, unabhängig vom Detail – durchführen lassen könnte bei den kleinlichen Differenzen verschiedener Machthaber? Eschbach stellt es dar, als habe das Militär seine eigene Forschung betrieben, bis schließlich Clinton die Einstellung anordnete.
Aus der Ich-Perspektive des Cyborgs, der mit Verschleißerscheinungen zu kämpfen hat, erhält die Geschichte trotz der typischen Verschwörung und der Horrorvision von unbesiegbaren Übermenschen einen humorvollen Schlag, denn seine Gedanken sind manchmal so natürlich und sprunghaft, dass man über seine Menschlichkeit lächelt und seinen Charakter sofort akzeptiert.
[…] stand da, wippte auf den Fersen und sah straßauf, straßab. Ich wurde unruhig, je länger es dauerte. Wie lange kann man schon an seinen Schuhen herumfummeln, ehe die Umwelt anfängt, das merkwürdig zu finden? […] Die Frau kam näher. […] Mit etwas Glück waren ihre Augen schlecht genug, dass ihr entging, dass ich Slipper trug […]
-Auszug aus „Der Letzte seiner Art“, S. 58
Es ist auch eine Art von Galgenhumor, die zwischen den Zeilen von Duanes Erzählung durchklingt. Eigentlich ist er natürlich völlig unzufrieden mit seinem Leben, andererseits fühlt er sich an seine Eide gebunden. Er sieht sich als menschliches Wrack, und durch den Verschleiß seines Systems erhält dieser Blickwinkel eine ganz neue, erschreckend reale Bedeutung. Die Geschichte nimmt eine Wendung, die für ihn entweder das endgültige Ende oder einen Neuanfang bedeuten könnte, doch damit einher gehen plötzlich auftretende Gefahren, die selbst für einen Steelman tödlich sein können – sind die Attentäter jetzt von den eigenen Leuten angeheuert oder vom Feind, der in den Besitz der Cyborgtechnik kommen will? Auf jeden Fall ist er gut über das Innenleben und die Möglichkeiten der Cyborgs informiert, so dass Duane nach und nach erfährt, wie seine Gleichartigen unauffällig ausgeschaltet wurden.
Zu diesem Zeitpunkt wird ihm klar, was wir schon länger befürchten: dass es um sein Leben geht, nicht nur um gewisse Annehmlichkeiten wie den frei gewählten Wohnort. Trotzdem wirken seine Gedanken (die eigentlich eine aufgeschriebene Erzählung darstellen, aber das erfahren wir erst später) manchmal in ihrer Analyse wie von einer außenstehenden Person, um dann wieder in das Innerste vorzudringen. Eschbach beginnt jedes Kapitel mit einem Zitat von Seneca, dessen Philosophie für Fitzgerald die einzige Möglichkeit darstellt, sein Schicksal zu ertragen. Er versucht, nach dieser Philosophie zu handeln und betrachtet dabei sein Bemühen skeptisch. Vor allem die Totalität des Endes fasziniert ihn, und so ist nicht verwunderlich, dass sich daraus eine Lösung für ihn selbst entwickelt.
„Der Letzte seiner Art“ ist eine Charakterstudie, die sich mit der ausweglosen Tragik eines Übermenschen befasst und in diesem Gewand ein heikles, gleichwohl sehr oft behandeltes Thema aufgreift. Was kann der Bürger schon von den Machenschaften und Projekten solcher Regierungen oder Militärs wissen? Auf der anderen Seite: Schürt man mit diesen Spekulationen nicht eine gewisse Furcht? In diesen Tagen vielleicht gar nicht so unsinnig.
Der Roman fließt ruhig dahin, unter einer stetigen Spannungssteigerung. Aber Eschbach zeigt trotzdem seine vielfältigen Künste, denn das Tempo erhöht sich schlagartig um ein Vielfaches, als der Cyborg sein System voll aktiviert (und damit schneller als jede menschliche Reaktion agieren kann). Danach fällt es wieder ab und lässt uns unseren Herzschlag beruhigen, um weiter dem Finale entgegenzustreben. Ein düsterer, philosophischer, sehr unterhaltsamer und eindringlicher Roman.