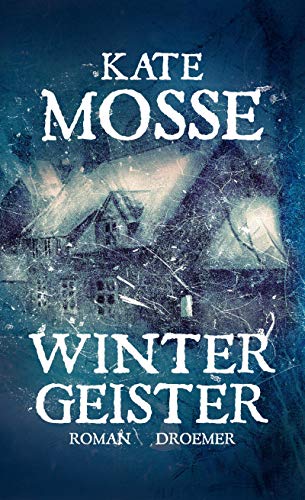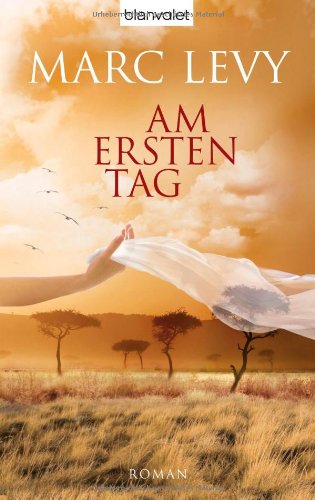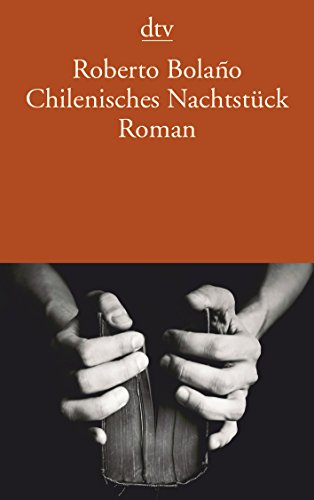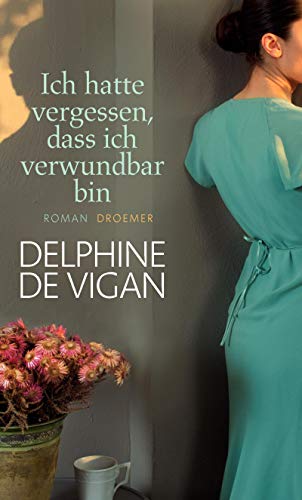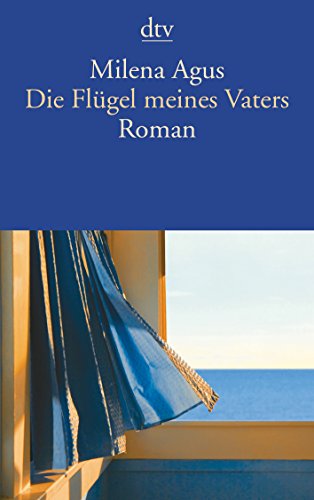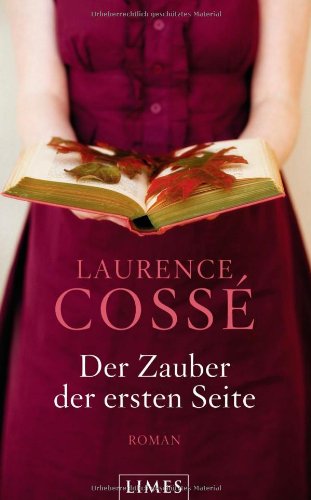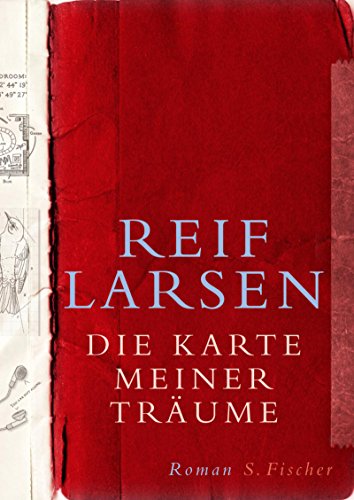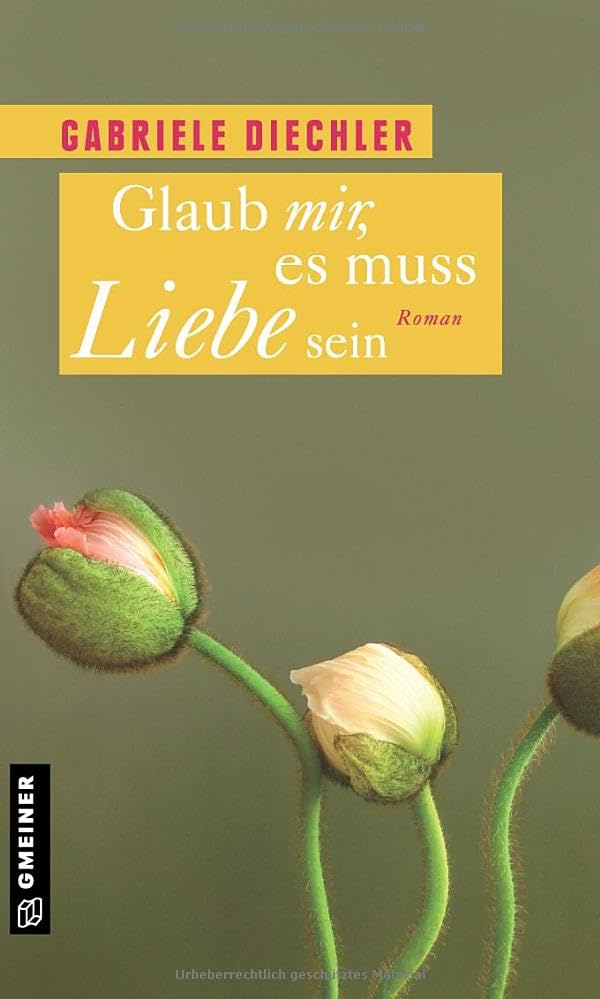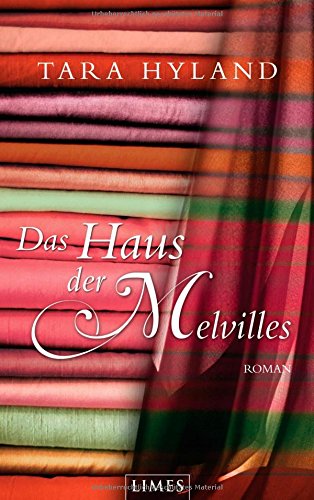_Inhalt_
Naomi Marshall hat nur mehr wenig Zerstreuung: Meist sitzt sie am Fenster und blickt hinunter in den Garten. Das Gehen fällt ihr inzwischen sehr schwer, und ihre Familie lebt nicht mehr. Etwas Abwechselung erfährt sie, als die junge Sally in eine der anderen Wohnungen im Haus zieht, sich bei ihr vorstellt und immer mal wieder auf einen Tee hereinschaut. Sally ist fröhlich, unverfälscht, plaudert zutraulich von ihrer Familie, ihren Freunden, ihren Wünschen für die Zukunft. Naomi trägt wenig bei zu diesen Unterhaltungen; sie will das lebendige Geschöpfchen nicht langweilen. Sally hakt immer wieder nach, stellt Fragen, doch Naomi bleibt stumm.
Eines Tages ist Sally fort. Sie hinterlässt eine klaffende Lücke in Naomis Alltag, und im Dröhnen der Stille beginnt die alte Dame sich zu fragen, ob sie dem Mädchen nicht doch hätte erzählen sollen, was es so gern gewusst hätte – von Afrika damals. Das erscheint so lange her und doch manchmal so nah, und dann wieder fehlen ihr Details in der Erinnerung. Sie hat doch damals eine Art Tagebuch geführt, einen Bericht über die Zeit, wo ist er nur? Sie kann daraus jetzt einen Brief verfassen, einen Brief an Sally. Natürlich wird sie nicht alles hineinschreiben, das wird die junge Frau ja kaum interessieren. Aber sie muss ihr Gedächtnis auffrischen für diese Aufgabe.
In ihrem kleinen Wohnraum beginnt Naomi die Lektüre ihrer Erinnerungen und den Brief an Sally. Äußerlich sitzt sie, gebrechlich und einsam, in ihrer Londoner Wohnung, doch innerlich ist sie wieder in Afrika, führt anthropologische Studien durch, erfährt Freuden und Leiden. Sally soll erfahren, wie es war, als der Gatte für die Kolonialstation gearbeitet hat. Sally soll erfahren, was mit Leah geschehen ist, mit jener jungen Schwarzen, die so schrecklich zwischen allen Stühlen saß. Sally soll endlich ihre Antwort bekommen.
_Kritik_
Charles Chadwick lässt Naomi als Ich-Erzählerin auftreten; wir erfahren also von ihrer unschönen Situation aus erster Quelle. Aber Naomi jammert nicht, sie sagt lediglich, wie es ist. Im Laufe des Buches respektive des Briefes finden wir heraus, dass sie schon immer so war: Wenn sie sich auch oft nicht ganz wohl fühlt, sich fehl am Platz vorkommt oder unglücklich ist, klagt sie nicht. Die Dinge sind, wie sie sind. Selten, wenn sie etwas wirklich sehr wichtig findet und das Heft in die Hand nimmt, blüht sie auf, wird lebhaft und gewinnt quasi eine Dimension hinzu.
Chadwick berührt mit seiner Geschichte, ohne ein einziges Mal in Sentimentalität zu verfallen. Er hat mit Naomi eine unprätentiöse Heldin geschaffen, die dazu neigt, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen und die dem Leser trotz ihrer zurückgenommenen Art sehr nahe kommt. Die lebensfrohe, mit kleinen Alltäglichkeiten beschäftigte und sehr junge Sally bildet zu den schwer wiegenden Gedanken der alten Dame einen reizenden Gegenpol.
„Brief an Sally“ ähnelt Chadwicks früheren Werken sehr durch den ruhigen Unterton und durch die Art, wie seine Figuren dazu neigen, Gegebenes auch als gegeben hinzunehmen. Sie sehen Glück im Kleinen, und wenn es auch dort nicht auffindbar ist, dann leben sie eben ohne. Diese ausgesprochen stoische Einstellung entbehrt nicht eines gewissen Fatalismus, wenn auch geprägt von vornehmer Zurückhaltung.
Chadwick hat einen ganz eigenen Stil, nicht zu schwierig, aber doch wunderschön, harmonisch in sich und ohne den kleinsten Ausfall. Er malt seine Bücher quasi auf die Seiten, kleine impressionistische Kunstwerke, eines wie das andere. Tiefe Lebensweisheit spricht aus den Zeilen, und ein klares Mittelmaß zwischen Optimismus und Pessimismus wird so genau eingehalten, dass es beinahe irritierend wirkt.
_Fazit_
Charles Chadwick ist ein weiser, belesener Mann. Als er im zarten Alter von 72 Jahren seinen ersten Roman veröffentlichte (|Ein unauffälliger Mann|), sprangen diese beiden Tatsachen sofort ins Auge. Mit |Eine zufällige Begegnung| untermauerte er den ersten Eindruck, den er hinterlassen hatte, und bestätigt ihn im vorliegenden Roman ein weiteres Mal.
Wir haben es hier mit einem Meister zu tun, der traumschöne Dinge mit der Sprache anstellen kann. Wer feine Zwischentöne, warme Klugheit und sachte dargebrachte Lebensweisheit zu schätzen weiß, sollte hier unbedingt zugreifen.
|Gebundene Ausgabe: 224 Seiten
Originaltitel: Letter to Sally
Aus dem Englischen von Klaus Berr
ISBN-13: 9783630873282|
[www.randomhouse.de/luchterhand ]http://www.randomhouse.de/luchterhand
[www.charleschadwick.net]http://www.charleschadwick.net