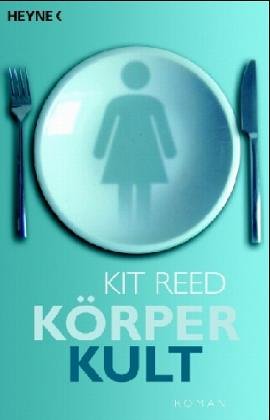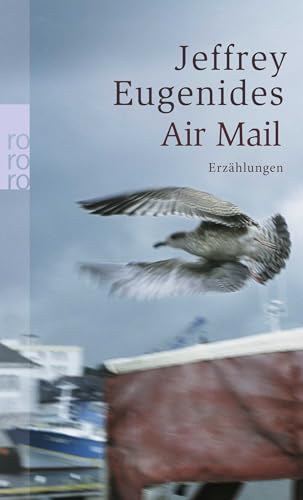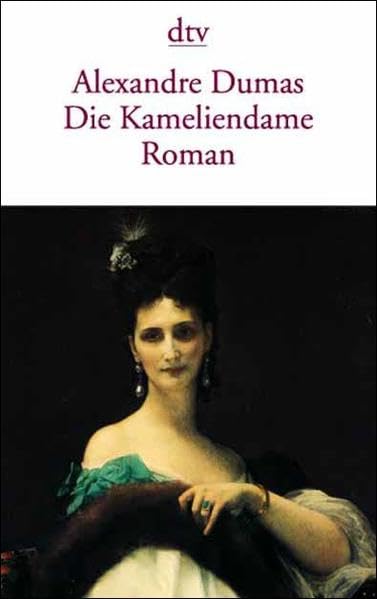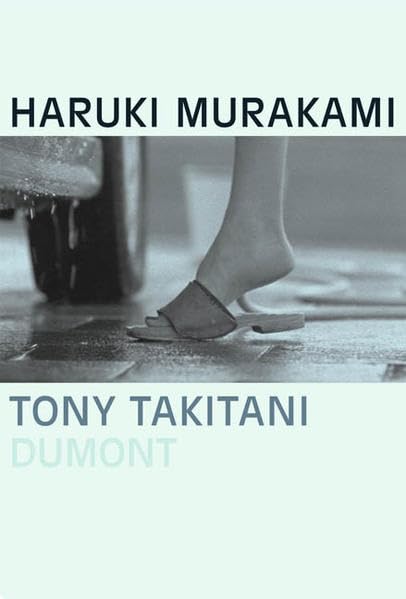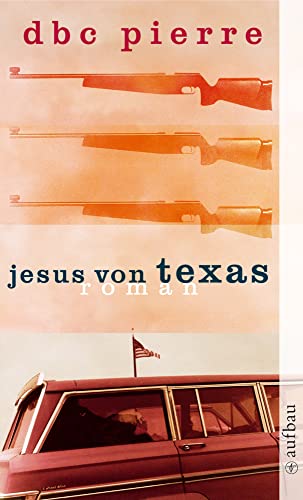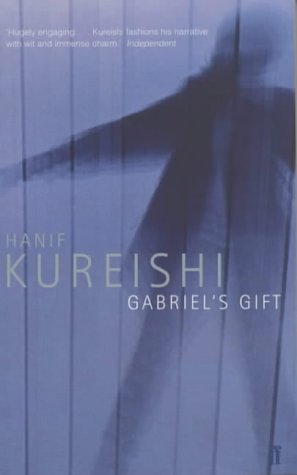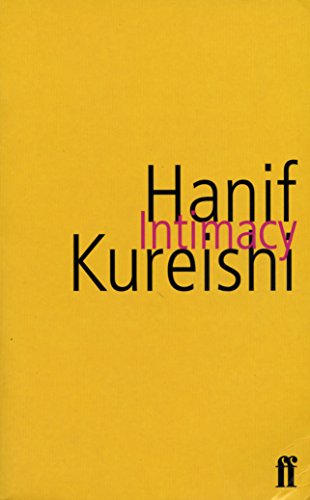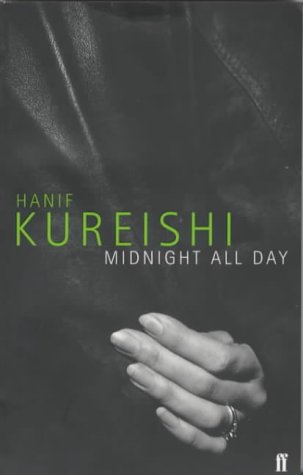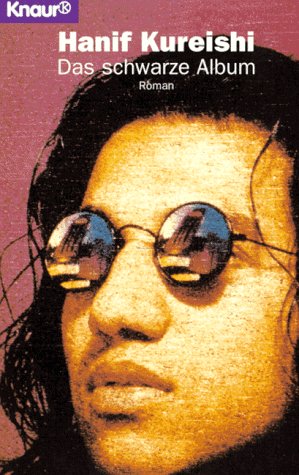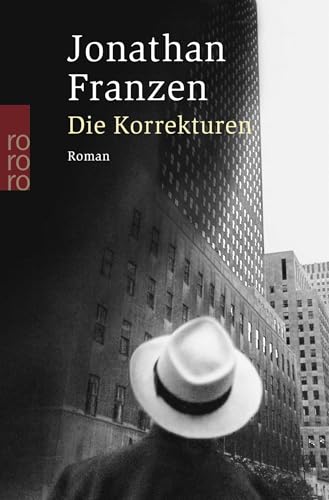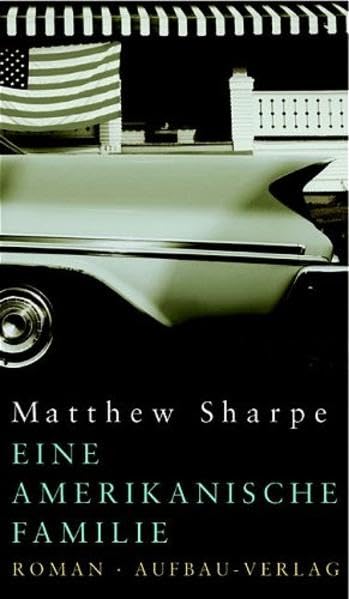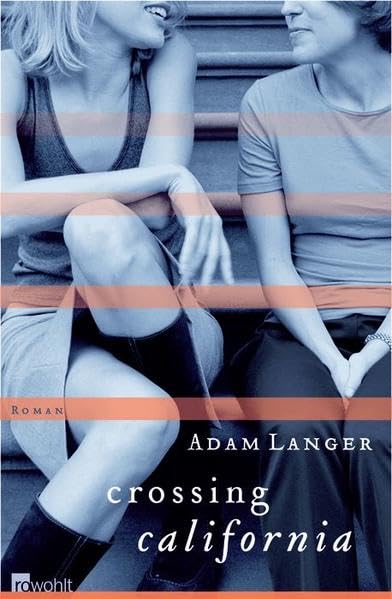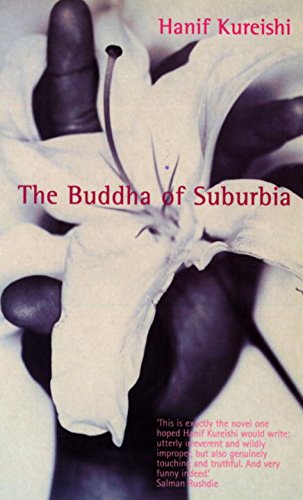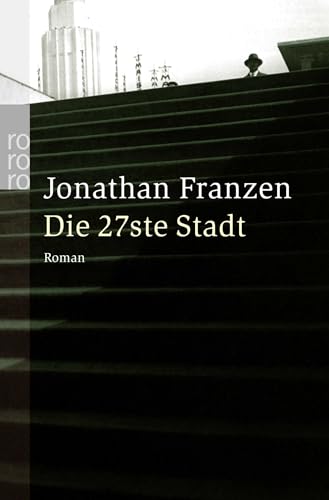Jung, schlank, schön – das Idealbild des Menschen der oberflächlichen, modernen, globalisierten Gesellschaft. In gewisser Weise trifft das schon heute zu, wenngleich mehr im Seifenopern-Leben der TV-Landschaften als in der Realität. In besonderem Maße trifft es auf die Menschen in Kit Reeds visionären Zukunftsroman „Körperkult“ zu.
_Dein Körper ist ein Tempel!_
„Körperkult“ wirft einen Blick auf das Amerika der möglicherweise nicht mehr allzu fernen Zukunft. Die Religionen versinken in der Bedeutungslosigkeit. Die Menschen glauben nicht mehr an Gott, sondern an Schönheit und Jugend. Der Körper ist der Tempel, in dem dieser neue Glaube zelebriert wird. Oberster Prediger der Glaubensgemeinschaft ist Reverend Earl Sharpnack – ein charismatischer Redner, der mit Fitnessclubs, Diätprodukten und Schlankheitskuren Milliarden scheffelt und sich ein gigantisches Imperium geschaffen hat.
Die Menschen eifern alle denselben Idealen nach: Schlank wollen sie sein, schön, gut gekleidet und auf ewig jung. Wer nicht in dieses Raster passt, wer von der Schönheitsnorm abweicht, bekommt die Folgen bitter zu spüren. Dicke werden in den Untergrund verbannt, Magersüchtige werden in geschlossenen Anstalten wieder auf Normgewicht gebracht, gut betuchte Übergewichtige erkaufen sich einen Platz in Sylphania, einem riesigen Wüstencamp, wo die Menschen gemeinschaftlich abnehmen und sich auf ein „Leben nach dem Fett“ vorbereiten.
Reed stellt in ihrem Roman mehrere Menschen vor, die ihre ganz eigenen Probleme mit dem aufgezwungenen Idealbild haben. Da wäre zum einen die 16-jährige Annie, die ihre Magersucht so lange geheim halten kann, bis ihre Eltern sie eines Tages erwischen. Da ihr Vater diese Schande möglichst schnell beseitigt sehen möchte, ruft er die „Guten Schwestern“ herbei, die Annie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in eines ihrer Klöstern bringen. Die Guten Schwestern sind ein obskurer Nonnenorden und Teil von Reverend Earls Imperium. Übergewichtige und Magersüchtige werden in ihren Einrichtungen weggesperrt, ohne Chance auf ein Entrinnen. Annies Geschwister, die Zwillinge Betz und Danny, sind nicht bereit das hinzunehmen und machen sich zusammen mit Annies Freund Dave auf die Suche nach dem Kloster, in dem Annie festgehalten wird.
Eine gänzlich andere und dennoch sehr ähnliche Geschichte erzählt Jeremy. Der reiche aber übergewichtige Geschäftsmann hat sich für viel Geld einen Platz in Sylphania erkauft, um dort abzuspecken. Als er dort ankommt, stellt er schon bald den erschreckenden Unterschied zwischen Schein und Wirklichkeit fest. Das Leben in dem Camp in der Wüste ist hart. Es gibt kaum etwas zu essen und Jeremy wird harte Arbeit abverlangt. Seine Aussichten auf eine „Erlösung im Leben nach dem Fett“ schmelzen schneller dahin als die Pfunde auf seinen Hüften. Unzufriedenheit macht sich breit. Und er ist nicht der Einzige, der mit der Zeit immer mehr das Bedürfnis hat, den falschen Propheten Earl Sharpnack von seinem Sockel zu reißen. Es formieren sich Kräfte, die einen Aufstand herbeiführen wollen …
_Globalisierte Seifenopernrealität_
Auf den ersten Blick scheint „Körperkult“ sich in eine Reihe mit Globalisierungssatiren wie [„Logoland“ 96 von Max Barry stellen zu können. Die Thematik ist ähnlich. Es geht um die globalisierte Gesellschaft von morgen. Während „Logoland“ einen Schwerpunkt auf den Markenterror setzt, geht es bei „Körperkult“ um die Oberflächlichkeit einer Gesellschaft, die auf Äußerlichkeiten mehr Wert legt als auf Persönlichkeit und Charakter. Eine gesellschaftliche Tendenz, die sich auch heute schon, geschürt durch die Scheinrealität des Fernsehens, erkennen lässt.
Reed skizziert vor diesem Hintergrund ein Szenario, das von der satirischen Überspitzung lebt. In vielen Aspekten unterscheidet sich die Welt von „Körperkult“ nicht großartig von unserer. Der Grad der Technisierung entspricht in etwa heutigem Standard, so dass Reeds Utopie in Teilbereichen durchaus bodenständig und zeitgemäß wirkt. Alle Dinge, die sich um Schönheit, Essverhalten und Alter drehen, wirken dagegen schon recht schräg.
Es herrscht ein aus heutiger Sicht absolut überzogenes Figur- und Fitnessbewusstsein vor. Fast-Food-Ketten gibt es zwar immer noch, aber dort sündigen kann natürlich nur, wer anschließend im Fitnessstudio Buße tut. Das sind für sich genommen noch die harmloseren Auswüchse von Reeds figurbewusster Gesellschaft und es gibt auch heute schon genug Menschen, deren Denkweise ähnlich (wenngleich weniger radikal als bei Reed) erscheint. Allein der Blick auf die Milchprodukte eines durchschnittlichen Kühlregals im Supermarkt suggeriert auch heutige schon ein Mantra, das ebenso gut von Reverend Earl stammen könnte: Fett ist böse! Selbst wenn es nur die 3,5 Prozent der Vollmilch sind. So unglaublich die Geschichte von „Körperkult“ auch zunächst klingen mag, so ganz unvorstellbar erscheint sie nicht.
Radikaler wird Reeds Utopie, wenn sie ihren Blick auf die Menschen richtet, die es nicht schaffen, die aufgezwungene Norm zu erfüllen. Die Klöster der „Guten Schwestern“, hermetisch abgeriegelt von der Gesellschaft, wirken wie ein Zwischending aus Gefängnis und Krankenhaus. Wer hier fliehen will, hat schlechte Karten und wird obendrein brutal bestraft – das bekommt auch Annie zu spüren.
Sylphania setzt dem noch eins drauf. Ein riesiges Camp mitten in der Wüste. Wer sich hier mit viel Geld einen Platz zum Abspecken sichert, haust in einem verrosteten Wohnwagen, wird wie ein Gefangener behandelt und hat nur geringe Aussichten, jemals davon erlöst zu werden. Wer hier nicht abspeckt, hat weder einen Chance auf Verbesserung seiner Situation noch auf Freiheit. Es gibt eine strengere Hierarchie, die Reverend Earl medienwirksam in seinen wöchentlichen TV-Shows in Szene setzt. Die, die es schaffen, von ihren überflüssigen Pfunden erlöst zu werden, werden zu so genannten Engeln befördert, ziehen in das fürstliche Clubhaus ein, genießen Hummer zum Frühstück und das von Reverend Earl stets propagierte „Leben nach dem Fett“. Sylphania ist in Erscheinungsbild und Organisation noch einen Tick radikaler als die Klöster der „Guten Schwestern“. Das Ganze erinnert an eine Mischung aus Internierungslager und „Big Brother“.
Das wirkt für sich betrachtet schon recht abgedreht, dennoch erschien mir Reeds Roman nicht ganz so bitterböse, wie es beispielsweise Max Barrys „Logoland“ ist. Die Grundidee überzeugt zwar durchaus, dennoch weiß Reed ihre Geschichte nicht ganz so gut zu verkaufen wie Max Barry. Letztendlich gibt es vier verschiedene Erzählstränge: die Suche der Zwillinge nach Annie, Annies Erlebnisse bei den „Guten Schwestern“, Jeremys Erlebnisse in Sylphania und die Suche von Annies Mutter nach ihrer Tochter. Gerade der zuletzt genannte Erzählstrang wirkt wenig überzeugend. Annies Mutter wird für den Leser nicht so recht greifbar. Sie bleibt ein wenig fremd und wie der Erzählstrang am Ende mit den übrigen verknüpft wird, erscheint schon ein wenig holprig.
Auch die eine oder andere Frage, die mehr oder weniger ungeklärt im Raum zurückbleibt, trübt am Ende ein wenig die Freude. Der bereits im Klappentext versprochene Aufstand tritt erst auf den letzten 50 der insgesamt 381 Seiten ein und verläuft weniger radikal als man von einer „bitterbösen Satire“ (Zitat Klappentext) eigentlich gerne erwarten möchte. Insgesamt bleibt das Ende, das Reed mit einigen offen in den Raum gestellten Fragen dem Leser allein überlässt, ein wenig schwammig und unbefriedigend.
Auch mit Blick auf die Erzähltechnik bleibt ein etwas durchwachsener Eindruck zurück. Reed wechselt nicht nur immer wieder die Handlungsebenen, sie wirkt auch in ihrem Erzählstil teils etwas sprunghaft. So tauchen unvermittelt immer wieder Passagen auf, die direkt an den Leser gerichtet sind und sich auch in der Anrede direkt an ihn wenden. So ganz stimmig mit dem übrigen Text wirkt das leider nicht immer. Auch der eingebaute Wechsel der Erzählperspektive im Jeremy-Erzählstrang überzeugt nicht wirklich. Alles, was der Leser über Jeremy erfährt, wird in Form seiner eigentlich in Sylphania verbotenen Tagebuchaufzeichnungen dokumentiert. Die sonst neutrale Erzählperspektive wechselt hier immer zu einem Ich-Erzähler. Als es dann allerdings auf den Showdown zugeht, wechselt auch dieser Erzählstrang in die neutrale Erzählperspektive, was etwas unglücklich wirkt.
Die Figurenzeichnung überzeugt mal mehr, mal weniger. Manche Figuren laden zum Mitfiebern ein, andere lassen einen weitestgehend kalt. Jeremy und Annie werden am eindringlichsten geschildert und hinterlassen auch den meisten Eindruck, während die Zwillinge und Dave schon etwas blasser bleiben. Annies Mutter dagegen wirkt etwas deplaziert und der ganze Erzählstrang um sie herum wie Füllwerk.
Der Spannungsbogen wird durch ständige Perspektivenwechsel bestimmt. Der Leser begleitet mal die eine Figur, dann wieder eine andere. Dabei schafft Reed es oft, den Leser neugierig darauf zu machen, wie es in den anderen Teilen der Handlung weitergeht. An manchen Stellen nutzt Reed aber auch die Perspektivenwechsel mit ihrem Potenzial zur Spannungssteigerung nicht aus. Die spannendsten Erzählstränge sind logischerweise die, die von ständigen Fluchtgedanken geprägt sind, wie es bei Jeremy und Annie der Fall ist. Besonders diese beiden Erzählstränge tragen im Wesentlichen die Spannung weiter, während die übrigen Handlungsteile nicht immer durchgängig spannend sind.
Alles in allem bleibt am Ende ein etwas durchwachsener Eindruck zurück. Die Grundidee der Geschichte, das Gesellschaftsbild, das Reed in ihrem Roman skizziert, wirkt absolut überzeugend und macht den Roman durchaus lesenswert. Die Art, wie Reed mit ihrem Bild des vom Schönheitswahn getriebenen Amerika auf satirische Art Denkanstöße zur heutigen Gesellschaft liefert, weiß durchaus zu überzeugen. Über ein paar Schönheitsfehler der Erzählung kann diese Tatsache allerdings nicht ganz hinwegtäuschen. Die Erzähltechnik wirkt manchmal ein erzwungen und auch die Balance zwischen den einzelnen Erzählebenen wirkt nicht immer solide. Eine Reihe unbeantworteter Fragen aus dem Handlungsverlauf geben ebenso zu denken wie das offene, unbefriedigende Ende.
Fazit: Nicht immer hundertprozentig schlüssig und erzählerisch souverän, aber schon aufgrund des entworfenen Szenarios dennoch lesenswert.