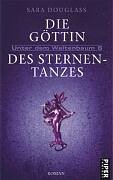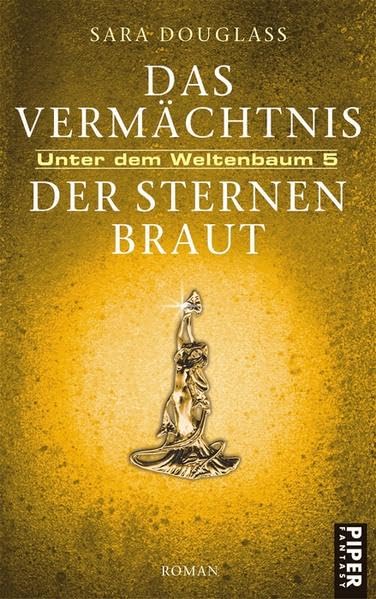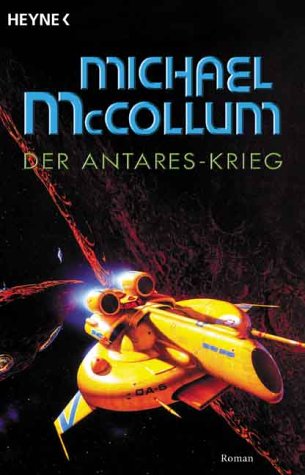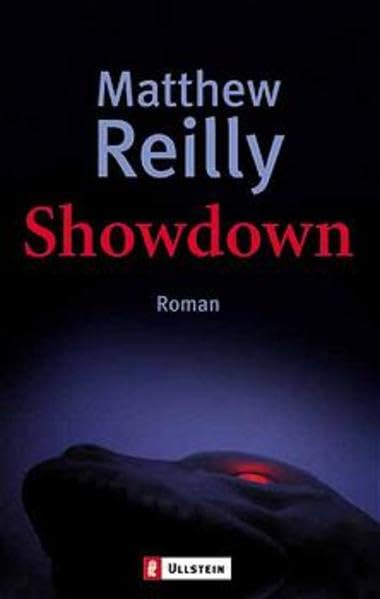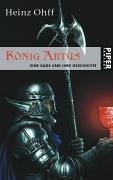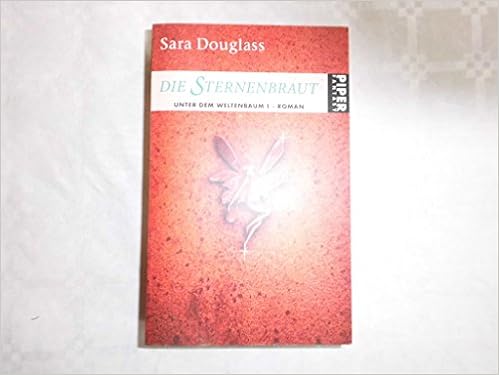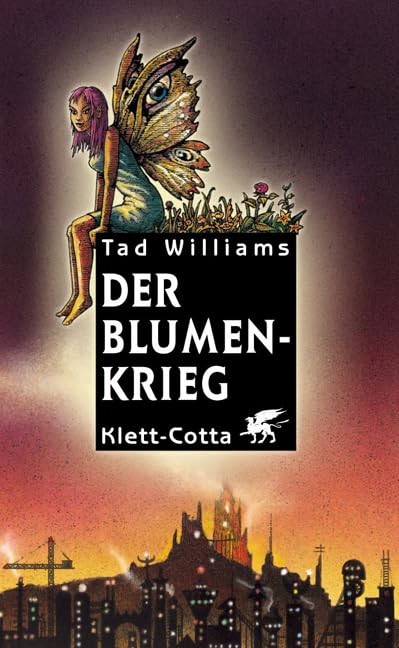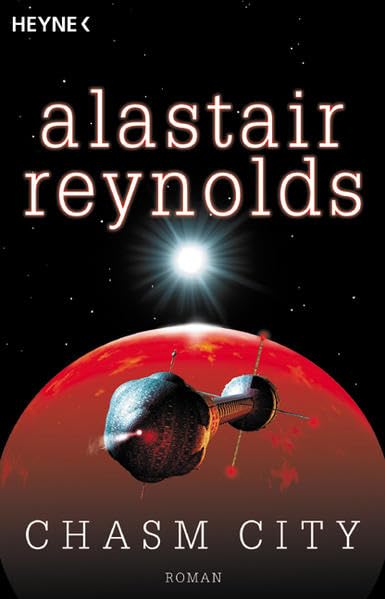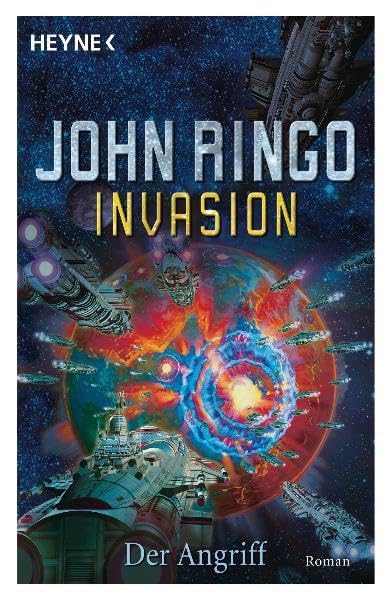Teil 1: Die Narbe
Die schwimmende Stadt Armada, zusammengestückelt aus einer unüberschaubaren Zahl großer und kleiner Schiffe und Wracks, gezogen von den gewaltigen Kräften des Avanc, einer inselgroßen Kreatur aus den Tiefen der Meere Bas-Lags – auf der Suche nach der Narbe, der mythischen Wunde der Welt, Quell einer magischen Macht …
Der Autor
China Miéville wurde 1972 in England geboren. Nach Abschlüssen in Sozialanthropologie und Wirtschaft unterrichtete Miéville in Ägypten. Während sein für mehrere Awards nominierter erster Roman „King Rat“ noch leer ausging, wurde „Perdido Street Station“ mehrfach ausgezeichnet (unter anderem mit dem Arthur C. Clarke Award und dem Kurd-Laßwitz-Preis). Nach „Perdido Street Station“ ist „The Scar“ (deutsch: „Die Narbe“, „Leviathan“) sein zweiter Roman aus der phantastischen Welt Bas-Lag.
Inhalt
Die Wissenschaftler Armadas haben es geschafft, den Avanc, das Wesen aus dem Raum zwischen den Realitäten, mit thaumaturgischen Kadabras und der Hilfe eines von der Linguistin Bellis Schneewein übersetzten Buches zu ködern und als Zugtier für die Piratenstadt einzuspannen. Nie zuvor durchstreifte Armada die Meere Bas-Lags mit dieser Geschwindigkeit und Zielstrebigkeit, wie es ihr nun die Beherrschung des Giganten gestattet.
Und die mächtigste Führungsgruppe hat weitere Ziele. Sie gibt sich nicht mit der neuen Beweglichkeit zufrieden, sondern strebt nach größerer Macht, die sie an der unnatürlichen Wunde der Welt zu finden hofft. Dort, so sagen die Legenden und Mythen, seien die Naturgesetze aufgehoben, es herrsche ein Zustand der Possibilitäten, die je nach Grad ihrer Wahrscheinlichkeit zu tausenden parallel existieren – selbst widersprüchliche Zustände.
Doch werden der Bevölkerung Armadas die Fakten vorenthalten und sie wird über die wahren Ziele getäuscht. Der Brucolac, stärkster Gegner des Plans, probt die Meuterei, als sich fremdartige Wesen in den Konflikt einschalten. Mit ihrer Hilfe erhofft er sich eine Wendung der Stadt, zurück zu ihrem Alltag als Piratenstadt. Die Fremden handeln dabei nicht uneigennützig: Sie wurden von einem Mann betrogen und beraubt, der sich seit dem Überfall Armadas auf die Terpsichoria (siehe: „Die Narbe“) an Bord Armadas befindet. Ihm und dem Diebesgut gilt ihr Trachten. Und so kommen die Fremden und der Brucolac, Herr der Vampire, in ihr verhängnisvolles Geschäft. Nicht verhängnisvoll für die Fremden, denn sie sind wahrlich zu fremdartig …
Kritik
Es ist nicht einfach, ein Buch zu besprechen, das als zweiter Teil eines in der Originalsprache einzelnen Romans erschien. „Leviathan“ knüpft nahtlos an die Geschehnisse in „Die Narbe“ an. Guter Zeitpunkt, um ein Wort über die Titel zu verlieren. In der Narbe wurde sie selbst höchst verschwommen und indirekt erwähnt, dort ging es eher um die Köderung des Avanc, der ein wahrer Leviathan ist. Andersherum richtet sich der Blick im vorliegenden Buch, das den Titel „Leviathan“ trägt, immer stärker auf die Narbe, die Kluft in der Welt. Da hat wohl jemand die Titel vertauscht? Passend dazu die entsprechenden Klappentexte, die jeweils dem anderen Buch besser stehen würden.
Genug davon.
Bellis Schneewein erlebt eine herbe Enttäuschung. Alle Aktionen, alles, was sie anderes tut als die anderen Bewohner Armadas, ist geplant, sie wird von den einzelnen Machtgruppen manipuliert. Da ist beispielsweise Silas Fennek, der ihr von der großen Bedrohung ihrer Heimatstadt New Crobuzon berichtete und sie auf die gefährliche Reise zur Anopheles-Insel schickte, um eine Nachricht, eine Warnung rauszuschmuggeln. Jetzt erfährt sie über deutliche, blutige Zeichen (eine gnadenlose Schlacht auf den Meeren), dass Fennek nur sein Wohl im Auge hatte und die Flotte New Crobuzons gegen die Piratenstadt gelenkt hat. Bellis beichtet sogar entsetzt und wird von jenen ausgepeitscht, die sie in ähnlicher Weise benutzen, um eine Meuterei anzuzetteln. Als ihr das klar wird, erinnert sie sich, „[…] was sie in Douls Augen gelesen hat. Wieder ein Werkzeug, denkt sie, fassungslos und staunend. Wieder ausgenutzt[…]“.
Und trotz dieser Erkenntnis führt sie den eingeschlagenen Weg zu einem Ende, denn es ist der einzige Weg für sie zurück. So stellt sich das ohne viel Drumherum dem Leser dar, denn die bildgewaltige Sprache Miévilles hält sich mit einengenden Details zurück. Subtil entwirft er das Bild der Welt, die Charaktere entwickeln sich mit jeder Seite und werden deutlicher. Die kleinen Details erzeugen ein Gefühl für den Zustand, das Wesen, die Philosophie dieser Welt, die in ihrer Gesamtheit noch immer anders ist, faszinierend anders.
Während Bellis Schneewein in der „Narbe“ wichtige Erkenntnisse gewann und die Expedition voran trieb, ohne es wirklich zu wollen, tritt sie jetzt mehr in den Hintergrund, hat ihre Aufgabe erfüllt, ist nutzlos. So lassen die Herrscher ihre Werkzeuge fallen und schaffen sich damit eine große Gegnerschaft, die sich brodelnd zurückhält, bis es zum Eklat kommt. Aber Bellis bleibt weitgehend außerhalb der Masse, wird von hintergründigen Spielern manipuliert und protegiert. Fühlt sich schlecht dabei, wenn sie kleine Splitter des Intrigenpuzzles zusammensetzt. Aber ihre Intention ist klar: Sie will weg, keine Abenteuer an der Narbe, keine Reise mit dem Avanc, aber auch keine Piraterie mit Armada. Eigentlich will sie nach Hause.
Fazit
Die Welt Bas-Lag erhält mit jeder Seite mehr Tiefe, mehr Charakter, mehr Farbe. Mehr Hintergrund. Miéville entwirft eine neue Dimension der Phantastik, fern von Tolkiens Mittelerde oder der um Realismus bemühten Science-Fiction großer Space-Operas. Bas-Lag ist wie ein neuer, bisher unentdeckt gebliebener Winkel im Spektrum phantastischer Erzählkunst. Verständlich, dass der Autor mit neuen Geschichten ihre Reize auszuloten versucht. Und sehr begrüßenswert. Mit „Die Narbe“ und „Leviathan“ hat er eine neue Facette dieser Welt offenbart und Ansätze geliefert, die vermuten lassen, dass es hier noch viel zu entdecken gibt. Miéville ist einer der bedeutendsten Phantasten unserer Zeit.