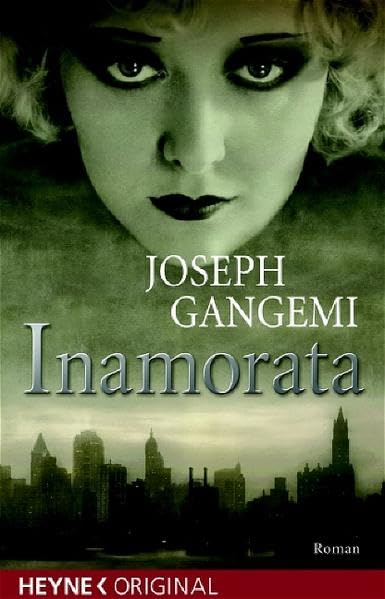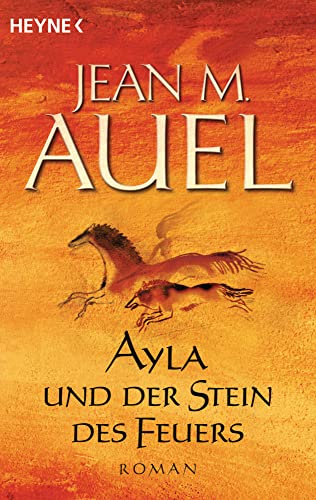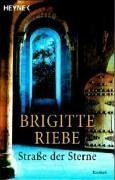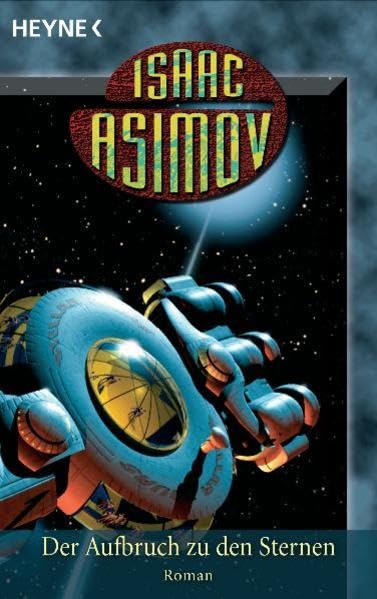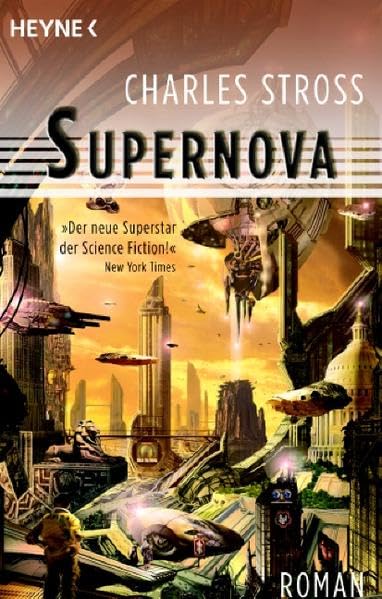„Heiliger Zorn“ ist ein sehr treffender Titel für Richard Morgans dritten Roman rund um den Ex-Envoy Takeshi Kovacs. Nach den Ereignissen in „Gefallene Engel“ kehrt Kovacs an den Ort seiner Geburt zurück, Harlans Welt. Dort wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert: einem jüngeren Doppelgänger seiner Person sowie der in den Vorgängern oft zitierten Quellcrist Falconer und seiner Envoy-Ausbilderin Virginia Vidaura.
Schlagwort-Archiv: Heyne
Joseph Gangemi – Inamorata
Im Dezember des Jahres 1923 glaubt Martin Finch, mittelloser Psychologie-Student an der US-Renommieruniversität Harvard im US-Staat Massachusetts, das große Los gezogen zu haben: Der berühmte Professor William McLaughlin heuert ihn als Assistenten an. Finch soll ihn bei seinem Bemühen unterstützen, die parapsychischen Fähigkeiten spiritistischer Medien zu überprüfen. Bisher entlarvte der Gelehrte nur Taschenspieler und Betrüger; ein leibhaftiger Geist ist ihm niemals begegnet.
So bleibt es auch, denn Finch entpuppt sich als findiger Detektiv, der falsche Geisterbeschwörer mit klugen Tricks bloßstellt. Als McLaughlin nach einem Unfall ausfällt, bietet Finch an, ihn zu vertreten. Sein Chef willigt ein, weil der aktuelle Fall ihm sehr am Herzen liegt: Der berühmte Schriftsteller und Hobby-Spiritist Sir Arthur Conan Doyle hat McLaughlin auf ein bemerkenswertes Medium in Philadelphia aufmerksam gemacht. Die junge Mina Crawley, Gattin eines deutlich älteren Chirurgen, gehört zur High Society ihrer Heimatstadt. Lange hatte sie Bitten um ein Treffen zurückgewiesen, bis sie jetzt endlich einwilligte. Joseph Gangemi – Inamorata weiterlesen
David Weber – Der Schwur (Schwerter des Zorns 1)

Seine Verwandschaft mit Conan kann Webers Held Bahzell Bahnakson nicht verleugnen. Probleme löst auch er am liebsten auf die handgreifliche Art. Doch im Gegensatz zu Howards Conan ist der unheimlich sture Bahzell ein moralischer Charakter mit ausgeprägtem Gerechtigkeitsempfinden.
Als Hradani gehört Bahzell einer der ursprünglichen fünf menschlichen Rassen (desweiteren gibt es Zwerge und „Rote Lords“, Halbelfen) seiner Welt an. Die fuchsohrigen Hradani sind bekannt für ihre hünenhafte, über zwei Meter große Gestalt, Körperkraft und ihr gewalttätiges Temperament. Das machte sie zu idealen Soldaten der Dunklen Götter, deren Hexerei sie mit der Blutrunst verfluchte: einem unkontrollierbaren, berserkerhaften Blutrausch, in dem sie jegliche Kontrolle verlieren. Diesem können sie im Zorn, besonders im Kampf, jederzeit anheimfallen.
David Weber – Der Schwur (Schwerter des Zorns 1) weiterlesen
Jean M. Auel – Ayla und der Stein des Feuers (Erdenkinder 5)
30000 Jahre mag es her sein, da wird an der Küste des Schwarzen Meeres Ayla, ein kleines, halb verhungertes, durch ein Erdbeben eltern- und stammeslos gewordenes Mädchen vom Menschenschlag der Cro-Magnons – Sie und ich gehören ihm noch heute an – von einer Horde Neandertaler (der leicht vormenschlichen Konkurrenz), dem „Clan der Höhlenbären“, gefunden und aufgenommen – recht widerwillig, entspricht doch die Neue mit ihrem schlanken, geraden Wuchs, den blauen Augen, der hohen Stirn und den blonden Haaren so gar nicht den Schönheitsidealen ihrer krummbeinigen, wulstbrauigen und wortkargen Gastgeber. Das hässliche Schwänlein muss unter vielen stolzen Enten denn auch ein an Zuneigung armes aber an Knüffen und Püffen umso reicheres Dasein fristen, das durch die Feindschaft zwischen den „Anderen“, wie die Neandertaler Aylas Leute nennen, und den „Flachköpfen“, wie diese wiederum ihre urtümlichen Nachbarn schimpfen, nicht eben einfacher wird. Trotzdem arrangiert man sich, und Ayla schenkt sogar einem Sohn das Leben, der sich zwar schon im Vorschulalter rasieren müsste aber trotzdem von seiner Mutter heiß geliebt wird, bevor diese ihn dem fiesen, intriganten Kindsvater überlassen muss, als der Clan der Höhlenbären sie schnöde verstößt. („The Clan of the Cave Bear“, 1980; dt. „Ayla und der Clan des Bären“)
Es schließen sich einsame Lehr- und Wanderjahre eines Engels auf (vorzeitlicher) Erden an, der viel zu edel für diese Welt ist sowie dank eines schamanischen Crash-Kurses bei erwähntem Höhlenbären-Clan einen guten Draht zu Mutter Natur und ihren übersinnlichen Kindern besitzt. Diese sitzen irgendwo auf Wolke Sieben und lenken von dort die Geschicke derer, die da unter ihnen k(r)euchen und fleuchen. Einen Odem purer Güte und Nächstenliebe ausdünstend und im absoluten Wissen um die Heilkraft jedes Kräutleins, das da blüht, gelingt es Ayla, a) den bösen Wolf zum braven Haushund, b) das wilde Pferd zum geduldigen Reittier und c) den edlen Löwen zum Kingsize-Kätzchen zu zähmen. Nachdem sie diese Künste zur Vollendung gebracht hat, naht auch Mr. Right: der Werkzeugmacher Jondalar, wohlgestaltet, einfühlsam, liebevoll und – nicht zu vergessen – ein toller Liebhaber. Dieses Gottesgeschenk an die moderne Frau von Vorgestern hat auf einer kühnen Reise, die Jondalar aus seiner weit entfernten Heimat, der südfranzösischen Dordogne, den Fluss Donau – hinabführte, buchstäblich Schiffbruch erlitten und muss von Ayla zusammengeflickt und gepflegt werden, bevor man sich näherkommen und die gemeinsame Rückkehr in Jondalars Heimat beschließen kann. („The Valley of Horses“, 1982; dt. „Das Tal der Pferde“)
Gar lang ist die Reise, dazu hart und beschwerlich, und sie wird nicht einfacher dadurch, dass Ayla und Jondalar immer wieder warten müssen, während die Große Geistin dieser Urzeit-Welt – vulgo Jean M. Auel genannt – ihrer Neigung frönt, jedem Grashalm, jedem Pilz und jedem Kleintier, der oder das am Wegesrande sichtbar wird, aus- und abschweifende Exkurse zu widmen („essbar“ – „heilend“ – „kleidsam“). Kein Wunder, dass es gar nicht mehr vorwärtsgeht, als unser Paar auf Menschen trifft. Die Mamutoi oder Mammut-Jäger des Löwenlagers pirschen den großen Urzeit-Elefanten hinterher. Ayla ist angetan von diesem Stamm, und diese Zuneigung wird erwidert: Der schwarzhäutige Ranec ist‘s, der hier der blonden Fremden nachzusteigen beginnt. Für den armen Jondalar brechen harte Zeiten an, denn der Rivale ist fast so ein guter Frauenversteher wie er, sodass Ayla über 800 Seiten hin- und hergerissen wird, bevor man wieder zusammenfindet und die Reise nach Frankreich fortsetzt. („The Mammoth Hunters“, 1985; dt. „Mammutjäger”)
Die nächsten Tage und Wochen verbringen Ayla und Jondalar damit, ihre angeschlagene Beziehung wieder zu kitten. Spannungen, die trotz wertvoller & endloser Frau-Mann-Gespräche zurückbleiben, werden vorzeitlich unbekümmert in den Feuern der „Wonne“ verbrannt. Nachdem man sich so die Donau-Auen hinaufdiskutiert und -gebumst sowie zwischenzeitlich hustende Neandertaler oder bauchwehkranke Cro-Magnon-Genossen mit selbstgebrauter, ökologisch einwandfreier Medizin kuriert hat, wird es noch einmal dramatisch: Amazonen (!) verschleppen Jondalar in ihr Lotterlager, wo er für kräftige Nachkommen sorgen soll. Die kluge Ayla kann ihn vor diesem schrecklichen Schicksal retten, und man setzt die Reise auf die oben beschriebene Weise fort. Dann gilt es noch einen Gletscher zu überwinden, und im Finale ist das Ziel zum Greifen nahe. („The Plans of Passage“, 1990; dt. “Ayla und das Tal der Großen Mutter“)
Das geschieht dieses Mal:
Home at last! Zwölf reale Jahre nach Beginn ihrer ausgedehnten Lust- und Studienreise erreichen Ayla und Jondalar endlich die Dordogne und die Zelandonii der Neunten Höhle. Der Empfang ist allerdings nur partiell herzlich, denn die freigeistige Ayla eckt wieder einmal an. Das geht schnell in dieser höchst komplexen, von schier unendlich vielen, bekannten und ungeschriebenen Regeln, Protokollen und Kodizes bestimmten Gemeinschaft, die selbst das englische Könighaus vor Neid erblassen ließe. Ayla kann Tiere zähmen und Feuer mit Hilfe von Steinen entfachen: Talente, die von den Priesterinnen des Clans mit Misstrauen und Konkurrenzängsten zur Kenntnis genommen werden.
Aber Ayla spuckt grazil in die Hände und beginnt beherzt, ein weiteres Land unserer Ahnen im Sturm zu erobern. Mit gnadenloser Freundlichkeit und Herzenswärme sucht Mrs. Supertüchtig Höhle um Höhle heim, heilt alles Sieche nieder, beschämt dumme, geile Kerle und gewinnt die Herzen der weisen Frauen. Schließlich stürmt sie sogar die letzte Klippe, auf der lange unbezwingbar Marthona hockte, die gestrenge Schwiegermutter, der nicht gefällt, was Sohn Jondalar da aus fernen Landen in Höhle Nr. Neun geschleppt hat.
Doch von ebendiesem Jondalar empfing Ayla in einem wahren Pandämonium der Liebe, des Glücks und des geschriebenen Kitsches inzwischen ein Kind, das nach knapp tausendseitiger Schwangerschaft endlich das Licht der Welt erblickt und im bereits angedrohten sechsten Teil der „Erdenkinder“-Saga mit seinen Eltern, Freunden und Feinden sicherlich noch viele gute Zeiten, schlechte Zeiten durchleben und durchleiden wird.
„The same procedure as every year”
Da ist sie also wieder – die blonde Ayla, Schamanin, Super-Mom, Klassefrau & Mutter Theresa der Steinzeit. Dabei schien endlich Ruhe zu sein im Steinzeit-Karton, als sich Ayla und Jondalar in Band 4 zwölf Real-Jahre zuvor verabschiedet hatten. Im Schlusskapitel winkten schon die Zelandonii: ein durchaus taugliches Ende für eine Saga, die sich längst in Agonie dahinschleppte. „Ayla und das Tal der Großen Mutter“ war eine Zumutung; eine geschwätzige, kitschige Seifenoper im pseudo-exotischen Gewand, künstlich über jede Lesbarkeit hinaus aufgeblasen durch ausufernde Landschaftsbeschreibungen, peinliche Folkloredarbietungen und vor allem durch die zum Wahnwitz geronnene Manie der Verfasserin, ihre Leser noch über die Herstellung der letzten Haarnadel exakt ins Bild zu setzen.
Die Rekonstruktion des Steinzeit-Alltags war Jean M. Auel immer ein Herzensanliegen, zumal die Darstellung der Ergebnisse entsprechender Recherchen die Autorin einer Verpflichtung enthob, der sie mangels Talent oder Disziplin selten nachkommen konnte: Spätestens seit „Das Tal der Pferde“ erzählte Auel keine Geschichten mehr, sondern betätigte sich als Schreibautomat, bei dem nach jeweils tausend niedergeschriebenen Seiten die Batterie gewechselt wurde.
Zwölf Jahre Pause – man sollte meinen, Auel habe mehr als genug Zeit gehabt, sich endlich Neues einfallen zu lassen. Stattdessen mutet sie uns üblichen Quark zu, nur dass dieser noch ein gutes Stück breiter getreten wird. Schlimmer: „Der Stein des Feuers“ ist eine dreiste Neuauflage von „Der Clan des Bären“ – dieses Mal ohne Neandertaler.
Dass die Zelandonii stattdessen der Sprache mächtig sind, erweist sich als zusätzliches Manko: Kein Mund will stillstehen in ihren Höhlen, und was wir hören, erinnert fatal an die Endlos-Seifenopern des Fernsehens. Mag sein, dass sich die Menschen seit 30000 Jahren nicht grundsätzlich verändert haben und Intrigen, Klatsch und üble Nachrede auch den Alltag in den Höhlen der Dordogne bestimmten. Das möchte ich jedoch nicht unbedingt in epischer Breite nachlesen – und falls doch, dann bitte so, dass mir ob der unter dem Gewicht der ihnen aufgeladenen Klischees neandertalerkrumm daherkommenden Figuren, der Dämlichkeit der Dialoge oder des absoluten Leerlaufs der weitgehend durch Abwesenheit glänzenden Story nicht ständig die Tränen kommen.
In einem ist Auel allerdings konsequent: Immer wenn man glaubt, nun könne es einfach nicht schlimmer kommen, widerlegt sie dies mit Leichtigkeit. Dieses Mal lässt sie ihren Röntgenblick nicht nur über jeden Stein und jeden Strauch in und um die Zelandonii-Höhlen schweifen; wir können den Ort des langweiligen Geschehens anschließend quasi aufzeichnen. Zusätzlich wird ausführlich wiederholt, was in den vorangegangenen vier Bänden der „Erdenkinder“-Saga geschehen ist. Sicherlich muss die lange Pause nach Teil 4 irgendwie überbrückt werden. Wieso dies nicht in einer Zusammenfassung vor dem Einsetzen der eigentlichen Handlung geschehen konnte, bleibt rätselhaft. Stattdessen nerven Ayla und Jondalar die Leser, die ohnehin die Vorgängerbände kennen, mit uferlosen „Weißt-Du-noch?“-Histörchen.
Wenn der Höhlensegen schiefhängt
Unterhaltungsfeindlich sind darüber hinaus Auels ebenso hartnäckige wie vergebliche Versuche, neben der Alltags- auch die Geisteswelt der Steinzeit zum Leben zu erwecken. Historiker und Archäologen kennen eine scherzhafte Faustregel, nach der jeder Fund, der sich nicht anderweitig deuten lässt, dem Kultisch-Religiösen zuzuordnen ist. Gleichzeitig wird sich jeder Wissenschaftler, der diese Bezeichnung verdient, heftig hüten, Aussagen über Kult und Riten lange versunkener Kulturen zu treffen, die über Theorien hinausgehen.
Auel hat als Schriftstellerin freie Bahn, und diese Chance nutzt sie: nur leider nicht besonders einfallsreich. Ihre Geisterwelt wird von allerlei Muttergottheiten bevölkert, die im Einklang mit der Natur (und Gott ist für Auel definitiv eine Frau) schwingen und stets wissen, was am besten ist für Mensch und Tier. Hinter der Dunstwolke aufwändig geschilderter (und breit ausgewalzter) Zeremonien treten allerdings keine kosmischen Wahrheiten, sondern hausbackene Binsenweisheiten zutage: Vertragt euch; hört auf eure Mütter/Frauen/Priesterinnen; seid nett zu Kindern, Tieren und Neandertalern.
Wenn‘s dann trotzdem nicht klappt mit Friede, Freude & Eierkuchen, tragen ganz gewiss die nicht unbedingt bösen, sondern eher ignoranten und nie ganz erwachsenen (oder zurechnungsfähigen) Männer die Schuld: Die „Ayla“-Saga startete 1980 und ist in gewisser Weise selbst inzwischen zur historischen Quelle geworden: als (allerdings vielfach gebrochenes und trivialisiertes) Spiegelbild einer feministischen Weltsicht, wie sie einst en vogue war. „Die Vernichtung der weisen Frauen“ hieß ein typischer Sachbuch-Bestseller dieser Zeit, der die europäischen Hexenverfolgungen des 13. bis 18. Jahrhunderts als Verschwörung missgünstiger und um ihre Macht fürchtender Patriarchen gegen ein Netzwerk starker, kluger, heilkundiger, vor allem aber selbstständiger Frauen deutete. Diese Theorie hat sich inzwischen erledigt, und der Feminismus hat sich weiterentwickelt
Zurück blieb Ayla, die weiterhin die Fackel hochhalten muss, die Auels Leser/innen ins matriarchalische Utopia leiten soll, wie es in den 1970er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts beschworen wurde. Immerhin: Hübsch anzuschauen durfte Ayla trotzdem immer sein; so weit ging Auels schwesterliche Solidarität doch nicht, ihrem Publikum eine vierschrötige Höhlen-Walküre als realistische Heldin zu präsentieren. Den Rest erledigt popularisiertes New Age-Gewaber US-amerikanischer Prägung. Was sich in den Höhlen der Zelandonii abspielt, erinnert stets verdächtig an die Zeremonien, die sich die Medizinmänner (oder hier besser -frauen, die es ja auch gegeben hat) diverser Indianerstämme in der Vergangenheit ausgedacht haben. Erst hat man die nordamerikanischen Ureinwohner für Hollywood vom Pferd geschossen, nun werden sie von zivilisationsmüden Heilssuchern verkitscht, die sich aus dem reichen Mythengut herauspicken, was den Weg ins Nirvana angeblich abkürzt und dabei auch noch spannend unterhält.
Der Fluch des Erfolgs
Aber kann ausschließlich Jean M. Auel verantwortlich für das „Ayla“-Elend gemacht werden, das über die lesende Welt kommt? Die Verfasserin steht in einer langen, langen Reihe von Autoren, die eine Schnulze durch eine exotische Kulisse aufwerteten. Vor vielen Jahren gab Auel ihr Bestes als hoffnungsvolle Neu-Autorin und traf mit einem im Rückblick allenfalls mittelmäßigen aber durchaus lesenswerten Werk den Geschmack eines Publikums, das zu diesem Zeitpunkt auf „Ayla und der Clan des Bären“ gewartet zu haben schien. Binnen eines Monats ging dieser Titel mehr als 100000 Mal über die Ladentische. Ein Star war geboren, einem Stephen King oder einer Joanne K. Rowling durchaus vergleichbar – auch finanziell: 34 Millionen verkaufte Exemplare später kassierte Auel als Vorschuss (!) für die Ayla-Romane 4 bis 6 25 Mio. Dollar; nicht schlecht für eine Hobby-Autorin, die erst im Alter von 42 Jahren zum Schreibtisch fand.
Das Honorar ist wohl der eigentliche Schlüssel zu Aylas Wiedergängertum: 2002 spürte Auel nach zwölf aylalosen Jahren offenbar den Druck ihrer Geldgeber, endlich den versprochenen Nachfolgeband zu liefern. Diese Theorie würde das traurige Ergebnis jedenfalls erklären. Der Verlag bekam, was er wollte: kein Buch, das man einen Roman nennen dürfte, aber einen dicken Stapel beschriebenen Papiers, das sich unter dem eingeführten Markenzeichen „Auel“ als „Ayla V.“ prächtig vermarkten lassen würde.
Lesen würden diesen Schinken alle Ayla-Fans, aber kaufen sollten ihn noch viele, viele weitere Menschen. Die Strategie ist bekannt: Hinter dem multimedial begleiteten „Event“ kann der Anlass ruhig verschwindet. So wurde die Buchpremiere von „Ayla und der Stein des Feuers“ 2002 in Les Eyzies im Herzen Frankreichs als gigantisches Pressespektakel inszeniert. Hier lebten, liebten und litten einst Auels Hollywood-Cro-Magnons. Über 150 Journalisten fielen ein, um die Starautorin zu treffen. Diese erzählte die stets gern gehörten Geschichten ihrer Recherche-Touren, die sie nicht nur auf Aylas und Jondalars Spuren durch Russland, die Ukraine, Tschechien, Ungarn, Österreich, Deutschland und Frankreich führte, sondern die pflichtbewusste Autorin auch dazu animierten, Tiere in Fallen zu fangen, Steinwerkzeuge zu basteln, Matten zu knüpfen und natürlich Archäologen, Anthropologen oder Biologen zu befragen.
Elend mit Epilog
Das Buch hatten diese und andere Steigbügelhalter wohl nie gelesen, es war nicht erforderlich, da Veranstaltungen wie die in Les Eyzies ihren eigentlichen Zweck glänzend erfüllten. Die Schlagzeilen ebneten „Ayla V.“ den Weg zu neuerlichem Bestseller-Ruhm und Rekord-Auflagen. In Deutschland ging trotzdem lieber kein Risiko ein. Noch bevor sich womöglich jene Spielverderber zu Worte meldeten, die „Ayla und der Stein des Feuers“ tatsächlich lesen & für mies befinden würden, ließ man das Werk in einer Hauruck-Aktion von zwei simultan arbeitenden Übersetzern in unsere Muttersprache. Das Risiko war allerdings kalkulierbar gering: „Ayla V.“ wurde von 34 Verlagshäusern weltweit gleichzeitig in die Buchhandlungen gepresst!
Diese Prozedur wiederholte sich mit „Ayla VI.“ und wurde durch das Internet ergänzt. Abermals hatte Auel sich viele Jahre Zeit gelassen. „Ayla und das Lied der Höhlen“ wurde 2011 zum Offenbarungseid einer sichtlich ausgeschriebenen, kranken, alternden Autorin, die endlich zu Ende bringen wollte, wozu sie sich verpflichtet hatte. Selbst Hardcore-Auel-Fans konnten und wollten ihren Unmut über ein ‚Buch‘ nicht unterdrücken, das die bekannte Ayla-Rezeptur noch einmal aufkochte und dabei endgültig in Esoterik-Schwurbel versandete.
Seltsamerweise hielten sich Kino und Fernsehen bisher zurück mit der Verfilmung von Auel-Abenteuern. Zwar gibt es „Ayla und der Clan des Bären“ von 1985, ein unfreiwillig komisches B-Movie, in dem unsere Heldin durch Daryl Hannah zumindest optisch kongenial verkörpert wurde. Aber vielleicht sind wenigstens dieses Mal die oft und gern geschmähten Medienspezialisten die Klügerin, weil sie erkennen, dass sich aus einem 1000-seitigen Roman manchmal höchstens das Drehbuch für einen 30-Minuten-Kurzfilm destillieren lässt.
Zur Serie gibt es u. a. diese Website.
Taschenbuch: 984 Seiten
Originaltitel: The Shelter of Fire (New York : Crown Publishing Group 2002)
Übersetzung: Maja Ueberle-Pfaff u. Christoph Trunk
http://www.randomhouse.de/heyne
eBook: 1494 KB
ISBN-13: 978-3-641-07921-5
http://www.randomhouse.de/heyne
Hörbuch-Download: 2064 min. (ungekürzt, gelesen von Hildegard Meier)
ISBN-13: 978-3-8371-1091-3
http://www.randomhouse.de/randomhouseaudio/
Der Autor vergibt: 



Christoph Marzi – Lilith (Die Uralte Metropole 02)

Vier Jahre sind seit den Geschehnissen in „Lycidas“ vergangen. Emily hat sich daran gewöhnt, dass sie als Trickster eine besondere Gabe hat, die sie von den anderen Kindern an der Whitehall-Privatschule in London ausgrenzt und das Mädchen mit dem Mondsteinauge zu einer Außenseiterin macht. Doch Aurora Fitzrovia, die schon seit den Tagen im Waisenhaus von Rotherhithe ihre beste Freundin ist, hält auch weiter zu ihr.
Christoph Marzi – Lilith (Die Uralte Metropole 02) weiterlesen
Marillier, Juliet – Königskinder, Die (Unter dem Nordstern 1)
In den letzten Jahren haben die australischen Autorinnen unaufhaltsam den deutschen Markt erobert. Nach Sara Douglass und Elisabeth Haydon erscheinen nun auch von Juliet Marillier verstärkt Romane. Schon bei |Knaur| ist eine Trilogie um „Die Tochter der Wälder“ erschienen, in der sie die Zeit des 9 Jh. lebendig werden lässt und ihre keltischen Wurzeln heraufbeschwört.
In ihren neuen Zyklus „Unter dem Nordstern“ entführt sie den Leser in eine frühere Zeit. Im Schottland des 6. Jahrhunderts ringen mehrere gälische und piktische Königreiche um die Macht. In dieser Zeit wird Bridei in Wales geboren, doch seine Eltern geben ihn schon früh in die Obhut des Druiden Broachan, der ihn mit in den fernen Norden nimmt. Von nun an ist das Leben des Kindes von Lernen bestimmt. Dazu gehören nicht nur Lesen, Schreiben und Lehren über die Natur und das Recht, sondern auch handfestere Tugenden wie die Kriegskunst.
Unter den zufriedenen Blicken des alten Druiden und seines Haushaltes entwickelt sich Bridei prächtig. Nur in einem wehrt er sich gegen das Machtwort seines Ziehvaters und der anderen. Er will das zur Wintersonnenwende gefundene Mädchen nicht seinem Schicksal überlassen. Obwohl es kein Mensch zu sein scheint, möchte er die Kleine immer in seiner Nähe wissen und sich um sie kümmern.
So bleibt die kleine Tuala auch im Haushalt des Druiden und widersteht mehreren Versuchen, sie loszuwerden, wenn Bridei nicht da ist und über sie wachen kann. Mit zunehmendem Alter lässt sie sich weniger gefallen, erfährt aber auch von ihrer Herkunft durch zwei geheimnisvolle geflügelte Wesen. Diese machen ihr klar, dass sie ein Kind des Waldes ist – ein Feenmädchen, das den Göttern näher steht als den Menschen.
Als sie fast fünfzehn Jahre alt ist, gibt es jedoch kein Ausweichen mehr. Menschen, die sie früher gemocht haben – so wie ihre Amme, ziehen sich von Tuala zurück, und der Druide verlangt von ihr, dass sie sich nun entweder entschließt, einen Mann zu heiraten, oder aber in die Schule der Weisen Frauen zu gehen.
Das Mädchen hat keine andere Wahl, denn Bridei weilt mittlerweile in einem anderen Haushalt, um dort seine Studien zu vertiefen und eine erste Bewährungsprobe in der Schlacht hinter sich zu bringen. Denn mittlerweile ist er ein Mann und man darf ihm nicht länger vorenthalten, welches Schicksal man ihm zugedacht hat …
Magische Waldwesen, ein Kind, das zwischen den Welten steht und ein auserwählter Junge, der erst noch seine Lehrzeit hinter sich bringen muss – das sind genau genommen die Zutaten fast aller Fantasy-Romane, in denen die mythische Vergangenheit Englands mitsamt den keltischen Wurzeln heraufbeschworen wird.
Da macht auch „Die Königskinder“ keine Ausnahme. Zwar sind Bridei und einige andere Figuren historisch belegte Personen, aber da hört es auch schon auf. Da man im Grunde sehr wenig über die Pikten, ihre Kultur und den Kontrakt/die Vermischung mit anderen Völkern – gerade zu dieser Zeit – weiß, nimmt sich Juliet Marillier die Freiheit, eine Ausbildung zu schildern, die sich überhaupt nicht von denen anderer keltischer Helden unterscheidet.
Da gibt es den weisen Lehrmeister, der seinen Schüler manchmal auch recht despotisch in die Schranken weist, den jungen und allzu klugen Helden, der zu viel zu oft hinterfragt, und das geheimnisvolle Mädchen, das seinen mystischen Weg erst noch entdecken muss und irgendwie doch zu seiner Gefährtin bestimmt ist.
Etwa die Hälfte des Buches wendet Juliet Marillier für die Kindheit von Bridei und Tuala auf, erst dann wird es spannender, als beide ihre eigentlichen Wurzeln entdecken und feststellen müssen, dass sie auch Feinde haben, die ihnen ans Leben oder sie grob voneinander trennen wollen. Es geht dabei sehr gefühlvoll zu – Bridei kommt lange nicht darüber hinweg, dass ein väterlicher Freund den für ihn bestimmten Becher mit Gift getrunken hat.
„Die Königskinder“ dürfte vor allem Lesern gefallen, die von gefühlvollen keltischen Helden und einer scheinbar magischen Liebesgeschichte nicht genug bekommen können und denen es auch nicht wichtig ist, dass die eigentliche Handlung kaum Geheimnisse birgt und eher flach dahinplätschert.
Alle anderen Leser dürften sich mehr oder weniger durch den zähen Roman mit seinen erheblichen Längen, altvertrauten Klischees und flachen Charakteren quälen und ihn vielleicht noch vor dem Ende genervt beiseite legen.
© _Christel Scheja_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [X-Zine]http://www.x-zine.de/ veröffentlicht.|
Interview mit Andreas Brandhorst

Hallo Andreas, ich bin hocherfreut, dich in unserem Magazin begrüßen zu dürfen! Für alle, die Andreas Brandhorst etwas näher kennen lernen wollen: Wer bist du und was treibst du so?
Andreas Brandhorst:
Ich bin 1956 in Norddeutschland geboren und schreibe, seit ich schreiben gelernt habe. Inzwischen lebe ich seit über zwanzig Jahren in meiner Wahlheimat Italien, wo ich nach dem Ende meiner zweiten Ehe (mit einer Italienerin) geblieben bin, weil ich dieses Land, seine Leute und Kultur sehr liebe. Lange Zeit habe ich vor allem übersetzt, aber seit einigen Jahren schreibe ich auch wieder selbst.

Was sagst du zu dem »Vorwurf«, neuer Shooting-Star der deutschen Science-Fiction zu sein?
Andreas Brandhorst:
Zum Glück bezeichnet man mich nicht als Nachwuchsautor, denn immerhin werde ich nächstes Jahr 50! 🙂 Shooting-Star … Na ja, ich mag diesen Ausdruck nicht sehr, denn immerhin bin ich seit fast dreißig Jahren als Profi in der deutschen SF tätig und habe schon damals Romane geschrieben und an den legendären Terranauten mitgewirkt. Aber: In gewisser Weise hat er durchaus seine Berechtigung, denn ich sehe einen klaren Unterschied zwischen meinem heutigen Werk und der damaligen Arbeit. Heute bin ich einfach reifer, viel reicher an Lebenserfahrung, und ich gehe mit einem ganz anderen Anspruch an die Schriftstellerei heran. Der Andreas Brandhorst von heute ist ein anderer als der von damals. Als »Star« sehe ich mich allerdings nicht. 🙂

Durch das Kantaki-Universum hast du die deutschen Science-Fiction-Leser auf dich aufmerksam gemacht. Seit »Diamant« im Mai ’04 auf den Markt kam, kann man dich zu den produktivsten Schriftstellern des Genres rechnen. In den Jahren reiner Übersetzertätigkeit hat sich deine Kreativität anscheinend stark gestaut?
Andreas Brandhorst:
»Diamant« im Mai ’04, es folgte »Der Metamorph« im Januar ’05 und »Der Zeitkrieg« im Oktober ’05. Wenn man berücksichtigt, dass ich vor dem Erscheinen von »Diamant« ca. ein Jahr an dem Roman gearbeitet habe, so sind das drei Romane in 29 Monaten (ohne »Exodus der Generationen«). Das ist eigentlich nicht übermäßig produktiv, oder? An Kreativität hat es mir nie gemangelt (die braucht man auch fürs Übersetzen), aber ich schreibe heute sehr langsam und sehr, sehr sorgfältig, etwa drei Seiten pro Tag, aber jeden Tag – das sind etwa tausend Seiten im Jahr, also anderthalb dicke Romane. Es geht mir heute vor allem um die Qualität und nicht um die Quantität. Ich hoffe, das merkt man den Romanen an.

Da kann ich dich beruhigen 😉 Der umfassend ausgearbeitete Hintergrund zu den Romanen um Valdorian und Lidia bietet Raum für unzählige noch unerzählte Geschichten. Die fremden Völker des Universums üben einen besonders großen Reiz aus. Jedes von ihnen hat eine spannende Geschichte, die anfangs ziemlich schwarz-weiße Weltsicht hat sich schließlich im »Zeitkrieg« verwischt. Was passiert nun mit den Temporalen, Kantaki, Feyn? Und vor allem: Was ist mit den Xurr? In dieser Hinsicht lässt du den Leser sehr erwartungsvoll zurück.
Andreas Brandhorst:
Ich habe sehr viel Zeit und Mühe in die Ausarbeitung des Hintergrunds für das Kantaki-Universum investiert, denn so etwas lohnt sich: Als Autor bekommt man dadurch eine große Bühne mit vielen Kulissen, um Geschichten zu erzählen. Natürlich kann ich hier nicht verraten, was aus den bisher geschilderten Völkern wird, obwohl mein Computer viele entsprechende historische und chronologische Daten enthält. (Hoffentlich fordere ich mit diesem Hinweis keine Hacker-Angriffe heraus …) Es ist wie mit einem Eisberg: Nur ein kleiner Teil zeigt sich über Wasser, der Rest bleibt darunter verborgen. Bisher kennen die Leser nur einen winzig kleinen Teil des Kantaki-Universums. In den nächsten Büchern wird es bestimmt die eine oder andere Überraschung geben …

Vor allem im letzten Band »Der Zeitkrieg« drängen sich die hintergründigen Informationen. Hättest du die Geschichte lieber noch ein wenig ausgedehnt?
Andreas Brandhorst:
Nein, eigentlich nicht. »Der Zeitkrieg« beantwortet viele Fragen, die in »Diamant« und »Der Metamorph« offen blieben. Der große Kreis schließt sich zu Recht in diesem Band; ein vierter Roman hätte alles nur gedehnt und langatmig gemacht. Aber es bleibt auch das eine oder andere offen, was mir Gelegenheit gibt, vielleicht noch einmal darauf zurückzukommen: auf Olkin und das Flix, oder auf die Xurr … 🙂
Tobias Schäfer:
Rückblickend kann man sagen, dass dir der Charakter »Valdorian« am stärksten am Herzen lag. Über ihn hast du die Suche nach dem ewigen Leben neu erzählt. Was macht für dich die Faszination dieser Figur und/oder dieses Themas aus?

Ich glaube, dass in jedem Bösen etwas Gutes steckt, und dass jeder Gute auch einmal böse werden kann. Die Komplexität des menschlichen Wesens fasziniert mich, und ich glaube, die kommt im Valdorian gut zum Ausdruck, wenn man seine Entwicklung vom Saulus zum Paulus über die drei Romane hinweg verfolgt. Außerdem beschäftige ich mich immer mehr mit dem Leben an sich und dem Tod, einem Thema, dem sich keiner von uns entziehen kann. Der Tod, welch eine Verschwendung: Man verbringt das ganze Leben damit, Wissen zu sammeln und Erfahrungen zu machen, klüger zu werden, und dann, in einem Augenblick, geht das alles verloren. Und die verschiedenen Straßen des Lebens, die Diamant und Valdorian beschreiten: Oftmals gibt es nach einer getroffenen Entscheidung kein Zurück mehr. Wir alle müssen versuchen, das Beste aus unserem Leben zu machen, und genau dieser Gedanke hat ja zunächst die verschiedenen Lebensentscheidungen von Diamant und Valdorian bestimmt.
Tobias Schäfer:
Für manche Leser mag die Wandlung Valdorians zu plötzlich erfolgen. Wie antwortest du auf Vorwürfe der Unglaubwürdigkeit? Kommt so was überhaupt vor?

Nein, bisher sind solche Vorwürfe noch nicht aufgetaucht, oder mir zumindest nicht bekannt. Valdorian ist, wenn man genau hinsieht und aufmerksam liest, eine sehr komplexe Person, zuerst mit einem schwierigen Verhältnis zu seinem Vater, der dann aber sogar zu seinem Idol wird. Es gibt in allen drei Romanen Stellen, die seinen inneren Zwist zeigen, seine Zerrissenheit – er ist nie schwarz oder weiß, sondern grau. Die Konfrontation mit Diamants Einstellungen zum Leben verändert ihn nach und nach, und ein wichtiges Schlüsselerlebnis in diesem Zusammenhang ist die Begegnung mit seiner Mutter in »Der Zeitkrieg«. Er beginnt zu verstehen, dass Dinge, die er für unwichtig gehalten hat, tiefe Bedeutung haben, und er denkt darüber nach. Er fängt an, Verantwortung zu übernehmen, für sich selbst und auch die Welt (das Universum), in der er lebt. All diese subtilen Veränderungen schlagen schließlich als Quantität in Qualität um. Ein neuer Valdorian wird geboren, und damit schließt sich für ihn ein eigener Kreis: Er, der am Ende seines Lebens nach neuer Jugend strebte, erneuert sich im Tod.
Tobias Schäfer:
Wo wir gerade bei den Lesern waren: Wir leben ja im Zeitalter der ungehemmten Kommunikation. Stehst du in engem Kontakt mit Menschen, die erst durch deine Geschichten an dich herangetreten sind? Kannst du dich vor Leserpost kaum retten oder traut sich niemand an dich heran?

Es ist nicht so, dass ich jeden Tag zwei Säcke Post bekäme … 🙂 Für die Leser gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Da wäre zum Beispiel das Forum der Kantaki-Site [down, Anm. d. R.] wo ich mich bemühe, jeden Beitrag zu beantworten. Abgesehen davon bekomme ich erstaunlich viele E-Mails und frage mich manchmal, woher die Schreiber meine E-Mail-Adresse kennen. Auch in diesem Fall versuche ich, jede Mail zu beantworten.
Tobias Schäfer:
In dem Zusammenhang erinnere ich mich an eine Anekdote aus dem Perry-Rhodan-Werkstattband, wo William Voltz ständig unangemeldeten Besuch seiner Leser bekommt. Wirst du manchmal persönlich behelligt oder beschränkt sich diese Art Kontakt auf Cons?
Andreas Brandhorst:
Da ich in Italien wohne, kommt es (fast) gar nicht zu solchen Überraschungsbesuchen. Es gab nur eine Ausnahme, vor zwei Jahren … 🙂 Vor etwa 25 Jahren, als ich noch in Deutschland wohnte und Romane für die Terranauten schrieb, kam es öfter vor, dass plötzlich Leute vor meiner Wohnungstür standen, in einem Fall eine Gruppe von sieben oder acht Jugendlichen. Wir haben uns dann zusammengesetzt und gemütlich miteinander geplaudert …

Dein erster Beitrag zum sogenannten »Perryversum« war erstens eine Überraschung und stellt zweitens einen unbestrittenen Höhepunkt der Serie dar. Wie bist du dazu gekommen? Ist nach deinem Roman »Die Trümmersphäre« weiteres Engagement in der Serie geplant?
Andreas Brandhorst:
Dazu gekommen ist es durch ein Gespräch im Heyne Verlag, im Oktober 2003, glaube ich, wo Sascha Mamczak, der mit Klaus Frick in Verbindung stand, das Lemuria-Projekt ansprach. Ich hatte gerade »Diamant« fertig gestellt, und mich reizte die Vorstellung, einen Beitrag für das Perryversum zu schreiben, das für mich als 12/13-Jähriger praktisch der Einstieg in die SF war – ich habe die Romane damals regelrecht verschlungen. »Die Trümmersphäre« habe ich nach dem »Zeitkrieg« geschrieben, und dieser zweite Beitrag für das Perryversum war aus mehreren Gründen extrem harte Arbeit. Nach der Fertigstellung dieses Romans dachte ich mir: Jetzt nimmst du dir erst einmal eine Auszeit und widmest dich ganz deinen eigenen Projekten. Damit ist die Frage praktisch schon beantwortet: Eine weitere Mitarbeit meinerseits bei PR ist derzeit nicht konkret geplant, was sie aber mittel- oder gar langfristig nicht ausschließt.

Was erwartet die Leser in deinen nächsten eigenständigen Romanen? Kannst du dazu zu diesem Zeitpunkt schon etwas verraten?
Andreas Brandhorst:
Ja, ich denke, ich kann hier ein kleines Geheimnis lüften. Derzeit arbeite ich an »Feuervögel«, einem Roman, der im Oktober 2006 bei Heyne erscheinen wird, aller Voraussicht nach als erster Band einer neuen Trilogie; die Arbeitstitel für den zweiten und dritten Band lauten »Feuerstürme« und »Feuerträume«. Und: Diese neuen Romane sind im Kantaki-Universum angesiedelt, allerdings in einer aus Valdorians und Diamants Sicht fernen Zukunft. Vom Umfang her werden die neuen Romane den ersten drei Kantaki-Romanen ähneln. Was den Inhalt betrifft … (Schnitt)

Als Schriftsteller scheinst du ziemlich ausgebucht zu sein. Da wirkt es erstaunlich, deinen Namen noch regelmäßig bei Übersetzungen vorzufinden, derzeit vor allem bei Terry-Pratchet-Romanen – und ganz aktuell bei David Brins »Copy«. Wie bringst du das alles unter einen Hut?
Andreas Brandhorst:
Indem ich knallhart arbeite. Der Brin zum Beispiel hat wirklich meine ganze Kreativität gefordert; ich glaube, es war eine der schwierigsten Übersetzungen, die ich jemals gemacht habe. Mit Pratchett bin ich nach circa 30 Romanen gut »synchronisiert« … Eigentlich gefällt mir die Mischung aus eigenem Schreiben und Übersetzen. Ich möchte sie nur noch etwas mehr zugunsten der eigenen Werke verändern.
Tobias Schäfer:
Was ist das für ein Stoff, den Pratchet schreibt? Seine Romane sind ja regalfüllend in diversen Buchhandlungen zu finden. Was macht den Reiz dieser Geschichten aus?
Der besondere Reiz von Pratchetts Geschichten besteht aus der genialen Mischung von Intelligenz und Humor. Ich halte Terry Pratchett für einen der besten Schriftsteller überhaupt. Ihm gelingt es, Personen mit ein oder zwei Sätzen zu charakterisieren, und seine Schilderungen zeichnen sich immer durch große Tiefe aus. Man kann seine Romane auf zwei Arten lesen: als lustige, leicht verdauliche Unterhaltung, und als tiefsinnige Romane, bei denen einem manchmal das Lachen im Halse stecken bleibt.
Tobias Schäfer:
Wir haben jetzt viel über den offiziellen Brandhorst gesprochen. Danke sehr für die interessanten Antworten! Aber was macht der Mensch Andreas, wenn er ein bisschen Zeit für sich findet?
Andreas Brandhorst:
Nach all der Zeit am Computer lege ich großen Wert darauf, mich körperlich fit zu halten. Ich laufe fast jeden Tag mindestens eine Stunde, egal ob es stürmt, regnet oder schneit. Wenn ich nicht laufe, stemme ich Gewichte. Manchmal schnappe ich mir Notebook und Auto, reise durch Italien – ich liebe dieses Land! –, und bleibe eine Zeit lang, wo es mir gefällt. Ich bin nach zwei Ehen wieder Single, Sohn und Tochter sind erwachsen … Ich genieße meine Freiheit, laufe im Winter an menschenleeren Stränden, schreibe an einem warmen Kaminfeuer, denke über das Leben nach … 🙂
Tobias Schäfer:
Dann wünsche ich dir, dass diese Zeit nicht zu kurz kommt – obwohl ich natürlich vor allem auf viele spannende Romane von dir hoffe. 🙂 Alles Gute weiterhin!
Riebe, Brigitte – Straße der Sterne
Regensburg, 1245: Die 17-jährige Kaufmannstochter Pilar Weltenburger ist blind, lebt aber wohlbehütet im Hause ihres Vaters Heinrich, der seine Tochter über alles liebt. Die Mutter Rena hatte die Familie zehn Jahre zuvor ohne Erklärungen verlassen – ein Verlust, den sowohl Pilar als auch der Kaufmann nie verkraftet hatten.
Als aufgrund von Intrigen das Familiengrundstück in Flammen aufgeht und Heinrich stirbt, beschließt Pilar, der „Straße der Sterne“ zu folgen – der Straße, die den Pilgern den Weg zum Grab des heiligen Jakobus weist. Zusammen mit ihrem maurischen Diener Tariq, den ihre Mutter aus dem fernen Frankreich mitgebracht hatte, verlässt Pilar Regensburg, um im spanischen Santiago de Compostela den Heiligen zu bitten, ihr das Augenlicht wiederzugeben.
Tariq selbst trägt seit jenem Morgen, an dem seine Herrin die Stadt verließ, Renas Aufzeichnungen mit sich. Die Bitte, ihr Vermächtnis der Tochter zu geben, sobald diese alt genug sein würde, konnte er nicht mehr erfüllen, da Pilars Krankheit ihm zuvor gekommen war. Selbst unfähig, die Erinnerungen zu ertragen, die ihn dann überrollen würden, brachte er es nicht über sich, dem Mädchen die Seiten vorzulesen.
Der Weg der Pilger war seit jeher gefährlich, aber eine blinde junge Frau in Begleitung eines Nicht-Christen stellt eine allzu leichte Beute dar und so beschließen die beiden, die Hauptstraßen zu meiden. Trotzdem treffen sie nach und nach auf andere Pilger, die alle eins gemeinsam haben: dunkle Geheimnisse, die niemand außer dem heiligen Jakobus erfahren soll. Der Tempelritter Camoni, der seiner großen Liebe nachtrauert und Pilar zu kennen scheint; die Reisende Moira, die nie über ihre Familie redet und sich in Camoni verliebt; der Mönch Armando, der den Heiligen Gral sucht und an seiner Berufung zu zweifeln beginnt; und schließlich das Mädchen Estrella, das Tarot-Karten legt, um an Geld zu kommen, und als Einzige dem Heiligen uninteressiert gegenübersteht. Eine mächtigere Hand als der Zufall hat diese Menschen zusammengeführt und ihr Schicksal liegt sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Auf dem Weg nach Spanien erfüllt es sich unbarmherzig Stück für Stück.
Brigitte Riebe ist hier ein etwas anderer historischer Roman gelungen, der nichts von dem allseits beliebten „Gut-und-Böse-Schema“ beinhaltet. Die Geschichte lebt von den großartig ausgearbeiteten Charakteren, die ganz natürlich aus ihrem Leben erzählen und den Leser in ihre persönlichen Tragödien einblicken lassen. Hier gibt es keine Superhelden-Action, die den Leser am Wahrheitsgehalt der Geschichte zweifeln lassen, es handelt sich vielmehr um einen faszinierenden Reisebericht.
Jeder Charakter ist nachvollziehbar, verletzlich und ergreifend geschildert, und der Leser wartet ungeduldig auf die Auflösung all dieser Rätsel. Sieben Menschen ergeben sieben einzelne und eine gemeinsame große Geschichte – Brigitte Riebe versteht es, einen vielschichtigen Plot zu entwickeln und diesen dann großartig umzusetzen! Abwechselnd gerät der Leser in die Wirren der Pilgerreise und in die Wirren der Vergangenheit, die die Autorin geschickt Stück für Stück – dem Weg der Reisenden angepasst – aufdeckt. Und auch wenn dem aufmerksamen Leser die Lösungen der kleinen und großen Rätsel schnell klar werden, klingt der Roman nicht langweilig aus. Das Ende passt sich, einer logischen Konsequenz folgend, dem Rhythmus der vorangegangenen Seiten an und lässt im Leser das Gefühl nachhallen, das er von Beginn an hatte: ein ruhiges, aber ergreifendes Buch!
Im Anhang findet der Leser historische Daten über die „Straße der Sterne“ und Pilger, aber auch Anmerkungen zu dem damaligen Stand der Papierherstellung. Sehr interessant!
Brigitte Riebe, vollständig Dr. Brigitte Leierseder-Riebe, wurde 1953 in München geboren, wo sie auch heute noch als freie Schriftstellerin lebt. Sie ist promovierte Historikerin, war zunächst als Museumspädagogin tätig und hat später lange Jahre als Verlagslektorin gearbeitet, bevor sie selbst begann, Romane zu schreiben. Unter ihrem Pseudonym Lara Stern veröffentliche sie u. a. die Sina-Teufel-Romane, mit denen sie auch bekannt wurde. Seit März 2005 ist der Roman [„Die Hüterin der Quelle“]http://www.buchwurm.info/book/anzeigen.php?id_book=2190 im Handel erhältlich.
Homepage der Autorin: http://www.brigitteriebe.de
Andreas Brandhorst – Der Zeitkrieg (Kantaki 3)

Andreas Brandhorst ist einigen Lesern von SF-Serien vielleicht ein Begriff durch seine langjährige Tätigkeit als Übersetzer von StarWars- und Terry-Pratchet-Romanen. Als Autor ist er seit seinem Antritt mit dem Kantaki-Universum erneut im Blickfeld. Sein Beitrag zum Perry-Rhodan-Taschenbuch-Zyklus „Lemuria“ (in sechs Bänden bei Heyne) gilt als Höhepunkt der Serie. Brandhorst lebt und arbeitet in Italien.
Einstieg in den Kantaki-Zyklus
Die Menschheit ist abhängig von der überlichtschnellen Raumfahrt der Kantaki. Diese Wesen haben den Glauben an eine transzendente Entwicklung des Universums, den sie über alles andere stellen. Dieser Glaube umfasst das absolute Verbot von Zeitmanipulationen. Einfach gesagt, sehen die Kantaki in sich so etwas wie Zeitwächter. Verstößt ein Volk gegen ihren Kodex, bestrafen sie es mit Isolation.
Vor einigen Generationen kam es zum ersten Zeitkrieg, bei dem die sogenannten Temporalen besiegt und in die zeitlose Zone, das Null, verbannt werden konnten. Sie arbeiten seither an einer Möglichkeit, auszubrechen und erneut mittels Zeitmanipulationen gegen die Realität vorzugehen.
Schlüssel sind zwei Menschen: Diamant und Valdorian. Diamant ist Pilotin eines Kantaki-Schiffes und steht damit außerhalb der Zeitlinie, Valdorian ist Wirtschaftsmagnat und Führer der größten menschlichen Macht in der Milchstraße. Der Konflikt zwischen diesen beiden Menschen verhilft den Temporalen zum Ende des zweiten Romans „Der Metamorph“ zum Ausbruch aus dem Null.
Der Zeitkrieg
Er tobt jetzt seit subjektiven 15.000 Jahren, der Widerstand (vor allem unterstützt durch Kantaki, ihre Piloten und befreundete Völker, die durch sie außerhalb der Zeitlinien stehen) ist kurz vor dem Zusammenbruch. Durch ihre Manipulationen entwickelten die Temporalen einen |Ozean der Zeit|, in dem es von verschiedensten Zeitlinien nur so wimmelt. Sie versuchen, den großen, endgültigen Kollaps der Realität herbeizuführen.
Valdorian entkommt seiner Gefangenschaft. Er soll nun benutzt werden, um die Rebellenstützpunkte aufzuspüren und den Sieg endgültig zu machen. Diamant stößt in mehreren Teilen zu den Rebellen. Ihr realstes Ich findet die eine Zeitlinie, in der der Ursprung aller Manipulationen stattfand und von den Temporalen mit allen Mitteln gegen die Korrektur durch die Rebellen geschützt wird. Ein Eingriff zum richtigen Zeitpunkt würde den Krieg ungeschehen machen und die Gefahr für das Universum bannen, aber die Entscheidung darüber bleibt ihr verwehrt. Es ist Valdorian, der den Schlüssel trägt, aber gleichzeitig kommt mit ihm auch die größte Gefahr …
Kaleidoskop
Zeit ist nicht völlig erfassbar. Die Thematik des Romans bringt es aber mit sich, dass die Zeit in ihren unmöglichsten Ausformungen eine tragende Rolle spielt. Brandhorst löst das Problem, indem er die Zeitlinien visualisiert: Im Ozean der Zeit wimmelt es von bunten Fäden, die alle eine eigene Zeitlinie darstellen, innerhalb der die Geschichte andere Wege geht als in den anderen. Die realste Zeitlinie, die ursprüngliche Linie, ist braun, dicht bei ihr liegende Linien sind blau oder violett. Die braune Linie liegt verborgen inmitten dieses zeitlichen Kaleidoskops, dort ist der Ausgangspunkt aller Manipulation.
Der Roman wird allen Ansprüchen und Erwartungen gerecht: Er ist äußerst komplex in seiner Handlung und im Thema, entwickelt dabei die Protagonisten weiter und führt ihre Konflikte zu Höhe- und Wendepunkten. Valdorian, dessen weltlicher Handlungspart in „Diamant“ zwar bereits einen Hauptteil ausmachte aber hinter der Faszination der transzendenten Welt der Kantaki zurückblieb, tritt immer stärker in den Mittelpunkt und erweist sich als Schlüsselfigur. Das Dilemma für die „gute“ Seite: Valdorian war ein arroganter und egozentrischer Mensch, der auch vor Morden nicht zurückschreckte.
Zeitweise gelingt Brandhorst die absolute Verwirrung. Da handeln die Ichs verschiedener Zeitlinien auf ein Ziel zu, bis man ihre temporale Herkunft in dem Durcheinander verloren hat. Das wird irgendwann wieder aufgedröselt, man meint zumindest zu erkennen, wer jetzt der Richtige ist und wer erst durch die Manipulationen existent geworden ist.
Kritisiert wurde in den beiden ersten Romanen „Diamant“ und „Der Metamorph“ oft, dass die Welt polarisiert ist. In den Konflikten Valdorians vor allem zum Ende des „Metamorph“s hin entwickelte sich bereits ein Ansatz für Grauzonen; im „Zeitkrieg“ erhalten schließlich alle Beteiligten ihren Hintergrund. Sogar die Temporalen, anscheinend die „Bösen“ der Trilogie, werden auf ihren Antrieb untersucht. Vor allem in diesem Zusammenhang bringt Brandhorst berührende und kosmische Erkenntnisse ans Licht. Die Transzendenz der kantakischen Philosophie erlangt etwas mehr Realität, aber sogar die Handlungen hoch überlegener Wesenheiten sind keinesfalls schwarz-weiß gemalt. Ihre Motivationen sind für uns schwer verständlich; Brandhorst gelingt eine vereinfachte Darstellung, indem sich diese unverständlichen Beweggründe als eine Art gefährlichen Spieltriebs zeigen.
Was sich für den Leser etwas schwieriger gestaltet, ist die Entwicklung Valdorians. Er ist der Schlüssel, aber um im positiven Sinn seine Wirkung zu haben, bedarf es einer menschlichen Wesensänderung. Um die Möglichkeit, die ihm eingeräumt wird, auch in unserem Verständnis richtig zu nutzen, musste Brandhorst alle Künste der Charakterentwicklung aufbieten.
Fazit
„Der Zeitkrieg“ wird allen Erwartungen gerecht, obwohl es an einigen wenigen Stellen den Anschein machte, als müssten unbedingt begonnene Fäden zur Lösung einbezogen und zu Ende gesponnen werden, so dass ein paar Handlungsaspekte durchaus vorhersehbar waren. Trotzdem ist der Roman eine sehr unterhaltsame, spannende und erhebende Leseerfahrung. Leider bleibt direkt nach dem Ende ein etwas schales Gefühl zurück: Ein Kreis ist geschlossen, Ursache und Wirkung heben sich auf, die Protagonisten stehen am Anfang vor einer unbekannten Zukunft. Und gewiss ist, dass man nicht alle Unbilden der Zukunft aus dem Weg räumen kann. Probleme finden immer eine Lücke.
Insgesamt eine umfassende, ausgefeilte, gefährliche und spannende Zukunftsvision, die ihre Beachtung verdient.
Der Autor vergibt: 




Sergej Lukianenko – Wächter der Nacht
Diese Welt ist nicht nur der Ort, den wir ahnungslosen Menschen kennen. Da gibt es auch das „Zwielicht“, eine Sphäre, die nur von den „Anderen“ wahrgenommen und betreten werden kann: gefährliche Wesen, die als Vampire, Werwölfe, Schwarzmagier oder Hexen bekannt sind, aber auch Zauberer und Gestaltwandler, die im Frieden mit den Menschen leben.
Licht und Dunkel wetteifern seit Äonen um die Vormacht. Das Gleichgewicht muss unbedingt gewahrt bleiben, sonst gerät die Welt aus den Angeln. Vor vielen Jahren war es einmal fast soweit. Die Mächte des Lichts und die Mächte der Dunkelheit hätten einander ausgelöscht, wäre nicht in letzter Sekunde ein Waffenstillstand zu Stande gekommen. Seither halten auserwählte „Lichte“ als „Wächter der Nacht“ zwischen Sonnenuntergang bis -aufgang ein Auge auf die Dunklen, während diese folgerichtig einen eigenen Orden, „Wächter des Tages“ genannt, die Aktivitäten der „Lichten“ kontrollieren lassen. Sergej Lukianenko – Wächter der Nacht weiterlesen
Robert Charles Wilson – Die Chronolithen
Wissen Sie das? Nein? Nun, keiner weiß, wer Kuin ist. Aber jeder kennt ihn. Seit dem Tag, an dem der erste „Chronolith“ im thailändischen Chumphon erschien. Ein blauer Obelisk aus einem unbekannten, nicht analysierbaren und anscheinend auch unzerstörbaren Material mit einer Inschrift, die den Sieg der alliierten Streitkräfte Kuins über Süd-Thailand und Malaysia preist – am 21. Dezember 2041. Zwanzig Jahre in der Zukunft. Spätestens aber, nachdem ein wesentlich größeres Exemplar in Form einer stilisierten menschlichen Gestalt explosionsartig Bangkok entkernt und zahllose Todesopfer gefordert hat. Und das war erst der Anfang …
Isaac Asimov – Der Aufbruch zu den Sternen (Foundation-Zyklus 3)
„Der Aufbruch zu den Sternen“ ist die direkte Fortsetzung der Ermittlungsromane um Elijah Baley und R. Daneel Oliwav, mit denen Asimovs „Foundationzyklus“ seinen Anfang nimmt, lässt man die Robotergeschichten ein bisschen außen vor. In diesen Romanen wird der Grundstein zur Foundation-Trilogie gelegt, die weltweite Berühmtheit erlangte. Im vorliegenden Roman findet erstmals das Konzept der „Psychohistorik“ Erwähnung, überraschend ist allerdings der Ursprung dieser Idee.
Aufbruch oder nicht?
Auf der Erde trainieren mutige Menschen unter Baleys Leitung den Aufenthalt im Draußen, unter freiem Himmel, fern der überkuppelten Stahlhöhlen. Baley selbst, der durch seine Ermittlungserfolge bei den Spacern große Sprünge auf der Karriereleiter machte (s. „Die Stahlhöhlen“) und dessen Taten durch hollywoodartig übertriebene Vorführungen berühmt wurden, muss eine weitere Ermittlung aufnehmen. Diesmal verschlägt es ihn nach Aurora, der ersten durch Menschen besiedelten Welt, auf der Dr. Fastolfe (Konstrukteur und Entwickler des humaniformen Roboters Daneel) in politische und gesellschaftliche Bedrängnis geriet.
Er ist Befürworter eines Plans, nach dem die weitere Besiedlung der Galaxis durch Erdenmenschen mit Hilfe der Spacertechnik erfolgen soll, da sie weitgehend unabhängig von Robotern sein können, im Gegensatz zu den Spacern selbst, die die Galaxis durch Roboter erschließen lassen wollen, um sich ins gemachte Nest zu setzen. Jetzt wird ihm zur Last gelegt, einen zweiten humaniformen Roboter zerstört zu haben, um damit die Bestrebungen seiner politischen Gegner zu sabotieren.
Mit seinem politischen Ende wäre der Traum der Menschen um Baley, die Erde zu verlassen, ausgeträumt. Es liegt also alles an ihm, durch geschickte Ermittlung die Unschuld Fastolfes zu beweisen.
Isaac Asimov ist zweifellos einer der bedeutendsten Science-Fiction-Schriftsteller aller Zeiten, wird oft sogar als der bedeutendste bezeichnet. Seine wichtigsten Hinterlassenschaften finden sich in den Drei Gesetzen der Robotik und in der Foundation-Saga, in deren Verlauf er den Weg der Menschheit ins All und ihr dortiges Bestehen schildert. Asimov wurde 1920 in der Sowjetunion geboren und verstarb im April 1992 in den Vereinigten Staaten.
Das Zwei-Wege-Rätsel
Der typische Stil Asimovs führt in diesem Roman, so man bereits etwas von Asimov gelesen und sich mit seinem Stil bekannt gemacht hat, schon auf der Anreise auf Aurora zur Ahnung einer Erkenntnis, die entscheidend für die Geschichte ist. Wie ist es möglich, dass der offensichtlich alte und überholte Roboter Giskard, der trotzdem ein Favorit des Robotikers Fastolfe ist, und der zusammen mit dem überragenden humaniformen Roboter Daneel zur Erde reist, um Baley abzuholen, eine konkrete Gefahr für den Geist Baleys vor Daneel bemerkt und eingreift, obwohl er sich im Gegensatz zu Daneel nicht mit Baley in einem Raum befindet? Es ist nicht nur diese Situation, die auf eine besondere Fähigkeit Giskards schließen lässt. Schrittweise führt Asimov den Leser an die offensichtliche Erkenntnis heran, die bereits in den ersten Kapiteln möglich ist – aber nur, da dem erfahrenen Leser klar ist, dass Asimov keine für die Geschichte irrelevanten Details einbringt, sondern sich so klar wie kaum jemand sonst an der Linie seiner Erzählung hält. Natürlich umfasst das auch Verwirrungsstrategien, denen der Leser wie auch der Protagonist erliegt und auf falsche Fährten gelockt wird.
Die Lösung des Rätsels gelingt Baley schließlich auf eine Art, die nicht vorhersehbar ist, und damit gelingt Asimov wieder eine Wendung, die selbst jene Leser überrascht, die den oben angesprochenen Aspekt der Geschichte früh durchschaut haben, oder zu haben glaubten. Bei der Lösung lässt Asimov nämlich die Frage, wer den zweiten humaniformen Roboter zerstört hat, in den Hintergrund treten und hangelt sich stattdessen an den eigentümlichen gesellschaftlichen Eigenschaften der Auroraner im Gegensatz zu jenen der Erdenmenschen entlang, bis es Baley gelingt, Fastolfe auf diese Art zu entlasten. Hier könnte man enttäuscht sein, würde das doch bedeuten, dass es zu einem Stilbruch gekommen wäre und der mitdenkende Leser seinen Erfolg nicht zu greifen bekommt. Aber selbstverständlich gibt sich Baley nicht nur mit der Lösung des Falls zufrieden, sondern sucht nach eben jener Erkenntnis, die Asimov tröpfchenweise in die Geschichte träufelte und die so wichtig ist für den Zusammenhang mit der Foundation-Trilogie und der Psychohistorik.
Hier wirft sich nämlich eine weitere interessante Frage auf, die keine direkte Beziehung zur Lösung des Falles Fastolfe hat: Wie kommt es zur Entstehung des Begriffs „Psychohistorik“ Jahrtausende vor dem genialen Hari Seldon, der die psychohistorische Mathematik entwickeln und den Begriff prägen wird? Es ist erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit Asimov dieser Brückenschlag zu fallen scheint, ein in unserer realen Zeit Jahrzehnte umfassender Brückenschlag zwischen diesen wichtigen Werken, die er erst später zu einem zusammenhängenden Zyklus zusammenstellte und kleine Lücken mit mehr oder weniger großem Geschick füllte (siehe „Das Foundation-Projekt“).
Fazit
Die beiden wichtigsten Aspekte des Romans (im Gesamtbild des Foundation-Zyklus) stehen nur bedingt mit der Lösung in Zusammenhang, aber direkt im Interesse Baleys, so dass es Asimov trickreich gelungen ist, eine spannende und sehr unterhaltsame Geschichte zum Träger einer wichtigen Idee zu machen. Was fast alle seiner Geschichten mit sich bringen, kommt in dieser sehr stark zum Tragen: die Möglichkeit für den Leser, seinen eigenen Gehirnschmalz mit einzusetzen und die Lösungsschritte Baleys entweder nachzuvollziehen oder vorwegzunehmen. Dieser Roman macht richtig Spaß!
Der Foundation-Zyklus
Meine Freunde, die Roboter
Die Stahlhöhlen
Der Aufbruch zu den Sternen
Das galaktische Imperium
Die frühe Foundation-Trilogie
Die Rettung des Imperiums
Das Foundation-Projekt
Die Foundation-Trilogie
Die Suche nach der Erde
Die Rückkehr zur Erde
Gene Hackman/David Lenihan – Jacks Rache. Eine abenteuerliche Reise nach Havanna
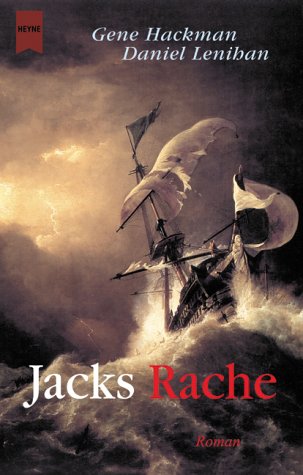
Gene Hackman/David Lenihan – Jacks Rache. Eine abenteuerliche Reise nach Havanna weiterlesen
Mary Higgins Clark – Hab Acht auf meine Schritte
Mary Higgins Clark hat sich schon seit langem einen Namen als Grand Dame der Spannungsliteratur gemacht, ihre erfolgreichen Romane zeichnen sich meist durch ausgeklügelte Plots mit psychologischem Hintergrund aus, die sich vom oft anzutreffenden Mittelmaß erfreulich abheben. Auch in ihrem aktuellen Thriller „Hab Acht auf meine Schritte“ versetzt Mary Higgins Clark sich und ihre Leser in die Rolle eines unschuldigen Opfers, mit dem es mitzufühlen gilt. In den letzten 25 Jahren hat die berühmte Autorin über 20 Kriminalromane veröffentlicht, die überwiegend zu internationalen Bestsellern avancierten.
Mary Higgins Clark – Hab Acht auf meine Schritte weiterlesen
Kurt Singer (Hg.) – Horror 1: Klassische und moderne Geschichten aus dem Reich der Dämonen
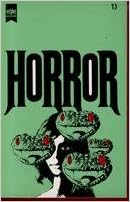
Kurt Singer (Hg.) – Horror 1: Klassische und moderne Geschichten aus dem Reich der Dämonen weiterlesen
Charles Stross – Supernova
„Supernova“ ist der Titel der direkten Fortsetzung von Charles Stross‘ Debütroman „Singularität“. Der Planet Moskau liegt mit Neu-Dresden in einem wirtschaftlichen Konflikt. Anscheinend steckt Neu-Dresden hinter der Attacke, die die Sonne Moskaus in eine Supernova verwandelt und ein Volk auslöscht. Eine etwas brachiale Methode der Konfliktlösung, möchte man meinen. Und natürlich streitet Dresden alles ab, sieht sich sogar selbst als Ziel des Rückschlags: Planetenbomber liegen unsichtbar auf Kurs.
Aus „Singularität“ ist bekannt, was eine „Verbotene Waffe“ ist: Kausalitätsverletzende Tätigkeiten, darunter fallen auch Waffen, können der Wesenheit „Eschaton“ gefährlich werden, sogar seine Existenz gefährden. Es ist also sein höchstes Bestreben, derartige Fälle zu verhindern; dabei greift es bei Bedarf auch hart, aber auf gewisse Weise humorvoll durch. Seit der Singularität, dem Entstehen des Eschaton, steht die Menschheit unter dessen Geboten, jegliche Kausalitätsverletzung zu unterlassen.
Nun beginnt „Supernova“ mit einer ebensolchen, hervorgerufen durch eine Verbotene Waffe. Ein Sonnensystem wird zerstört, ein bevölkerter Planet verdampft. Das wirft sofort die Frage auf, warum das Eschaton nicht eingegriffen hat?!
Versammlungsort: Weltraum
Wednesday Child
Wednesday, ein etwa neunzehnjähriges Mädchen, wird in den Fall verwickelt. Seit früher Kindheit steht sie mit Hermann, dem uns bekannten „Agenten“ des Eschaton, in Verbindung. Hermann brachte sie dazu, die verschiedenen Fertigkeiten der Spionage zu erlernen, so dass sie die dem Moskausystem vorgelagerte Raumstation, ihre Heimat, kennt wie unsereins den Inhalt seines Kühlschranks. Bei der Zwangsräumung der Station als Folge der Supernovabedrohung stößt Wednesday mit Hermanns Hilfe auf geheime Unterlagen, die brisante Informationen über die Schuldigen an der Katastrophe enthalten. Nun steht sie selbst im Fadenkreuz der Täter. Sie flüchtet über ein Luxusraumschiff, von Hermann mit den finanziellen Mitteln ausgestattet.
Die Übermenschen
Es existiert eine Organisation, die sich selbst als „Übermenschen“ bezeichnet. Ihre Mitglieder werden militärisch höchst effizient ausgebildet, ihre Fähigkeiten über Implantate verstärkt und ihre Emotionen kontrolliert. Ziel der Übermenschen ist es, das Eschaton zu vernichten und einen eigenen Gott zu entwickeln, in den der Geist aller verstorbenen Menschen zu seiner Entwicklung eingehen soll. Zu diesem Zweck sammeln die Übermenschen mit einer geheimen Technik Geistesinhalte ihrer Mitglieder, sobald diese gegen Vorschriften verstoßen – eine geeignete Kontrolle. Diese Tätigkeit sowie ihre hinterhältigen Eroberungsfeldzüge sind allgemein unbekannt, so dass sie weitgehend ungestört arbeiten können und der Allgemeinheit höchstens unheimlich sind.
Planetenregierungen übernehmen sie, indem sie die Mitglieder in Marionetten verwandeln, zu einer Volksrevolution treiben und sich schließlich als Hilfe anbieten, so dass sie ganz „legal“ an die diktatorische Macht kommen. Dass es daraus resultierende „Erziehungslager“ gibt, in denen brutal gewirtschaftet wird, ist weitgehend unbekannt.
An Bord des Luxusraumschiffs befindet sich eine kleine Gruppe der Übermenschen, die eine als Jugendfahrt getarnte Rundreise über jene Planeten unternehmen, auf denen Exminister der Moskauer Regierung sind, die über eine ultimative Vergeltungswaffe – die Planetenbomber – verfügen. Merkwürdigerweise gibt es unerklärliche Mordfälle an diesen Ministern, die zeitlich mit der Anwesenheit des Luxusschiffes zusammenfallen.
Die UN
Auf dem Schiff befindet sich auch die Geheimdienstlerin der Vereinten Nationen Rachel Mansour, die letztens den Konflikt in der Neuen Republik (vgl. „Singularität“) klärte, mit ihrem Mann Martin Springfield, der in selbigem Fall als Agent des Eschaton arbeitete (sein Verbindungsmann war ebenfalls Hermann, der sich jetzt um Wednesday kümmert). Sie sollen versuchen, die Mordserie aufzuklären und weitere Morde zu verhindern, um die Planetenbomber nicht in fremde Hände fallen zu lassen und sie von ihrem jetzigen Vergeltungsschlag gegen Neu-Dresden abzubringen.
Konfliktlösung
Stross befleißigt sich einer klareren Ausdrucksweise als im Vorgänger, so dass sich der Übersetzer weniger mit langen Anmerkungen zu arbeiten genötigt sah. Dadurch wird zumindest eine höhere Lesbarkeit erreicht und gleichzeitig das Augenmerk des Lesers auf den Inhalt gerichtet, wohin es gehört (das ist vielleicht der Unterschied zwischen der deutschen und der Originalausgabe von „Singularität“, das ja in englischsprachigen Ländern ein großer Erfolg war). Statt übermäßig vielen Anspielungen auf gesellschaftliche Begebenheiten der Heimat, unverständlich für Ausländer, und große physikalische Erklärungen entwickelt Stross eine mehrschichtige, spannende Handlung, die auch in „normaleren“ Bahnen abläuft als „Singularität“. Dabei bleiben leider einige interessante Aspekte als lose Fäden hängen, wobei die Hoffnung auf Auflösung in späteren Romanen begraben werden muss: In einem Interview für die SF-Zeitschrift „Locus“ soll sich Stross von den beiden Romanen distanziert haben. Er würde die Sache nicht weiter verfolgen, da ihm einige Inkonsistenzen durchgegangen seien. So werden wir wohl leider weder das Festival näher kennen lernen noch uns mit dem Eschaton und der großen Bedrohung für es auseinander setzen können.
Nochmal die Übermenschen
Davon abgesehen, kreiert Stross in Supernova wieder Spitzencharaktere mit vielfältigen Eigenarten und Hintergründen, die die Eigenarten glaubwürdig machen. Höchst interessant ist die Darstellung der Organisation der Übermenschen als brutal organisierte und gedrillte Sekte. Die Mitglieder lösen sich möglichst von den groben menschlichen Emotionen, alle Taten werden von dem großen Ziel geleitet, das Eschaton zu vernichten, um der eigenen Gottheit Willen. Dabei wagt sich Stross auf ein Terrain von großem Konfliktpotenzial: Die Übermenschen erinnern mit ihrer stolzen Logik und Überheblichkeit an die Darstellung der deutschen Nazis in Hitlers Gefolgschaft. Verstärkt wird der Eindruck durch deutsche Namen für die Handelnden; so heißt die Führerin passender Weise „Hoechst“, die Soldaten Karl, Paul und Mathilde begleiten sie. Ihren Namen voran wird ein U. gestellt, was ihre Zugehörigkeit zu den „Uebermenschen“ symbolisiert. Das Wort allein ist eine Übersetzung der Herrenrasse, der Arier. Ihre Handlungen sind von ähnlicher Abscheulichkeit: In den „Erziehungslagern“ werden Menschen umerzogen, Gehirne gewaschen, Menschen erniedrigt und gequält (was wiederum nicht an die Öffentlichkeit zu kommen bestimmt ist) -> Konzentrationslager der Zukunft.
Die Ideologie wird radikal und konsequent umgesetzt – die Frage dabei ist nur die nach Stross‘ Motivation diesbezüglich. Wenn man eine Verbindung zwischen dieser Organisation und den Nazis finden kann, erhält man sofort eine vorgebildete Meinung über die Mitglieder und die Glaubwürdigkeit von gemäßigten Aussagen und Standpunkten. Eine Vereinfachung der Charakterisierung für Stross, einfach Teil seines Zukunftsbildes oder steckt mehr dahinter? Natürlich gibt es auch hier Abtrünnige, wie es diese auch zu jeder Zeit in jedem diktatorischen Reich gibt und gab.
Das Eschaton
Was verbindet „Supernova“ mit „Singularität“? Die Protagonisten Mansour und Springfield (wobei Letzterer eine sehr viel geringere Rolle innehat) sowie der Eschatonagent Hermann und das Eschaton selbst, schließlich natürlich Bezüge wie die Erwähnung der „Neuen Republik“. Das Eschaton offenbart eine Schwäche und ein paar Eigenschaften, Dinge, die zu den interessantesten Themen dieses Universums zählen. Es existiert auf verschiedenen Zeitebenen und schickt seinen „jüngeren“ Ichs Informationen aus der Zukunft, vor allem, was die Gefahr von Kausalverletzungen angeht. Dadurch müsste es eigentlich Geschehnisse wie die Supernova des vorliegenden Bandes mittels Verbotener Waffen frühzeitig erkennen und verhindern können. Dass es das nicht konnte, deutet auf eine Schwäche oder einen mächtigen Gegner hin – mächtiger, als Hermanns Meinung nach die Übermenschen sind, die eigentlich mit ihrer ideologischen Planung eines „ungeborenen Gottes“ dem Eschaton noch längst nicht gefährlich werden können.
Sind die Übermenschen etwa doch mächtiger und dem Eschaton bereits ebenbürtig, war die verbotene Supernova doch ein Zufall (herbeigeführt durch unverstandene Experimente) oder existiert noch ein Gegner im Hintergrund, den Stross erst später vorstellen wollte? Fragen, die leider wohl keine Antwort mehr finden werden, soll man den Gerüchten um sein Interview glauben.
Fazit
Supernova ist weit besser lesbar als sein Vorgänger, die Kreativität der Geschichte ist beeindruckend und verlangt eigentlich nach Fortsetzung, in dieser Unabgeschlossenheit reicht es noch nicht zur vollen Befriedigung. Immerhin besteht die Hoffnung, dass Stross seine Ideen in anderer Richtung entfalten wird.
Der Autor vergibt: 




Michael Connelly – Die Rückkehr des Poeten
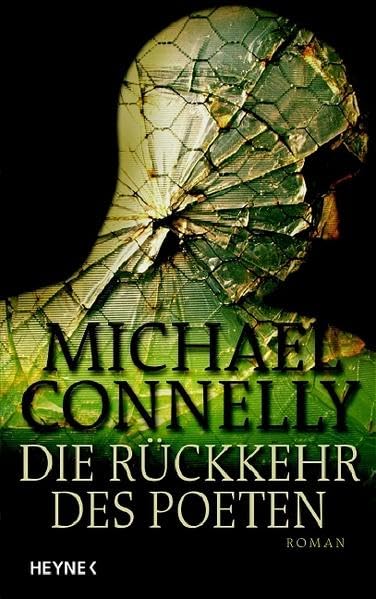
Ebenfalls in sein Visier gerät der Ex-Polizist Terry McCaleb, der nach einer Herztransplantation „ehrenamtlich“ als Profiler arbeitet und dem Poeten dabei bedrohlich nahe gekommen ist. Als McCaleb nach einem Herzanfall stirbt, glaubt seine Witwe nicht an einen natürlichen Tod. Sie bittet den Privatdetektiv Hieronymus „Harry“ Bosch, einen Freund ihres Gatten, um Hilfe und Aufklärung.
Neil Gaiman – Coraline – Gefangen hinter dem Spiegel

Neil Gaimans kleines Büchlein „Coraline“ dreht sich um die wundersamen Erlebnisse des kleinen Mädchens Coraline. Zusammen mit ihren Eltern ist sie in ein neues Haus umgezogen, in dem neben der jungen Familie noch ein verschrobener älterer Herr mit einem Mäusezirkus und zwei etwas beleibte, ehemals schauspielernde, ältere Damen wohnen. Es ist die Zeit der Sommerferien und während Coralines Eltern zu Hause ihrer Arbeit nachgehen, erkundet Coraline das Grundstück, bis ihr ein paar Regentage einen Strich durch die Rechnung machen.
Coraline erkundet also fortan die Wohnung und stößt dabei auf eine vermauerte Tür. Als die Mauer dann eines Nachts plötzlich verschwunden ist, schreitet Coraline hindurch und entdeckt eine Art Parallelwelt. Die Welt hinter der Tür sieht aus wie die Wohnung ihrer Eltern. Selbst Mama und Papa trifft sie dort an, auch wenn sie ein wenig verändert aussehen und statt Augen schwarze Knöpfe tragen. Die andere Mutter umgarnt sie und versucht sie zum Bleiben zu überreden. Coraline wird das alles mit der Zeit aber zu unheimlich und so kehrt sie in die richtige Welt zurück.
Als sie dort ankommt, muss sie feststellen, dass ihre richtigen Eltern verschwunden sind. Als sie zufällig in den Spiegel im Flur blickt, sieht sie dort ihre Eltern, gefangen hinter dem Spiegel, festgehalten von der anderen Mutter. Und so kehrt Coraline zurück in die Welt hinter der vermauerten Tür, um ihre Eltern zu finden. Eine äußerst schwierige Aufgabe steht ihr bevor, denn die andere Mutter will Coraline um jeden Preis für sich behalten. Sie ist hungrig nach Coralines Seele.
Schon der Untertitel des Buches („Gefangen hinter dem Spiegel“) offenbar eine sehr deutliche literarische Parallele. Mit der Figur der Coraline hat Neil Gaiman eine moderne Alice geschaffen. Die Parallelwelt hinter der vermauerten Tür ist Gaimans Pendant zu Lewis Carrolls Welt hinter dem Spiegel, durch den Alice steigt. Auch die dortige Welt scheint zunächst oberflächlich betrachtet mit der realen Welt identisch zu sein und Alice wird nach und nach mit den Unterschieden konfrontiert. Für Coraline ist die Situation ähnlich. Auch ihr erscheint die Welt hinter der Tür zunächst so wie die davor, doch schnell zeigt sich, dass sie nichts anderes als ein der Wirklichkeit nachempfundenes Trugbild ist.
Ähnlich neugierig und scheinbar furchtlos, wie Alice die Welt im Spiegelland erkundet, erforscht auch Coraline ihre neue Umgebung. Sie scheint sich kaum zu fürchten, Neugier und Forscherdrang siegen über die Angst. Ein wenig übermenschlich wirkt sie in ihrer Selbstsicherheit, was sicherlich in der eher oberflächlichen Figurenzeichnung und der Kürze der gerade einmal 175 Seiten langen Erzählung begründet liegt. Natürlich hätte eine etwas ausgefeiltere Skizzierung der Hauptfigur der Geschichte etwas mehr Tiefe verliehen. Würde Coraline etwas menschlicher erscheinen, wäre die Geschichte sicherlich noch einen Tick mitreißender und fesselnder, aber das ist ein eher kleiner Schönheitsfehler.
Das eigentlich Faszinierende an Gaimans Roman ist die Welt, die er erschaffen hat. Die Welt, die Coraline hinter der vermauerten Tür entdeckt, ist ein Abbild der Realität, die als nichts anderes als eine Falle fungiert. Die andere Mutter hat es auf Coralines Seele abgesehen. Warum das so ist, wird nicht deutlich und ist eigentlich auch bedeutungslos, aber Coraline ist nicht das erste Kind, das in ihre Falle tappt. Als Coraline in der Parallelwelt gefangen ist, trifft sie auf die seelenlosen Überreste anderer Kinder. Mit der bösen Frau, die kleine Kinder entführt, greift Gaiman zu einem geradezu klassischen Märchenelement und fügt es überzeugend in seine Erzählung ein.
Als die andere Mutter merkt, dass ihr stetiges Umgarnen nicht gerade auf fruchtbaren Boden fällt und Coraline cleverer und misstrauischer ist als erwartet, nimmt auch die von der anderen Mutter erschaffene Welt immer dunklere Züge an. Gaiman inszeniert ein raffiniertes Spiel zwischen der falschen Mutter und Coraline und reichert das Ganze mit einer Prise Horrorelemente an. Da wäre der golemartige Mensch im Keller des Hauses, die küchenschabenessende andere Mutter, eine Wohnung voller fledermausartiger Hunde, die von der Decke hängen. Gaimans Inszenierung ist schon ausgesprochen phantasievoll ausgeschmückt, obwohl sie sich auf den eng begrenzten Raum des Hauses beschränkt, und macht gerade auch wegen dieser Elemente Spaß. „Coraline“ ist letztendlich eine Geschichte, die einen Märchenplot mit Gruselelementen verbindet, und genau das ist Gaiman mit seinem Roman sehr gut gelungen.
Ursprünglich erschien die deutsche Ausgabe von „Coraline“ 2003 im |Arena|-Verlag und wurde dort als Buch für Kinder ab zehn Jahren deklariert. Tatsächlich deutet schon Gaimans Schreibstil an, dass sich „Coraline“ durchaus auch an eine jüngere Leserschaft richtet, ohne sich dem erwachsenen Leser zu verschließen. Die Bildhaftigkeit von Gaimans Sprache dürfte sich auch von Kindern durchaus gut erfassen lassen, macht aber Erwachsenen ebenso Freude.
Ob das Buch aber wirklich unbedingt für Kinder empfehlenswert ist, ist eine Frage, die die Meinungen spalten dürfte. Für Zehnjährige, die Gruselgeschichten gewohnt und entsprechend hart im Nehmen sind, mag das Buch in Ordnung sein, aber für andere Kinder sei da eher zur Vorsicht geraten. „Coraline“ ist eben nicht ganz ohne und wer ein zartes Gemüt hat, der sollte vielleicht wirklich lieber den Rat von Lemony Snicket befolgen und das Buch langsam und vorsichtig wieder zurücklegen.
Bleibt unterm Strich festzuhalten, dass „Coraline“ eine schöne kleine Portion Gruselmärchen für zwischendurch ist. Gaiman stellt einmal mehr sein Talent als phantasiebegabter Erzähler unter Beweis und liefert mit seinem Roman eine moderne Gruselvariante von Lewis Carolls Kinderbuchklassiker „Alice im Spiegelland“. „Coraline“ ist so angelegt, dass sowohl junges als auch älteres Lesepublikum Freude an dem Buch haben dürften. Dass die Figuren eher oberflächlich gezeichnet sind und die Geschichte dadurch vielleicht nicht so mitreißend ist, wie sie eventuell sein könnte, lässt sich in Anbetracht des Märchencharakters und der Kürze der Geschichte durchaus verzeihen.
Taschenbuch: 176 Seiten
Originalausgabe: Coraline, Harper Collins 2002
Aus dem Englischen übersetzt von Cornelia Krutz-Arnold
C. J. Box – Jagdopfer [Joe Pickett 1]

Isaac Asimov – Das Foundation-Projekt (Foundation-Zyklus 7)
Aus Isaac Asimovs großem Foundation-Zyklus liegt uns mit „Das Foundation-Projekt“ der siebente Band vor. Es ist der direkte Vorgänger der berühmten „Foundation-Trilogie“, die gleichsam Ursprung und wichtigstes Werk des Zyklus‘ ist. Im Foundation-Projekt lässt Asimov uns den Weg des großartigen Mathematikers Hari Seldon verfolgen, seinen Lebensweg und seine Entwicklung der Psychohistorik, durch die er der Menschheit den Weg aus dem Chaos nach dem Fall des Trantorschen Imperiums ebnen will.
Isaac Asimov wurde in der Sowjetunion geboren und emigrierte mit seinen Eltern in die USA, wo er neben seinem Studium der Chemie bereits Science-Fiction-Erzählungen schrieb und veröffentlichte. Besondere Steckenpferde waren ihm seine Erzählungen um die Roboter und ihre Psychologie sowie der große Entwicklungsbogen um die Zukunft der Menschheit; beide verband er schlussendlich in dem zehnbändigen „Foundation-Zyklus“, der somit als sein großes Werk angesehen werden kann. Asimov starb im April 1992.
Weitere Infos: http://www.asimovonline.com.
DER FOUNDATION-ZYKLUS
1. Meine Freunde die Roboter
2. Die Stahlhöhlen
3. Der Aufbruch zu den Sternen
4. Das galaktische Imperium
5. Die frühe Foundation-Trilogie
6. Die Rettung des Imperiums
7. Das Foundation-Projekt
8. Die Foundation-Trilogie
9. Die Suche nach der Erde
10. Die Rückkehr zur Erde
Hari Seldon arbeitet als Mathematikprofessor an einer Universität auf und in Trantor, der Hauptwelt und –stadt des Imperiums. Vor einigen Jahren hielt er einen übereifrigen Vortrag über seine Idee der Psychohistorik – einem mathematischen Modell zur Berechnung menschlicher Handlungen, nur anwendbar auf sehr große Gruppen, vergleichbar mit den physikalischen Gesetzen der Thermodynamik. Er wurde verlacht, nur Kaiser Cleon I. und sein Kanzler Demerzel (hinter dem sich der Roboter Daneel Oliwav verbirgt – was für eine Überraschung!) interessieren sich vorerst für seine Ansätze, könnte damit doch die Zukunft vorhergesagt und das bereits zerfallende Imperium gerettet werden!
Entgegen vielerlei Gefahren und politischen Attentaten, treibt Seldon seine Forschungen voran und entwickelt dabei mit Hilfe eines Teams die Geräte und die Mathematik, die später von der Zweiten Foundation benutzt werden würden. Gerade seine Enkeltochter entpuppt sich als erste Kandidatin für die zweite Foundation, die mit geistigen Kräften über die erste Foundation wachen soll. Das Projekt steht in den Startlöchern, Seldon ist mittlerweile uralt und hat alle seine Freunde und Verwandten überlebt, abgesehen von seiner Enkelin und ihrem Partner, Stettin Palver.
Dieser siebente Band des Zyklus stellt den Auftakt zur Foundation-Trilogie dar, die viele Jahrzehnte früher geschrieben wurde. Das Foundation-Projekt erschien erstmals im Jahre 1991, wohl als letzter Baustein des großen Zyklus. Man merkt ihm leider auch an, dass er eine Lücke füllt und das Geheimnis um den mysteriösen Entwickler der Psychohistorik lüftet. Die Handlung ist durchdacht und in Asimov-typischem Stil geschrieben, aber gewisse Details (wie die Anwesenheit von Daneel und anderer Roboter) lassen den Roman überladen wirken.
Stettin Palver ist tatsächlich ein Urahn von Preem Palver, der im Laufe der Trilogie eine wichtige Tat zur Rettung des Projekts vollbringt. Somit konnte es Asimov auch hier nicht lassen, Anspielungen auf seine „früheren“ Romane (die zeitlich später spielen) anzubringen. Daneel Oliwav, der Roboter, der bereits in den ersten Agentenromanen um die Entwicklung der Menschheit auftritt (siehe: Die Stahlhöhlen), hat ein kurzes Gastspiel und offenbart schon Fähigkeiten, die erst im zehnten Band ihre Erklärung finden (siehe: Die Rückkehr zur Erde). Insgesamt wirkt der Roman deutlich konstruiert, und mit seiner Entmystifizierung von Seldon hat Asimov dem großen Ganzen keinen Gefallen getan. Die einzelnen Romane bleiben für sich spannend, aber schließlich bleiben so gut wie keine Fragen mehr offen, die zu jenem universellen Gefühl führen könnten, das man allgemein als „sense of wonder“ bezeichnet (und das leider viel zu oft auch sinnentfremdet Verwendung findet).
Empfehlenswert ist, die Foundation-Trilogie und die beiden Folgeromane in Reihenfolge zu lesen und zu genießen, außerdem bieten die ersten Bände um die Roboter und die Agentengeschichten bis mindestens zur „Frühen Foundation-Trilogie“ hervorragende Unterhaltung. Band 6 „Die Rettung des Imperiums“ kann ich nicht beurteilen, da es leider vergriffen ist, aber den vorliegenden Band 7 sollte man nur lesen, wenn man nicht von Asimov lassen kann und der künstlich zusammengestellten Reihe vollständig folgen will. „Das Foundation-Projekt“ ist zweifellos ein unterhaltsames Buch, aber durch Asimovs zwanghafte Versuche, sein Werk in eine Form zu pressen, verliert es durch seine künstliche Konstruktion und die Überladung mit Anspielungen ein nicht unerhebliches Maß an Reiz.