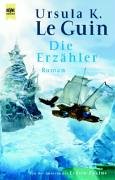
Ursula K. Le Guin – Die Erzähler (Hainish-Zyklus) weiterlesen
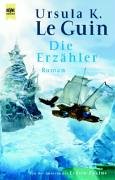
Ursula K. Le Guin – Die Erzähler (Hainish-Zyklus) weiterlesen
Golan Trevize wurde von Gaia, dem komplexen Planetenorganismus mit starken mentalistischen Fähigkeiten, dazu ausersehen, das Schicksal der Galaxis zu bestimmen. Gaia erkannte in Trevize die Fähigkeit, ohne ausreichende Daten die richtigen Schlüsse zu ziehen, was ihn geradezu prädestiniert, intuitiv zwischen den verschiedenen Möglichkeiten zu entscheiden: Dem zweiten Imperium nach Vorstellung der Foundation oder der zweiten Foundation, die im Hintergrund die Fäden ziehen würde, oder einem galaxisweiten Superorganismus nach Gaias Vorbild, ein Galaxia, ein allumfassendes Wesen, in dem der Mensch als Individuum keine Rolle mehr spielen wird, sondern jedes Wesen Teil des Ganzen wäre.
Trevize entschied sich für Galaxia, doch vertraut er selbst nicht auf seine von Gaia erkannte Fähigkeit, sondern will wahrhaftig wissen, warum er sich so und nicht anders entschied, da ihm persönlich die Vorstellung, alle Individualität aufgeben zu müssen, nicht erstrebenswert erscheint. Doch mit der gleichen Intuition, die ihn zu dieser Entscheidung trieb, weiß er, dass er die Gewissheit nur auf der Erde, dem vergessenen Ursprungsplaneten der Menschheit, erhalten wird. Also setzt er seine Suche nach der Erde mit dem gravitischen Raumschiff der ersten Foundation fort, begleitet weiterhin von Dr. Pelorat, dem Mythologen und Historiker, und Wonne, einem menschlichen Teil Gaias, die mit ihren durch Gaia vermittelten Fähigkeiten für Trevizes Sicherheit sorgen soll. Da sie immer mit Gaia in Verbindung steht, erfährt Gaia gleichzeitig den Fortschritt der Suche.
Trevize ist der Überzeugung, irgendwo in den gigantischen Bibliotheken der galaktischen Menschheit müssten sich Hinweise auf die Erde finden, da fast jeder Planet mit Mythen und Legenden um diese Welt aufwarten kann. Durch Gendibal, den Sprecher der zweiten Foundation, erfuhr er, dass selbst auf der Hauptwelt des ersten Imperiums alle Informationen über die Erde entfernt wurden, und das unter den Augen der Mentalisten von der zweiten Foundation, was auf eine größere Macht hindeutet. Die Hinweise der Mythen über die Erde, die in allerlei Variationen von einer unerreichbaren, radioaktiven Erde erzählen, überzeugen den ehemaligen Ratsherr Trevize endgültig: Jemand oder etwas von der Erde versucht, ihre Existenz zu verheimlichen – mit mächtigen Mitteln.
Nur auf den verbotenen Welten der ersten Siedlungswelle, den fünfzig Planeten der so genannten Spacers, finden sich vergessene oder übersehene Informationen, die Trevize und seinen Begleitern einen mühseligen Weg in Richtung Erde zeigen. Unterstützt durch den fortschrittlichen Computer des Raumschiffs scheint das Ziel endlich erreichbar zu sein …
Mit dem vorliegenden Roman bringt Asimov seinen Zyklus um die Foundation zu einem fulminanten Abschluss. Schon im vorhergehenden Band „Die Suche nach der Erde“ versuchte er einen Ringschluss mit einigen seiner früheren Werke, indem er die bisher im Foundation-Universum gänzlich fehlenden Roboter behutsam erwähnte. Diese Maschinenintelligenzen und eine großartig angelegte Geschichte der galaktischen Menschheit bilden einen wichtigen Punkt im Hintergrund des Abschlussromans. Mit den zwei Siedlungswellen der Spacers und Settlers wirft er einen Blick zurück und bindet weitere Ideen in das Universum ein, wie auch die Ansatzpunkte der Stahlhöhlen (hier noch in Mythen und Legenden verankert) oder die Radioaktivität der Erde. Auch der Lenker im Hintergrund, der Überroboter Daneel Olivav, stellt eine Anekdote der Vergangenheit und ein Verbindungsglied zu früheren Werken dar, so dass Asimov tatsächlich ein geschlossenes Werk seiner Eroberung des Weltraums schafft.
Asimov ist bekannt für sein Bestreben, jede Geschichte in absoluter Logik zu entwickeln. In Golan Trevize fand er einen herrlich passenden Protagonisten für diese seine Leidenschaft, über ihn konnte er die verschiedenen losen Enden des großen Zyklus’ verknüpfen und die angelegten Rätsel befriedigend entwirren. Obwohl Trevize dadurch manchmal wie ein Übermensch oder antiker Held wirkt, ist er nicht ohne menschliche Schwächen und dadurch durchaus sympathisch. Vielleicht merkte Asimov erst nach dem Ende des Vorgängerromans, welche Probleme ein Galaxia für die Individualität bedeuten würde, vielleicht war aber die Lösung durch die Rückkehr bereits geplant. Jedenfalls greift er genau diesen Punkt mit den ersten Worten des Romans auf und widmet die Geschichte einer befriedigenden Lösung. Ob die Lösung, die er ansteuerte, wirklich befriedigend ist, mag jeder für sich entscheiden, logisch ist sie allemal.
Mit dem 0. Gesetz der Robotik schiebt Asimov einen Punkt nach, der einige Probleme in der Robotpsychologie hervorruft oder auch eindeutiger löst. Hier hätte seine Psychologin Susan Calvin sicherlich ihre Freude gehabt: Ein Roboter darf der Menschheit keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass ihr Schaden widerfährt. Die drei anderen Gesetze müssen entsprechend abgestuft werden. Ist das wirklich wünschenswert? Mit diesem Gesetz, das die Roboter selbst entwickelten, können sie sich zur Unabhängigkeit von einzelnen Menschen entwickeln, je nach Auslegung. Daneel geht sogar so weit, sein Jahrtausende altes Gehirn mit dem eines Menschen zu verschmelzen, der unabhängig von den Robotergesetzen ist, um eben diese Gesetze umgehen zu können (natürlich zum Wohl der ganzen Menschheit!).
Gaia ist eine durch Roboter entwickelte Entität, das Ausbreiten dieses Wesens auf die Galaxis würde auch durch Roboter gefördert werden. Demnach wäre Galaxia eine künstliche Entwicklung nach Vorstellung der Roboter, die für die Sicherheit der Menschheit handeln und dabei die Individualität des Einzelnen hintanstellen. Trotzdem hat sich Trevize für diese Variante entschieden, und in diesem Buch gibt Asimov Antwort, warum.
Ganz in Asimovs typischem Stil gehalten, dominieren lange Dialoge den Roman. Mag er manchem Leser anstrengend oder gestelzt erscheinen, fasziniert mich diese Art der Erzählung und bietet mir Asimovs Gedanken und Ideen in Form wunderbarer Unterhaltung dar, die spannender nicht sein könnte. Die Geschichte um die Foundation kommt endgültig zu einem Abschluss, und mit den Anspielungen auf frühere Werke (die hinten im Buch als erweiterter Foundation-Zyklus aufgelistet sind) macht Asimov Lust auf mehr. Wer eintauchen möchte in die Welt der Psychohistorik und asimovschen Erzählweise, dem möchte ich die Foundation wirklich ans Herz legen. Allerdings muss erwähnt werden, dass „Die Rückkehr zur Erde“ nicht für sich allein steht, sondern den direkten Anschluss an „Die Suche nach der Erde“ bildet. Empfehlenswert ist der Einstieg mit der Foundation-Trilogie oder nach Asimovs Zusammenstellung mit dem Sammelband „Meine Freunde, die Roboter“.
Isaac Asimov ist einer der bekanntesten, erfolgreichsten und besten Science-Fiction-Schriftsteller, die je gelebt haben. Neben ihm werden oft Robert A. Heinlein und Arthur C. Clarke genannt. Asimov wurde 1920 in der Sowjetunion geboren und wanderte 1923 mit seinen Eltern nach New York aus. Seine erste Story erschien 1939. Zwischenzeitlich arbeitete er als Chemie-Professor in den USA, er schrieb neben seinen weltbekannten Romanen auch zahlreiche Sachbücher. 1992 verstarb er.
Zum Foundation-Zyklus
Meine Freunde, die Roboter
Die Stahlhöhlen
Der Aufbruch zu den Sternen
Das galaktische Imperium
Die frühe Foundation-Trilogie
Die Rettung des Imperiums
Das Foundation-Projekt
Die Foundation-Trilogie
Die Suche nach der Erde
Die Rückkehr zur Erde
Auf einer abgelegenen Welt des 87. Tamaniums – so etwas wie Staaten im lemurischen Imperium, dem Großen Tamanium – soll sich die geheime Temporalforschungsstation des lemurischen Suen-Clans befinden, protegiert durch den Tamrat Markam. Zwar wurden diese Forschungen verboten, doch jetzt, kurz vor der endgültigen Niederlage der Lemurer gegen die Bestien, greift man zum letzten Ausweg: Ein kleiner Kreuzerverband mit dem lemurischen Chefwissenschaftler an Bord soll diese Welt aufsuchen und die Gerüchte um eine Zeitmaschine überprüfen – um im Falle ihres Zutreffens eine Flotte in die Vergangenheit zu schicken, die den Heimatplaneten der Bestien vor deren Aufbruch ins All vernichten soll. Ein unglaubliches Zeitparadoxon.
Der kleine Verband wird unterwegs von Raumschiffen der Bestien aufgehalten und fast aufgerieben, ehe ein größerer Verband eingreift. Der Befehlshaber weiß nichts von dem Geheimauftrag und beordert die Überreste des Verbands zur Abwehr über einen bedrohten Planeten. Zufällig ist Levian Paronn oberster Technad des Planeten und erhält als solcher Einblick in die Berichte der Offiziere. Er erfährt von dem geplanten Zeitexperiment und erkennt, dass hier seine Bestimmung liegt, die ihm vor wenigen Jahren von einem Überwesen prophezeiht wurde. Er übernimmt den Auftrag und fliegt den bewussten Planeten an.
Icho Tolot, der halutische Freund Perry Rhodans und später Nachkomme der Bestien, erscheint in eben dieser Zeitstation auf dem Planeten aus dem Zeittransmitter und versetzt unwillentlich die Besatzung in Angst und Schrecken, die ja in ihm eine Bestie sehen muss. Um seine Loyalität zu beweisen, greift Tolot persönlich in einen Angriff der Bestien ein, die auf dem Planeten ein Blutbad anrichten. Er tötet einige seiner Vorfahren und hofft ständig, kein Zeitparadoxon zu verursachen.
Levian Paronn taucht auf und versucht, Tolot als letzten vermeintlichen Überlebenden der Bestien zu töten, dieser kann sich aber entziehen und gestikuliert wild, um Paronn auf den Atombrand aufmerksam zu machen, der, von den Bestien gelegt, die Welt vernichten wird. Paronn lässt den Zeittransmitter abbauen, doch bevor er ihn von der Welt transportieren kann, vernichtet ein weiteres Schiff der Bestien seinen Raumer. Auf der einen Seite der wütende Atombrand, auf der anderen Seite die gelandeten Bestien, scheint es für Paronn und seine Mission keine Zukunft zu geben. Es sei denn, die Fremde Bestie (damit denkt er an Tolot) griffe nochmals zu seinen Gunsten ein …
Thomas Ziegler wurde 1956 in der Nähe von Uelzen als Rainer Zubeil geboren, zog nach Wuppertal und Köln und verfasste phantastische Romane, in denen er immer wieder auf grundlegende Motive zurückkam: Seine Warnung vor rechtsradikalen Bewegungen, Kritik an von demokratischer Kontrolle entzogener Wirtschaft, seine Skepsis den Medien gegenüber und seine Betrachtungen von Natur, Umwelt, Ökologie. Ziegler sprudelte über vor Fantasie, was auch von seinem Autorenkollegen und späteren Rhodan-Autor Uwe Anton belegt wurde, mit dem er einige Romane in Kooperation schrieb. Zwischenzeitlich, nach seiner kurzen Einlage als Exposéautor bei Perry Rhodan, zog sich Ziegler aus der Phantastik zurück und widmete sich anderer Literatur, in der immer wieder Köln zum Schauplatz wurde. Erst in den letzten Jahren kehrte er zu seinen Wurzeln zurück und es war sogar ein Wiedereinstieg bei Perry Rhodan geplant. Kurz nach Fertigstellung des Manuskripts zum vorliegenden Roman verstarb Rainer Zubeil/Thomas Ziegler viel zu früh am 11. September 2004.
Mit seinem letzten Roman hat Ziegler seinen Beitrag zu neuen Einblicken in die lemurische Geschichte geleistet und gleichzeitig zur Lösung der letzten Fragen in diesem Minizyklus beigetragen. Levian Paronn, dessen Herkunft bisher im Dunkeln lag, kommt aus der Epoche des Niedergangs der lemurischen Zivilisation, vom Ende des Kriegs gegen die Bestien. Er ist Wissenschaftler und Technad; die mysteriöse Übergabe des Zellaktivators wird von Tolot so interpretiert, dass ES seine Finger im Spiel hat. Anscheinend hat ES noch etwas vor mit den Lemurern, oder es hätte ihnen nicht durch Paronn und die Zeitschleife um Tolot eine zweite Chance, die Überbrückung der Jahrtausende mit Generationsschiffen in die Gegenwart, gewährt. Also taucht ein neues Rätsel auf: Was bezweckt die Superintelligenz ES mit diesem Vorgehen? Allzu schwerwiegende Auswirkungen dürfte es nicht haben, oder im nächsten und letzten Band des Zyklus schlägt die Mission doch noch endgültig fehl, denn meines Wissens tauchen diese neuen Lemurer in der Heftserie bisher nicht auf.
Ziegler verarbeitet die bei Zeitreisegeschichten immer auftauchenden Fragen nach Paradoxa und der logischen Probleme sehr zufriedenstellend (auch dieses Themas nahm er sich oft und gern an in seinen Werken): Während man in den letzten Zyklen der Heftserie zu einer wenig erbaulichen Logik kam, nach der die Protagonisten bei Zeitreisen machen können, was sie wollen, ohne Paradoxa hervorzurufen, da „alles geschieht, weil es bereits geschah“, lässt Ziegler seinen Protagonisten Tolot viel über diese Problematik nachdenken und kommt eben nicht überzeugt zu diesem Ergebnis. Tolot ist der Meinung, man müsse sich durchaus vorsehen als Zeitreisender, um keine schwerwiegenden Fehler zu machen. Er zum Beispiel könnte in der Epoche durchaus doppelt existieren und es wäre fatal, seinem anderen Ich zu begegnen. Oder wenn er die Zerstörung des Zeittransmitters nicht verhindert hätte, wäre Paronn nicht in die Frühzeit der Lemurer gelangt, um dort die Sternenarchen auf die Reise zu schicken. Durch sein Wissen um die Zukunft (aus seiner Sicht eigentlich der Gegenwart) versucht Tolot, Veränderungen der Vergangenheit zu verhindern oder die Vorraussetzungen für eben die bekannte Zukunft zu schaffen. Paronn dagegen arbeitet bekanntlich darauf hin, über den langen Weg einer Jahrtausende währenden Zeitschleife doch noch das große Paradoxon hervorzurufen, um die Bestien seiner Zeit zu vernichten. Dass er damit die Nachfahren der Lemurer, die Terraner und so weiter auslöschen würde, interessiert ihn nicht, denn aus seiner Sicht sind sie nur eine mögliche Zukunft, die nicht eintreten muss (Ziegler beschreibt Paronn als Entwickler einer Multiversumstheorie, und nach diesen Gesichtspunkten ist Paronns Einstellung sogar nachvollziehbar – bis zu dem Punkt, dass er über die Zeitschleife die Zukunft ja erleben wird und sie dann nicht mehr eine Möglichkeit ist, sondern eben Realität).
Man sieht, Ziegler schafft mit diesem Roman eine befriedigerende Ansicht der Zeitproblematik als seine Kollegen in der Hauptserie, obwohl er sich schwerpunktmäßig auf die Erzählung seiner Geschichte konzentriert und so ein spannendes, sehr unterhaltsames Abenteuer um Icho Tolot entstehen lässt. Dabei hatte er eine denkbar schwierige Aufgabe, denn durch die vorhergehenden Romane ist in groben Zügen klar, wie Tolot in der Vergangenheit eingreifen muss.
Insgesamt kann Ziegler an das hohe Niveau von Andreas Brandhorst anknüpfen und dem Zyklus eine weitere Facette verleihen, die ihn über die Vorgänger „Odyssee“ und „Andromeda“ erhebt. Bleibt zu hoffen, dass Zieglers Ansichten über die Zeit von seinen Kollegen aufgegriffen werden und er damit dem unbefriedigenden „es geschieht, weil es geschah“ ein Ende setzt, denn eindeutig lässt sich so eine spannendere Geschichte erzählen. Mir hat dieser Roman sehr gut gefallen, und damit bewahre ich Rainer Zubeil in bestem Andenken.
Der Autor vergibt: 



New York, 1952: Die Hexenjagd des paranoiden US-Senators Joseph McCarthy ist auf ihrem Höhepunkt. Sie richtet sich gegen „Kommunisten“, echte oder eingebildete, die sich vor dem „House Committee on Unamerican Activities“ (HUAC) zu ihren „unamerikanischen Aktivitäten“ äußern müssen. Befindet sie dieses Tribunal für schuldig, werden sie bestraft, finden sich auf einer Schwarzen Liste wieder und erhalten praktisch Berufsverbot.
Die Künstlerwelt ist dem HUAC schon lange ein Dorn im Auge. Sie gilt als Stall allzu freidenkender Salon-Kommunisten, den es endlich auszumisten gilt. Um ihre Pfründen bangend schlagen sich die großen Filmstudios in Hollywood, aber auch Radiostationen, Theater und sogar Nachtclubs im ganzen Land auf die Seite der Hexenjäger. Diese zwingen ihre Opfer unter Androhung hoher Strafen dazu, Namen von „Kommunisten“ zu nennen. Die Folge: ein blühendes Denunziantentum. George Baxt – Mordfall für Tallulah Bankhead weiterlesen
Zum zweiten Mal kehrt Tim Underhill, Erfolgsschriftsteller aus Manhattan, in seine Heimatstadt Millhaven zurück, der er vor vielen Jahren den Rücken gekehrt hat. Erst hatte sich Nancy, die Gattin seines ungeliebten Bruders Philip, auf grausame Weise umgebracht. Wenig später verschwindet Mark, ihr Sohn, Tims Neffe, mit dem er sich gut versteht. Er ist nicht der erste Jugendliche, der vermisst wird. In Millhaven treibt ein Serienmörder sein Unwesen, der offenbar die Kontrolle über sich zu verlieren beginnt und die Taktfrequenz seiner Attacken steigert.
Marks tatsächliches Schicksal ist wesentlich bizarrer. Ein verlassenes Haus auf einem Nachbargrundstück hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Es zog ihn an und stieß ihn gleichzeitig ab: Hier ist spürbar Furchtbares geschehen, das die Wände des Gebäudes wie eine Batterie aufgeladen hat. Michigan Street 3323 war vor vielen Jahren die Adresse von Joseph Kalendar, der als Psychopath und Serienmörder in die US-amerikanische Kriminalgeschichte einging. Man hatte ihn erst nach Jahren des Foltern und Mordens erwischt. In einer Anstalt für geistesgestörte Verbrecher wurde er 1985 von einem Mithäftling umgebracht.
Was Mark nicht wusste: Kalendar war ein Cousin seiner Mutter. Es gibt eine seltsame Verbindung zwischen ihr und dem toten Mörder. Dies war der Grund für Nancys Selbstmord. Sie hatte eine alte Schuld nicht länger ertragen: Einst hätte sie dem üblen Treiben ihres Cousins vorzeitig ein Ende machen können, war aber furchtsam zurückgewichen. Mark ist stärker, er wollte es mit Kalendar aufnehmen, zumal er entdeckte, dass dieser seine ebenfalls ermordete Tochter noch immer in den Folterhöhlen des Hauses Nr. 3323 gefangen hält und quält. Immer tiefer drang Mark in die schrecklichen Geheimnisse des alten Hauses ein. Aber dort ist es nicht Kalendar, der ihn vor jene Entscheidung stellt, die zu seinem Verschwinden führt …
Geschichte mit offenen Enden
„Haus der blinden Fenster“ – der Originaltitel „Lost Boy Lost Girl“ wird der Geschichte wesentlich gerechter – ist eine bemerkenswert gelungene Mischung aus Thriller und Gruselgeschichte. Wo man die Grenze zieht, bleibt dem Leser überlassen. Die phantastischen Elemente sind eindeutig, sie lassen sich nicht rational auflösen. Auf der anderen Seite spielt sich vieles von dem, was sich scheinbar ereignet, wohl nur in den Köpfen der Figuren ab.
„Haus der blinden Fenster“ ist wie so oft bei Peter Straub ein Roman, der um die Themen Schuld, Sühne & das Böse an sich kreist und dabei auf Genregrenzen keine Rücksicht nimmt. Darin gleicht er dem Schriftsteller Henry James (1843-1916), mit dem Straub – auch was die literarische Qualität angeht – oft verglichen wird. „The Turn of the Screw“ (1898; dt. „Die Drehung der Schraube“) weist in der Tat dieselbe unwirkliche Atmosphäre realer und übernatürlicher Bedrohung auf wie „Haus der blinden Fenster”.
Viele Fragen wirft Straub auf. Manche beantwortet er, andere können wir uns selbst zusammenreimen. Nicht wenige bleiben jedoch offen. Ist der Sherman-Park-Killer der wiedergeborene Joseph Kalendar? Ist er ein Mensch, der von dessen Geist besessen ist? Wird Nancy Underhill wirklich vom Geist der Kalendar-Tochter, die sie einst feige im Stich ließ, in den Tod getrieben? Bildet sie sich das in nur ein? Wird auf dem privaten Friedhof des Sherman-Park-Killers doch die Leiche Marks zum Vorschein kommen, den sein Onkel in der „anderen Welt“ wähnt? Worum handelt es sich bei dieser “anderen Welt” eigentlich? Ist sie das Jenseits, eine fremde Dimension, eine parallele Erde?
Geschichte ohne sicheren Boden
Straubs komplexer Schreibstil verstärkt geschickt die Unsicherheit, die der Leser mit den Figuren teilt. Wir erleben Zeitsprünge in Vergangenheit und Zukunft. Die Perspektive wechselt; manchmal erzählt Tim Underhill, dann wird er vom (unsichtbaren) Verfasser beobachtet, der im Mittelteil die Handlung fast gänzlich Mark Underhill überlässt. Manche Ereignisse werden parallel geschildert, wobei die Interpretation sehr unterschiedlich ausfallen kann: Tim und Mark sehen die Welt nicht mit denselben Augen.
Das verwunschene Haus, in dem es aufgrund eines lange in der Vergangenheit liegenden Unrechts umgeht, ist längst ein Klischee der Phantastik. Auf jeden Fall ist es schwierig, ihm heutzutage neues Leben einzuhauchen. Auch hier leistet Straub gute Arbeit. Auf dem Grundstück Nr. 3323 lastet wahrlich ein Haus gewordener Alptraum.
Wiederum wurzelt das Grauen ausschließlich in der menschlichen Seele; für Außerirdische, Trolle, Vampire und andere Ausgeburten des klassischen und halbwegs gemütlichen Horrors ist kein Platz in Straubs Welt/en. Auch das Paradies, in dem Mark und seine Lucy sich wiederfinden, entpuppt sich als Stätte zwar ungewöhnlicher aber deshalb nicht weniger bedrohlicher Gefahren.
Kontrollverlust und Seelennöte
Timothy Underhill ist Peter Straubs anderes Ich, sein fiktiver Stellvertreter, den er gegen allerlei eingebildete und echte Dämonen kämpfen lässt, seit er ihn 1988 zum ersten Mal mit dem „Blue-Rose“-Mörder konfrontierte („Koko“), dessen Geheimnis erst 1993 in „The Goat“ (dt. „Der Schlund“) gelüftet wurde. Seither hielt sich Underhill verständlicherweise Millhaven (das Spiegelbild Milwaukees im US-Staat Wisconsin, der realen Heimatstadt Straubs) fern, weil sich für ihn viele unerfreuliche Erinnerungen an diesen Ort knüpfen.
Zu schaffen macht ihm auch die provinzielle Enge der kleinen Stadt, die vortrefflich verkörpert wird durch seinen Bruder Philip. Der hat sich scheinbar im biederen Establishment etabliert und ist doch die personifizierte Unzufriedenheit. Seiner Familie bereitet Philip wenig Freude, er ist gefühlskalt, egoistisch, unsensibel, untauglich als Ehemann und als Vater.
Mark, sein Sohn, ist eher nach Onkel Tim geraten. Mit seinen fünfzehn Jahren steckt er tief in der Pubertät, was seinen Alltag nicht einfacher macht. Seine Gefühle sind außer Kontrolle, seine Hormone laufen Amok. So wird er zum idealen Opfer für das Haus an der Madison Street. Zunächst voller Furcht über das, was er dort entdeckt, wird Mark zum jungen Ritter, der seine Prinzessin Lucy vor dem Drachen Kalendar retten will. Dafür zahlt er einen hohen Preis. Andererseits ist sein Schicksal angesichts der trüben Zukunft, die ihm sein reales Leben bietet, womöglich eine Verbesserung. Wie schon gesagt muss Mark jedoch feststellen, dass auch die „andere Seite“ keineswegs frei von Bedrohungen ist.
Geist oder nicht Geist?
Stets bleibt unklar, ob es wirklich Joseph Kalendar ist, dessen Geist noch immer nicht ablassen will von seiner krankhaften Menschenquälerei. Womöglich ist es der reale Sherman-Park-Killer, der sich mit dem berühmten ‚Kollegen‘ identifiziert und in dessen Haut schlüpft. Weil er uns niemals direkt unter die Augen tritt, ist Kalendar jemand, der für Angst und Schrecken sorgt – ein Schreckgespenst, das viel von dem verkörpert, was man sich unter einem Serienmörder vorstellt: eine schattenhafte Gestalt, die wie ein Mensch aussieht, aber eigentlich keiner mehr ist, sondern etwas Atavistisches, Düsteres, ein Wolf unter Schafen, aber ein gut getarnter, der Jagd auf seine ahnungs- und hilflosen Mitbürger macht.
Atmosphäre und interessante, eindringliche gezeichnete Figuren: Diese beiden Aspekte sind Straub deutlich ebenso wichtig wie die Handlung. Das Ergebnis mag den notorischen Mainstream-Horror-Leser irritieren oder womöglich abschrecken, aber wer sich auf “Haus der blinden Fenster” einlässt, erlebt einen Peter Straub in Hochform.
Autor
Peter Francis Straub wurde am 2. März 1943 in Milwaukee im US-Staat Wisconsin geboren. Der Schulzeit folgte ein Studium der Anglistik an der „University of Wisconsin“, das Straub an der „Columbia University“ fortsetzte und abschloss. Er heiratete, arbeitete als Englischlehrer, begann Gedichte zu schreiben. 1969 ging Straub nach Dublin in Irland, wo er einerseits an seiner Doktorarbeit schrieb und sich andererseits als ‚ernsthafter‘ Schriftsteller versuchte. Während die Dissertation misslang, etablierte sich Straub als Dichter. Geldnot veranlasste ihn 1972 zur Niederschrift eines ersten Romans („Marriages“; dt. „Die fremde Frau“), den er (mit Recht) als „nicht gut“ bezeichnet.
1979 kehrte Straub in die USA zurück. Zunächst in Westport, Connecticut, ansässig, zog er mit der inzwischen gegründeten die Familie nach New York. Ein Verleger riet Straub, es mit Unterhaltungsliteratur zu versuchen. Straub schrieb „Ghost Story“ (1979; dt. „Geisterstunde“), seine Interpretation einer klassischen Rache aus dem Reich der Toten. Der Erfolg dieses Buches (das auch verfilmt wurde), brachte Straub den Durchbruch. Mit „Shadowland“ (1980; dt. „Schattenland“) und „Floating Dragon“ (1983; dt. „Der Hauch des Drachens“) festigte er seinen Ruf – und erregte die Aufmerksamkeit von Stephen King, mit dem er sich bald anfreundete. Die beiden Schriftsteller verfassten 1984 gemeinsam den Bestseller „The Talisman“ (dt. „Der Talisman“), dem sie 2001 mit „Black House“ (dt. „Das schwarze Haus“) eine ebenso erfolgreiche Fortsetzung folgen ließen.
Straubs Werke wurden vielfach preisgekrönt; akademisch penibel zählt der Autor seine Meriten hier auf. Diese Website ist ebenso informativ wie kurios und verrät einen intellektuellen Geist, der über einen gesunden Sinn für hintergründigen Humor verfügt.
Taschenbuch: 379 Seiten
Originaltitel: Lost Boy Lost Girl (New York : Random House, USA 2003)
Übersetzung: Uschi Gnade
http://www.randomhouse.de/heyne
Der Autor vergibt: 




Wir schreiben das Jahr 1327. Marcella Bonifaz, Nichte des Trierer Schöffenmeisters ist eine junge Frau, die sich von niemandem etwas vormachen lässt. Sie ist Krämerin und handelt mit Gewürzen und Farbstoffen – und das in einer Zeit, in welcher der Handel eine Männerdomäne ist. Als sie günstig an toskanischen Safran kommt, schlägt sie zu und investiert fast ihr ganzes Vermögen. Doch der Wagenzug, der den kostbaren Safran liefern soll, wird überfallen und Marcella steht beinahe vor dem finanziellen Ruin. Eine Möglichkeit, allen Sorgen ein für alle Mal ein Ende zu bereiten, wäre es, endlich den Heiratsantrag des reichen Händlers Jacob Wolff anzunehmen. Doch Marcella will nicht heiraten – nicht nur Jacob nicht, sondern überhaupt nicht.
„Einer der originellsten Science-Fiction-Romane, die je geschrieben wurden!“
„Wie einst William Gibson haucht Charles Stross der Science Fiction neues Leben ein!“
Mit diesen flammenden Zitaten heischt der Roman im Regal um Aufmerksamkeit. Charles Stross? Nie gehört! Aber wen die New York Times als neuen Superstar bezeichnet, muss der Aufmerksamkeit doch wert sein, oder?
Charles Stross, geboren 1964 in Leeds, England. „Singularität“ ist sein erster Roman und wurde gleich ein großer Erfolg.
In der Zukunft der Menschheit wird mit Singularität jenes Ereignis bezeichnet, bei dem die Erdbevölkerung um zwei Drittel geschrumpft wurde und fast alle Regierungen zerbrachen, da der Rückhalt, vor allem der steuerliche Rückhalt durch die Bevölkerung fehlte. Ein mächtiges Wesen (oder Volk?) sortierte die Menschen nach Ideologie und Wesensart, um verschiedene Kolonien in der Galaxis zu gründen. Die neuen Kolonien wie auch die zurückbleibende Erde rüstete das Wesen, das sich „Eschaton“ nennt, mit so genannten „Füllhörnern“ aus: Geräte, die jede nur vorstellbare Ware herstellen können und zur Selbstreplikation befähigt sind. Damit verlor die Wirtschaft ihren Sinn, eigentlich brach das Chaos aus.
Das Eschaton auferlegte den Menschen, „in seinem Zeitkegel“ keinerlei Manipulationen der Zeit vorzunehmen, um seine Existenz nicht zu gefährden. Man einigte sich darauf, dieser Forderung zu entsprechen, denn das Eschaton konnte jegliche Missachtung mit Vernichtung strafen. Auf der Erde blieben als einzige Organisation die UN bestehen, allerdings mit sich oft verschiebenden Zielen und Ansprüchen. Die anderen Planeten entwickelten je nach Zusammenstellung der Bevölkerung verschiedene Regierungssysteme, immer auf der Grundlage der neuen Möglichkeiten. Nur in der „Neuen Republik“ wurden die Füllhörner vernichtet, Information und Technik dem Volk vorenthalten, so dass sich eine feudale Herrscherklasse entwickeln konnte.
Das ist in groben Zügen der Hintergrund, vor dem Charles Stross seine Geschichte spielen lässt. Durchaus originell. Aber es kommt noch besser: Über einer abgelegenen Kolonie der Neuen Republik erscheint das „Festival“ und stiftet Unruhe. Es lässt Telefone vom Himmel regnen, in einer kommunikationsarmen Gesellschaft ein Unding. Durch diese Geräte nimmt es Kontakt zu den Menschen auf und fordert: „Unterhaltet uns!“
Das Festival ist auf Informationen aus, es tauscht seine Dienste gegen die Geschichten und das Wissen der Bevölkerung. Jeder, der ihren Forderungen nachkommt, darf sich etwas wünschen. Das System auf dem Planeten bricht zusammen. Revolutionäre erhalten Füllhörner, jemand lässt Geld regnen, was unbeachtet bleibt, da jeder alles hat, was er will. Ein Hilferuf ist die letzte Hoffnung für das ansässige Herzogtum.
Aus gesellschaftlichen Gründen muss der Kaiser den dienstältesten Admiral mit dieser schwierigen Lage betrauen, unglücklicherweise altern auch Admirale in Friedenszeiten normal, und da der Rückzug in den Ruhestand nicht vorgesehen ist, muss dem senilen Admiral Kurtz zumindest das Angebot gemacht werden. Der ist natürlich Feuer und Flamme, aber noch geistig klar genug, um einen fähigen Geschwaderkommandeur mitzunehmen. Geplant ist eine Fast-Verletzung der Kausalität, indem man mit neuartigen Triebwerkszusätzen erst in die Zukunft vordringt, um sich dort über Nachrichtensonden Informationen über den Gegner zu holen, und dann in die Vergangenheit zurückkehrt, aber nicht so weit, dass man vor Eintreffen des Festivals im Zielsystem anlangt, sondern sehr kurz danach – also einfach eine enorm schnelle Reaktion vortäuscht.
Um der Geschichte zu beweisen, man habe die Kausalität nicht verletzt, wird die UN-Inspektorin Rachel Mansour als Beobachterin eingeladen. Und noch ein Fremder ist mit von der Partie: Maschineningenieur Martin Springfield von der Erde, der durch sein republikwidriges Verhalten die Spionageabwehr auf sich zieht.
Die Lord Vanek ist das Flaggschiff der Operation. Und während sich in den Wochen der Anreise Rachel und Martin nahe kommen, intrigieren verschiedene Parteien in verschiedenen Punkten; so verbindet der republikanische Spion Wassily die Überwachung von Martin mit seinem Unbehagen einer selbstständigen Frau gegenüber, indem er auch Rachel nachspioniert. Das kommt dem Sicherheitsbeauftragten der Vanek gelegen, der Rachels diplomatische Immunität umgehen und sie kriegsgerichtlich erledigen will (aus ähnlich missgünstigen Gründen wie denen von Wassily). Nebenbei arbeitet Martin für eine höhere Instanz an der Sabotage der Fast-Kausalitätsverletzung, und Rachel spielt ihre diplomatischen Beziehungen aus, um die Flottenführung von der Sinnlosigkeit eines bewaffneten Angriffs auf das Festival zu überzeugen.
Derweil breitet sich das Festival auf dem okkupierten Planeten „Rochards Welt“ aus und bereitet seine Wiedergeburt vor. Es ist fremdartiger, als sich (fast) alle Beteiligten je ausmalen können …
Rachel Mansour ist die typische starke Frauenpersönlichkeit mit einem komplizierten Lebenslauf, der über verschiedene Stationen zur Waffeninspektorin der Vereinten Nationen führt. Natürlich nutzt sie die fortschrittlichen Möglichkeiten der Zukunft für ihre körperliche Aufwertung, so ist sie gespickt mit technischen Verstärkern und Beschleunigern, die sie jedem normalen Nahkämpfer überlegen machen. Zusätzlich trainiert sie (nackt) asiatische Kampfkünste und unterzog sich diversen Verjüngungskuren, die ihr die körperliche Leistungsfähigkeit und das Aussehen einer Endzwanzigerin bei einem tatsächlichem Alter von über einhundert Jahren bescheren. In ihrer Vergangenheit gibt es einige böse Erfahrungen, die sie zu einer energischen Atomwaffengegnerin machen. Und eigentlich hat sie sich fest vorgenommen, keinerlei persönliche Beziehung zu einem Mann einzugehen. Wie es der Zufall will, hat sie ihre Rechnung ohne Martin gemacht.
Martin Springfield hütet ein kurioses Geheimnis (kurios für die Menschen seiner Umgebung): Eigentlich arbeitet er für eine irdische Raumschiffswerft als Vertragsingenieur und gelangt als solcher an Bord der Lord Vanek, hintergründig verfolgt er Ziele, die denen von Rachel weit voraus sind. Es geht ihm nicht um die Abwendung eines Krieges, sondern um die Einhaltung der Kausalitätsabkommen mit dem Eschaton. Sein Auftraggeber, Herrmann, tritt nicht direkt in Erscheinung, verfügt aber über scheinbar unbegrenzte Machtmittel. Dass Martin so vorbehaltlos sein Leben aufs Spiel zu setzen bereit ist, fällt dem Leser gar nicht weiter auf, denn Herrmann versichert ihm, alles Mögliche für seine Rettung zu tun. Und außerdem steht er in hohem Sold bei Herrmanns Organisation.
Burija Rubenstein leitet die organisierte Revolution auf Rochards Welt. Er scheint ein wenig der idealisierte Kommunist zu sein, dem die Füllhörner endlich die Gelegenheit geben, seine Ideen durchzusetzen. Durch die KRITIKERIN, eine Begleiterin des Festival, erhält er Einblicke in die tief greifenden Veränderungen, die das Festival bewirkt. Dass ihn diese Erlebnisse mit Realität gewordenen Aspekten russischer Märchen konfrontieren, lässt ihn abstumpfen und etwas von seinem unruhigen, drängenden Revolutionsgehabe verlieren. So transportiert ihn die KRITIKERIN zum Beispiel in ihrem wandelnden Haus auf drei Hühnerbeinen, sie selbst hat allerdings kaum Ähnlichkeiten mit der Baba Jaga. Im Mittelteil des Buches wirkt diese Erzählebene so irrwitzig, dass sie dem Ganzen einen überdrehten Charakter verleiht. Von dem Wesen des Festivals erfährt man dadurch wenig, was schade ist, denn so bleiben die Informationen auf die wie nebensächlich eingeworfenen Dialoge zwischen Martin und Rachel beschränkt.
Obwohl auch einige der anderen im Buch erwähnten Figuren wichtige Rollen spielen (wie der Kommandant des Flaggschiffs, der eine Art intelligenten Patriotismus darstellt), bleiben diese drei Personen die Hauptakteure und Bezugspunkte der Erzählebenen. Die Ebene der Flotte im Anflug auf den Gegner birgt wenig Neues, allzu sehr geht der Autor auf die Abläufe in einer Befehlszentrale während der Manöver ein und überhäuft den Leser mit der undurchsichtigen Befehls- und Meldungssprache zwischen Soldaten – wie realitätsnah das ist, lässt sich aus meiner Sicht nicht beurteilen. Es liefert eine oberflächliche Stimmung an Bord, stört aber die durchaus interessanten Aspekte der Beziehungen zum Beispiel zwischen dem Admiral und seinem Stab. Dadurch kann Stross ein starkes Augenmerk auf die Abläufe der kämpferischen Begegnung zwischen Republik und Festival bieten, und man ist erstaunt, wie der Kommandant dieses und jenes aus nicht vorhandenen Schiffsbewegungen schließen kann, obwohl er doch keinerlei Erfahrung mit einem Raumkampf und keine Vorstellung vom Festival hat.
Die abgedrehte Schilderung der Vorgänge auf Rochards Welt vereinfacht nicht gerade das Verständnis des Festivals oder auch der Geschichte an sich, hier hat der Autor wie schon erwähnt etwas zu dick aufgetragen in dem Bemühen, eine originelle Form der Invasion zu entwickeln. Bleibt also nur die Beziehung zwischen Rachel und Martin, und tatsächlich erfährt man in diesem Zusammenhang die meisten Details, die das Geschehen begreiflich machen oder der Geschichte als Hintergrund dienen. Komischer Zufall bleibt, dass Wassily, der Spion der Republik, einen Unfall im Weltraum übersteht und auch noch auf Burija trifft, der sich als sein verschwundener Vater entpuppt und von ihm umgebracht werden soll. Dabei stellt sich heraus, dass Wassily programmiert auf diesen Moment ist und seine Spionage nur als Vorwand diente, ihn auf das Flaggschiff zu bringen. Unglaubwürdig, denn auf Rochards Welt hätte die Republik viel erfolgversprechendere Möglichkeiten gehabt, den Revolutionär auszuschalten, als über einen Agenten durch eine Raumschlacht mit ungewissem Ausgang.
Mit „Singularität“ hat Charles Stross ein durchaus interessantes und ausbaufähiges Universum entworfen, in dem noch viele Geheimnisse schlummern. Die Wesenheit des Eschaton ist eines dieser Rätsel und scheint mir ein Aufhängepunkt weiterer Romane zu sein – immerhin ist mit „Supernova“ ein weiteres Buch angekündigt, und das Schicksal von Martin und Rachel lässt erahnen, dass wir hier die Geburt eines neuen Agentenpärchens miterlebt haben. Insgesamt ist „Singularität“ gut und unterhaltsam lesbar, auch wenn mich die sehr häufigen Anmerkungen des Übersetzers gestört haben, da sie sich größtenteils mit physikalsichen Gesetzen beschäftigen oder Anspielungen des Autors erklären sollen. Das bringt auch gleich die negative Seite der Geschichte auf den Punkt. Der Autor brachte zu viele Bezüge zu unserer Realität, die entweder nur ausgebildete Physiker oder seine Landsleute verstehen können (da werden zum Beispiel Anspielungen auf Fernsehserien oder neueste wissenschaftliche Erkenntnisse gebracht, die auch durch die Übersetzung oder die ausführlichen Erläuterungen des Übersetzers nicht zum Lesegenuss beitragen).
Lässt man all diese kleinen schmälernden Punkte außer Acht, ergibt sich eine interessante Geschichte, die Lust auf mehr macht. Allerdings kann man über die Zitate des Buchumschlags nur lächeln.
Der Autor vergibt: 




Der Lake Hollywood ist das Trinkwasserreservoir für die Großstadt Los Angeles. Die Hügel der Umgebung sind durchzogen von Zu- und Ableitungsrohren, die den Obdachlosen und Fixern der Umgebung einen willkommenen Unterschlupf bieten. Dass von diesen Untermietern immer wieder einer tot gefunden wird, ist ein Ärgernis, an das die Polizei gewöhnt ist. Als an diesem Sonntag anonym eine Leiche am Damm gemeldet wird, hat Hieronymus „Harry“ Bosch Bereitschaftsdienst. Er ist ein Vollblut-Kriminalist und auch nach vielen Polizeijahren nicht in Routine erstarrt. Bosch erkennt den Toten: William Meadows war vor zwanzig Jahren mit ihm Soldat in Vietnam, wo sie Seite an Seite den Vietcong im Gewirr jener Gänge bekämpften, die dieser tief unter der Erdoberfläche anlegte. Der mörderische Kampf in der Finsternis ließ eine verschworene Gemeinschaft entstehen ließ: die „Tunnelratten“.
Meadows gehörte zu den Veteranen, deren Psyche in Vietnam einen Knacks erhielt. Lange Jahre war er rauschgiftsüchtig, doch die Indizien, die auf eine Überdosis hindeuten, wurden manipuliert. Die Ermittlungen ergeben weiter, dass Meadows in einen spektakulären Bankeinbruch verwickelt war, der Los Angeles im Vorjahr in Atem hielt und bei dem die Täter mit einer Riesenbeute unerkannt entkommen waren. Michael Connelly – Schwarzes Echo weiterlesen
Mit diesem vierten Band des sechsbändigen „Lemuria“-Zyklus‘ leistet Leo Lukas seinen Beitrag zu der bisher außerordentlich spannenden und unterhaltsamen Geschichte um Zukunft und Vergangenheit der Menschheit. Das Wiener Multitalent wurde innerhalb der Perry-Rhodan-Fangemeinde schnell zu einem der beliebtesten Autoren, da er mit seiner überschwänglichen Art alte und festgefahrene Strukturen in der Serie öffnete und ihr nach langer Zeit wieder humorvolle Romane bescherte und immer noch beschert. Mit seiner zweiten Leidenschaft, seiner Arbeit als Kabarettist, ist er auch längst kein Unbekannter mehr. Und trotz dieses Hangs zur Verbreitung seines Lachens bringt er immer wieder hochkarätige Romane ein, deren Humor hintergründig ist.
Perry Rhodan trifft mit den beiden Forschungs- und Prospektorraumschiffen vor dem Akon-System ein, dem Heimatsystem der Akonen. Die dritte entdeckte Sternenarche steht unter dem Hoheitsanspruch der Akonen, Rhodan ist der Zutritt ohne diplomatische Schwierigkeiten verwehrt. Über einen geheimen terranischen Stützpunkt dringt er unerkannt in das System ein und erkauft sich eine Transmitterpassage zur Arche. Zeitgleich verschaffen ihm die kaltgestellten Akonen des zweiten Raumschiffs mit erpresserischen Methoden einen semioffiziellen Zugang, so dass es bei Rhodans Entdeckung einige Verwirrung gibt, die er mit gutmütiger Geschicklichkeit zur allgemeinen Zufriedenheit auflöst.
An Bord der Arche findet sich eine relativ fortschrittliche Lemurerzivilisation – kein Wunder, da der „Verkünder“ Levian Paronn Kommandant dieses Schiffes ist. Doch ist er offensichtlich abwesend. Währenddessen wurde eine vierte Arche aufgebracht, deren Bewohner unterentwickelte Klone der unsterblichen Kommandantin sind, immun gegen jene unbekannte Seuche, der schon die anderen Archenbewohner zum Opfer fielen. Dem Anführer der Klongesellschaft gelang mit parapsychischer Kraft die Ermordung der Kommandantin, seither trägt er ihren Zellaktivator.
In Zwischenspielen erhält der Leser Einblicke in Levian Paronns persönliches Tagebuch und erfährt dadurch, dass der „Verkünder“ sich in unmittelbarer Nähe befindet und die ganze Sache geplant hat, dabei seiner Ansicht nach sogar die Freundschaft des „Hüters“ Icho Tolot ausgenutzt hat, um die Menschheit vor der angeblich drohenden Vernichtung zu bewahren – was ja auch schon der Sinn des Archen-Projekts war.
Während also Rhodan die dritte Arche nach Paronn absucht, trifft dieser unerkannt mit anderen Akonen auf der vierten Arche ein und verängstigt den unsterblichen Mutanten derart, dass dieser sein Heil in der Flucht sucht. Dabei bringt er durch seine geistige Macht auch das Tagebuch Paronns an sich, der sich später voller Eifer an der Jagd nach dem Mutanten beteiligt – vorgeblich wegen der von ihm ausgehenden Seuchengefahr für die Akonen. Denn wenn das Buch in Rhodans Hände fallen sollte, geriete sein gesamter Plan in Gefahr, schließlich ließe sich niemand, und schon gar nicht Rhodan, gern manipulieren.
Zu einem vorläufigen Showdown kommt es auf einem nahe gelegenen Planeten, auf dem neben mehreren Tausend echten „Bestien“ auch eine Zeitmaschine steht, durch die Paronn eine ultimate Waffe in die Vergangenheit schaffen und damit ein gigantisches Zeitparadoxon herbeiführen will, um den Exodus der Lemurer vor fünfzig Jahrtausenden zu verhindern. Er offenbart sich Rhodan, doch nicht nur dieser will ihn an der Tat hindern. Auch Tolots Doppelgänger taucht auf und lüftet sein Geheimnis …
»Sehr groß und weit ist das Universum und vorwiegend schrecklich leer, aber auch voll der Wunder.
Ich habe Tage benötigt, um diesen Satz auszuformulieren. […] Sehr groß und weit ist das Universum und vorwiegend schrecklich. Leer, aber auch voll der Wunder…« (Seite 11)
In diesem Beispiel wird Lukas‘ Wortgewandtheit auf Anhieb deutlich. Er spielt mit den Worten, würfelt sie durcheinander. In diesem kurzen Abschnitt skizziert er den Charakter Paronns aus dessen eigener Sicht, nachdem Andreas Brandhorst sich in seinem Roman an die Außenansicht durch den Chronisten gehalten hat, und vertieft diese Studie im Laufe des Romans durch weitere Tagebucheinträge, bringt Paronns Motivation näher, so dass man endlich seine Borniertheit nicht tolerieren, aber verstehen kann, da es ihm um sein quasi ausgestorbenes Volk geht. Er kann sich nach diesen Jahrtausenden nicht mit Terranern, Akonen oder anderen Lemurerabkömmlingen identifizieren und setzt deren Existenz aufs Spiel, ja sogar dem sicheren Untergang liefert er sie aus mit der Planung des gravierenden Paradoxons.
Anfangs erscheint die Einführung der vierten Arche um die zwergenhaften Klone überflüssig in ihrer Ausführlichkeit, scheint nur eine weitere Facette der unterschiedlichen Entwicklungen auf den Generationenschiffen zu sein. Der Ausbruch des infizierten Mutanten in die akonische Gesellschaft schien eigens der Rechtfertigung dieser Geschichte zu dienen, doch im Finale findet auch er seine wirkliche, nachvollziehbare und befriedigende Berechtigung, so dass man Lukas fast keine Wortschinderei vorwerfen kann. Fast.
In zwei Handlungssträngen findet sich rhodantypisches Beiwerk: Starke, ausführliche Beschreibungen von technischen Details wie die seitenlange Erläuterung zu verschiedenen Hyperkristallarten, wo es auch ein schlichtes „notwendig für die Technik“ getan hätte; oder seriengeschichtliche Hintergrundinformationen zu den so genannten Bestien, ihrer Entstehung und schließlichen Vernichtung. Bisher konnten die Autoren des Minizyklus‘ sehr wohl auf diese typischen Ausschmückungen, die in der Heftserie einen wichtigen Teil übernehmen, verzichten, was sich wohltuend auf die Geschichte ausgewirkt hat und meines Erachtens in dieser Zyklusform nur unnötiger Ballast ist, der serienfremde Leser wahrscheinlich mehr verwirrt als erleuchtet.
Man stößt hin und wieder auf „Austriazismen“, die Lukas (wahrscheinlich unbewusst) aus seiner Heimatsprache übernimmt, die aber leider nicht immer selbsterklärend sind. So konnte ich zum Beispiel in einem informativen Internetforum herausfinden, dass „Steht das dafür?“ so viel bedeutet wie „Ist es das wert?“.
Mit Hubert Haensel als Exposéredakteur geht man bei diesem Zyklus tatsächlich neue Wege: Schon nach vier Romanen gibt es die Auflösung einer der großen Fragen, die sich so angesammelt haben. Man schindet nicht mehr Platz und Zeit mit belanglosem Nebengeplänkel, um alle Kracher ganz zum Schluss bringen zu können. Das hält die Spannung durch jeden Band. Jetzt sind nur noch wenige „große“ Fragen offen: Wer Levian Paronn ist, wissen wir noch immer nicht. Also wo er herkommt, wie er an den Zellaktivator kam und was für eine Rolle er in einem größeren Spiel spielt. Immerhin ist jetzt klar, dass ein gewisser Haluter ihn mit den Informationen über die Zukunft versorgt hat.
Insgesamt bietet dieser Roman wieder entspannenden Lesegenuss und bringt mehr Antworten als neue Fragen. Trotzdem ist er entgegen meiner Erwartungen der bisher schwächste Roman des Zyklus, was aber eine relative Aussage bleibt, da die ersten Bände und vor allem der direkte Vorgänger von Brandhorst einfach hervorragend sind.
Der Autor vergibt: 




Potter’s Field ist eine kleine Gemeinde im US-Staat Wyoming. Farmer stellen hier die Mehrheit der Bürgerschaft. Das Leben ist hart und schlicht, die Verbrechensrate niedrig. Das gefällt vor allem dem Polizeichef Nathan Slaughter. Nachdem er, der Star der Detroiter Mordkommission, versehentlich zwei minderjährige Diebe niederschoss, ist sein Nervenkostüm angegriffen. In der Provinz möchte er wieder zu sich finden.
Leider hat er sich keinen idealen Ort für den Neuanfang ausgesucht. Potter’s Field war vor sechs Jahren Zentrum einer bizarren Tragödie. Der Sektenguru Quiller hatte sich mit 200 Hippie-Gläubigen in der ‚unverdorbenen‘ Wildnis ein neues Utopia schaffen wollen. Im strengen Winter von Wyoming hatte der Traum im Desaster geendet; zu Dutzenden waren die Unglücklichen erfroren. Der Journalist Gordon Dunlap hatte damals einen bemerkenswerten Bericht über diese Ereignisse verfasst. Das Grauen hatte ihn niemals losgelassen. Er ist zum Säufer geworden, der wie Slaughter in Potter’s Field sein Leben wieder in den Griff zu bekommen versucht. David Morrell – Totem weiterlesen
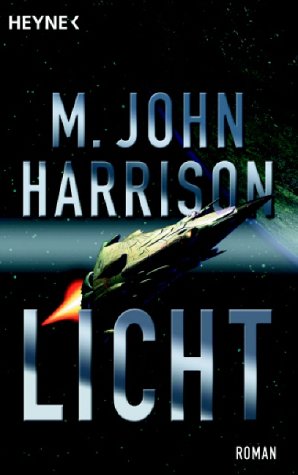
Zu dieser Gruppe bekenne ich mich nach gründlicher Lektüre des Romans, die erst von Langeweile und schließlich von gelegentlichen Frustmomenten geprägt war. Harrison erzählt nicht, sondern spielt, und das in einer penetrant unfesselnden Art und Weise. Und als sich die Handlung endlich fängt (ungefähr ab der Hälfte des 450 Seiten starken Taschenbuches), hat man als Leser die Faxen bereits gründlich dicke.
Ein Geschöpf, programmierbar mit allen denkbaren Befehlen, in der Hand eines größenwahnsinnigen Menschen mit nahezu unbegrenzten finanziellen Mitteln, das Geschöpf entwickelt aus hochflexiblen Zellen, Stammzellen ähnlich, die sich ständig neu differenzieren können – ein Gestaltwandler, Selbstheiler, ein Wesen mit fast unvorstellbaren Möglichkeiten. Aber gefangen in seiner Programmierung und damit seinem Schöpfer untertan.
Dieses Bild zeichnet Andreas Brandhorst in dem zweiten Band seines ambitionierten „Kantaki-Zyklus“. Nur dass die Gefahren, die sich daraus ergeben, noch übertroffen werden durch diese Ausgangssituation: Das Wesen, der „Metamorph“, entkommt aus dem Züchtungslabor – ein moderner „Geist“ nach Goethes „Zauberlehrling“.
Im Rückblick auf „Diamant“, den ersten Kantaki-Roman, lässt sich eine Verlagerung des Schwerpunktes erkennen: Mit „Diamant“ wurde der Boden bereitet, hier stand die Einführung des neuen Kosmos‘ im Vordergrund und wurde mit Hilfe Valdorians Suche auf der einen und Lidias Entwicklung zu Diamant auf der anderen Seite durchgeführt. Im Hintergrund drohte die manipulierende Macht aus der Vergangenheit. Im „Metamorph“ werden die verschiedenen Stränge zusammengeführt und ergeben ein komplexes Bild, in dessen Zentrum der große Konflikt zwischen dem Konziliat (das an den Strängen des Lebens webt) und dem Omnivor (eine realitätfressende Entität, der Widerpart des Konziliats) steht.
Es gibt eine Abstufung der Details: Der Zeitkrieg zwischen den Temporalen und den Kantaki ist von primärer Bedeutung für den Konflikt, denn die Kantaki versuchen über ihren „Sakralen Kodex“ (siehe Rezension zu „Diamant“) die Ära des Verstehens zu verlängern, während die Temporalen diese Ära gewaltsam beenden wollen und damit dem Omnivor in die Hände spielen. Sekundär sind die Handlungen anderer Völker wie der Menschen, derer sich die großen Parteien manchmal als Handlanger bedienen, so geplant mit Valdorian durch die Temporalen.
Im „Metamorph“ werden diese Zusammenhänge deutlicher, denn statt der kurzen Streiflichter, die in „Diamant“ andeuten, dass es um Größeres geht, dringen wir weiter zu den Geschehnissen vor, die sich gerade jetzt kulminieren und neue Veränderungen bringen.
Auf Kerberos, einen abgelegenen Planeten, stürzten vor Jahrmilliarden zwei stark angeschlagene Kontrahenten ab: Der |Keim| eines Ominivors und ein |Ich/Wir| des Konziliats, ein individueller Splitter. Die Konziliantin benutzt während ihres Regenerationsprozesses unbewusst ihre Fähigkeiten, an den Strängen des Lebens zu weben: Auf Kerberos entsteht Leben, wie es anderswo nicht zu finden ist.
421 Seit Neubeginn: Auf Kerberos existiert ein Forschungszentrum der New Human Design, das mit der „Basismasse“ experimentiert, einer Zellform, die nur auf Kerberos gefunden wird. Aus ihr entwickelt man den Prototyp eines Metamorph. Ein Attentat befreit das Wesen, das zum Töten programmiert wurde.
Auf Kerberos existiert eine geheimnisvolle Kraft, die von sensiblen Menschen wahrgenommen und zum Heilen genutzt werden kann. Es bildete sich eine quasireligiöse Gemeinschaft von Heilern, der auch Bruder Eklund angehört. Er trifft auf den Metamorph in Gestalt des Jungen Raimon und findet hier seine „heilige Aufgabe“: Er muss den Jungen beschützen. Eklund weiß lange nichts von Raimons wahrem Wesen, doch erkennt er in ihm eine unglaubliche Präsenz der Kraft, die alles auf Kerberos durchdringt.
Der Metamorph kämpft gegen seine Programmierung an, denn während Valdorian im Dienste der Temporalen nach einem Weg sucht, den Keim zu erwecken und zu nutzen, um das Zeitgefängnis der Temporalen aufzubrechen, versteht sich der Metamorph als Komponente der Konziliantin, deren Kraft es ist, die Kerberos durchdringt. Die Konziliantin wartet seit Äonen auf ihr Wiedererwachen, um den Keim endgültig zu besiegen. Damit würde auch die Gefahr durch die Temporalen ein weiteres Mal gebannt …
In diesem zweiten Band des Zyklus spielt die Transzendenz eine weitaus wichtigere Rolle. Trotzdem entwickelt sich eine spannende Geschichte um einzelne Personen wie Bruder Eklund oder den Jäger Lutor. Valdorians Charakter hat sich unter dem Einfluss der Temporalen entwickelt. Der ehemalige mächtige „Primus inter Pares“ ist kaum noch in ihm zu erkennnen, er wirkt trotz seiner starken Persönlichkeit wie eine Marionette.
Brandhorst gelingt wieder eine fließende Handlung, die selbst von den anfangs vielen unterschiedlichen Ebenen nicht unterbrochen wird und noch an Tempo gewinnt, indem einige Stränge zusammengeführt werden und sich das Hauptaugenmerk auf den Planeten Kerberos richtet. Es zeugt von hoher Kunstfertigkeit, dass der Leser dieses Verwirrspiel gespannt verfolgt und von ihm gefangen wird.
Für das Verständnis der Zusammenhänge wichtig und hilfreich sind auch die Anhänge in Form eines Glossars und einer Chronologie. Gerade letztere kann helfen, den großen Überblick zu behalten.
Wieder muss aber angemerkt werden, dass es einige Wiederholungen gibt, die sich manchmal sogar im Wortlaut gleichen. In dieser Hinsicht könnte das Lektorat noch etwas aufmerksamer arbeiten, denn ansonsten fallen keine technischen Mängel auf.
Durch den großen Einfluss der Transzendenz in diesem Roman ist er nicht jedermanns Sache, doch es ist nur die konsequente Entwicklung der Geschichte, die in „Diamant“ angelegt wurde. Man merkt deutlich, dass Brandhorst großen Wert auf die Stimmigkeit seines Universums legt und dass ihm gerade die Mächte im Hintergrund wichtig sind. Der Titel des nächsten Romans, der im Herbst 2005 erscheinen soll, deutet schon an, in welche Richtung es weitergeht: „Der Zeitkrieg“ …
Insgesamt ist „Der Metamorph“ ein überaus unterhaltsames und fesselndes Buch, das trotz seiner Eigenschaft als Folgeband zu „Diamant“ dessen Kenntnis nicht voraussetzt. Mit Andreas Brandhorst meldet sich ein deutscher Schriftsteller zurück, der auf der literarischen Bühne nicht mehr fehlen darf.
Der Autor vergibt: 




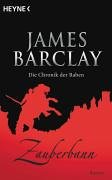
James Barclay – Zauberbann (Die Chroniken des Raben 1) weiterlesen
Faszinierend! Da rätselt man seit Jahren, wie die alten Lemurer als Vorfahren der Menschen an fünfdimensionale Technik gekommen sein können, wo der moderne Terraner anscheinend nicht in der Lage ist, die Hypermathematik wirklich zu verstehen – und dann liefert eine Spin-off-Serie die Antwort.
Andreas Brandhorst, in den letzten Jahren bekannt geworden durch seine Übersetzungen zum Beispiel für Terry Pratchet und „Star Wars“, machte 2004 Schlagzeilen mit seiner großartig angelegten Space-Opera um die „Kantaki“ – auch dort existieren eine fast mythische Vergangenheit und ein Kampf durch die Zeiten. Vielleicht fiel es ihm dadurch leichter, sich in den gigantischen Kontext von Perry Rhodan einzuarbeiten, und es ist ihm hervorragend gelungen. Wir erhalten sozusagen von einem „Rhodan-Neuling“ Einblicke in die spannendste Zeit der irdischen Geschichte, als nämlich die bisher als unerreichbar geltenden Lemurer den Sprung zu den Sternen wagen.
Hauptakteure des Romans sind der lemurische Chronist Deshan Apian und Levian Paronn in der Vergangenheit, ein akonisch-terranischer Einsatztrupp um die Kommandantin der PALENQUE und eine seltsame Gemeinschaftsintelligenz aus Menttia und KI in der Gegenwart. Die letzten Überlebenden der Sternenarche LEMCHA OVIR (Lemuria 2: „Der Schläfer der Zeiten“) wechseln in der Bedrohungssituation mit Hilfe parapsychischer Kräfte in eine andere Existenzform und verschwinden im All.
Apian ist Chronist im Großen Solidar Lemurias und erhält den Auftrag, eine Chronik über Levian Paronn bei seinem Vorhaben, die „Kinder Lemurs zu den Sternen zu führen“, zu erstellen. Er wird zum langjährigen Wegbegleiter des anderen, den ein unergründliches Geheimnis umgibt. Brandhorst gelingt eine ungewöhnlich dichte und tiefe Charakterisierung des Mannes, aus dessen Sicht man den Lauf der Zeit in jenem fernen Lemuria erfährt. Die Lemurer – nach einem Jahrhunderte währenden Überlebenskampf gegen die albtraumhaften Konos, der über die Zeit der Primitivität hinaus, in eine Art Mittelalter und länger, dauerte – stehen unter einem kollektiven Trauma. Es entwickelte sich ein perfektes Solidarsystem, in dem alle an einem Strang ziehen, um das Überleben der eigenen Art zu sichern. Bis zum Auftreten der Sternensucher, als deren Anführer Paronn sich entpuppt. Er kennt die Zukunft, weiß um die Gefahr, die die Lemurer in Form der „Bestien“ heimsuchen wird, und setzt alles daran, mit den Sternenarchen die Saat Lemurs im All zu streuen. Letztlich verlassen 46 Archen das Heimatsystem. Apian erhält wie die Kommandanten der Schiffe einen Zellaktivator, der ihnen die relative Unsterblichkeit schenkt.
Paronn selbst offenbart seine eigene Unsterblichkeit spät. Mit seinen geistigen Zwiegesprächen streut Brandhorst neue Rätsel, aber auch Ansatzpunkte für deren Lösung, die den Leser verblüffen. So schickt er mit jeder fertig gestellten Arche den bis dahin fertigen Teil der Chronik zu den Sternen, um sie einer Person in der Zukunft zugänglich zu machen. Außerdem denkt er an seinen „vierarmigen Freund“, in dem wir schnell einen Haluter vermuten. Im Rückblick auf den zweiten Roman der Serie fragen wir uns, ob es sich um jenen Icho Tolot handeln könnte, dem Rhodan in der akonischen Station auf Mentack Nutai begegnet …
In der Gegenwart findet Rhodan einen Datenchip an Bord des gelandeten Kommandomoduls der LEMCHA OVIR. Bei der Entschlüsslung spricht der Chip auf ihn an und versenkt ihn ins Koma, wo er Apians Chronik erfährt. Offenbar ist Rhodan die Person, auf die Paronn die Chronikchips sensibilisiert hat. Ein neues Rätsel.
Tolot erscheint auf Rhodans Ruf im System und gerät mit seinem Schiff in die Transmitterfalle einer alten akonischen Station, die sich zwischen den Asteroiden eines Gürtels um die Sonne befindet. Dorthin verschlägt es auch den Einsatztrupp der beiden menschlichen Schiffe, die hier um ihr Überleben kämpfen und auf ein neues Rätsel stoßen. Ein fremder Haluter wird aus einem Stasisfeld befreit. Er hat eine wichtige Nachricht für Tolot, den er um das Jahr 2400 n. Chr., kurz nach dessen Kontaktaufnahme mit den Terranern, zu suchen begann. Vor seinem Tod flüstert er Tolot die Koordinaten eines offenbar wichtigen Orts zu.
Schade, dass sich die hervorragend angelegten Charaktere von Jorgaldarhelmemerek und Alahandra wohl verabschiedet haben. Der „Maschinenflüsterer“ war ein interessanter Begleiter und könnte mit seinen Fähigkeiten zu einer Lebensform ähnlich dem „Specter“ der Hauptserie werden. Was aus dieser neuen Wesenheit wird, steht buchstäblich in den Sternen.
Die Gestalt des Prospektors Roderich bedarf noch einer eingehenderen Betrachtung, wenn die von Brandhorst eingestreuten Details zu ihm Serienrelevanz bekommen sollen. Sonst könnte er wirken wie ein künstlich interessant gemachter Charakter.
Wohin die Reise geht, lässt sich erahnen. Nächstes Ziel jedenfalls ist Akon, wo die letzte Sternenarche ACHATI UMA entdeckt wurde – jenes Schiff, mit dem Levian Paronn in die Zukunft aufbrach. Um ihn wird es im nächsten Band von Leo Lukas gehen, „Der erste Unsterbliche“. Eine Frage bezüglich der Unsterblichen hat Brandhorst schon in diesem Band beantwortet: Die Frage nach den augenscheinlichen Defekten zumindest einiger Aktivatoren. Levian Paronn baute sie in der Vergangenheit nach dem Vorbild seines eigenen, doch fehlten ihm schließlich die Materialien, so dass er improvisieren musste. Neue Frage: Woher hat Paronn seinen Aktivator und wieso kann er ihn überhaupt nachbauen, während Generationen von terranischen Wissenschaftlern an den Geräten von Rhodan und Co. verzweifelten?
Einen letzten Zweifel streut Brandhorst auf den letzten Seiten: Geht es Paronn wirklich um die „Bestien“, die das lemurische Reich in einem fast hundertjährigen Krieg vernichteten, ehe sie befriedet und zu „Halutern“ wurden, wenn er vom „Feind“ spricht? Dieser Feind existiert nicht mehr, und doch verheimlicht eine fremde Präsenz ihre Anwesenheit …
„Exodus der Generationen“ ist ein vielschichtiger Roman, mit dem Andreas Brandhorst seine Klasse beweist und gleichzeitig auf sich und sein Kantaki-Universum aufmerksam macht. Abgesehen von winzigen Widersprüchen zur Serientechnik zeigt er seine Professionalität in der Schriftstellerei in der Art, wie er sich in das komplexe Rhodan-Umfeld hat einarbeiten können. Erfrischend sind seine Darstellungen von Gefahren und technischen Details, die bei einigen der Stammautoren routiniert abgehandelt werden. Um das schon an sich spannende und faszinierende Thema des Romans herum entwickelt er eine Geschichte mit erzählerischer Dichte und Fließkraft. Die vier verschiedenen Erzählebenen machen nicht den Eindruck, als müsse man den Stoff unbedingt unterbringen und wisse nicht, wie das möglich wäre, sondern werfen hier und da ein Schlaglicht auf die Gedanken und Gefühle der Protagonisten und schaffen damit eine schlüssige Atmosphäre.
Mit jedem Roman gefallen mir der rätselhafte Aufbau und die Geschichte der Serie und vor allem die Erzählkunst in den einzelnen Romanen besser. Ich bin guter Hoffnung, dass sich dieses Niveau durch die Serie fortsetzt und denke, dass „Lemuria“ der beste Spin-off-Zyklus und damit ein Meilenstein in der Rhodan-Historie wird.
Der Autor vergibt: 




Bonnie Winter ist kaum über 30 und schon am Ende. In zwei Jobs gleichzeitig muss sie schuften, wobei sie mit einem in eine echte Marktlücke gestoßen ist: Bonnie reinigt Häuser, in denen sich Morde und Selbstmorde ereignet haben. Sie entfernt Blut- und Hirnflecken, Maden, Schmeißfliegen und andere unerfreuliche Zeichen zu lange übersehener Leichen.
Was sie täglich sehen muss, lässt sie trotz des professionell zur Schau gestellten Desinteresses keineswegs unberührt. Privat kann sie keine Hilfe erwarten. Duke, ihr Gatte, ist ein notorisch arbeitsloser, biersaufender Jammerlappen und Rassist, der die Schuld für das eigene Versagen diversen ethnischen Minderheiten zuschiebt. Ray, der einzige Sohn des Paars, entwickelt sich zum getreuen Ebenbild seines Vaters. Graham Masterton – Das Insekt weiterlesen
Die guten Vorsätze und die Anfänge von Vertrauen, die sich durch Alemaheyus Luftgitarre anbahnten, scheinen durch das alte Misstrauen verdrängt worden zu sein. Die PALENQUE und die LAS-TOOR umkreisen manövrierunfähig den Planeten „Mentack Nutai“, auf dem erst kürzlich die Überlebenden der zweiten Sternenarche bruchlandeten. Eine noch unbekannte Macht entzieht den Schiffen jegliche Energie bis auf die Lebenserhaltung, merkwürdigerweise sind die Beiboote nur bedingt betroffen.
Perry Rhodan und einige Prospektoren und Akonen fliegen den Planeten an, um Kontakt mit den Gestrandeten aufzunehmen und möglichst mehr Informationen über die Sternenarchen und die damit verbundenen Rätsel zu finden. Sie stoßen meist auf hilflose Lemurer, die Zeit ihres Lebens nur an Bord eines Raumschiffs lebten und mit der Weite des Planeten sowie den überlebenswichtigen Aufgaben überfordert sind.
Der Kommandant der Arche, der „Sternensucher“ Atubur Nutai, notlandete mit seiner Kommandofähre abseits der Rettungsfähren. Hier erliegt er seinen Verletzungen, gepflegt von seiner Begleiterin Nydele. Sein Zellaktivator verhindert nicht seinen Tod.
Eine Energiesignatur lockt Rhodan und sein Team in den Norden, in die Eiszone, wo er erstmals auf intelligente Bewohner des Planeten trifft: Energiewesen, die für die Probleme der Mutterschiffe verantwortlich sind. In primitiven Kontaktversuchen erfahren die Menschen, dass die „Menttia“, die Energiewesen, bereits schlechte Erfahrungen mit ihresgleichen hatten und sich nur absichern wollen. Es bahnt sich gegenseitiges Verständnis an, als Rhodan auf eine uralte Station der Akonen stößt, die anscheinend einen Konflikt mit den Menttia austrugen. Dort treffen sie auf ein zerstörerisches Wesen, in dem Denetree den „Hüter“ der Sternenarchen und Rhodan seinen Freund Icho Tolot, den Haluter, erkennt …
Hans Kneifel schreibt seit Jahrzehnten für die Perry-Rhodan-Serie, mittlerweile nur noch sporadisch wegen seines doch recht hohen Alters. Der Fan freut sich über seine gelegentlichen Gastspiele. Kneifel schrieb den Großteil der Atlan-Zeitabenteuer und ist damit einer der „Väter“ dieser Figur, die sich unter den Lesern seit ihrem ersten Auftritt größter Beliebtheit erfreut. Zwischenzeitlich gab es eine eigene Serie um den Arkoniden Atlan, die neuerdings einen neuen Versuch wagt.
Im vorliegenden zweiten Band des sechsbändigen Taschenbuchzyklus „Perry Rhodan – Lemuria“ fügt Kneifel neue Fragen dem großen Rätsel hinzu, das sich um die Sternenarchen rankt. Antworten werden noch keine gegeben, aber das Flair des Kosmischen verstärkt sich noch und bildet die fesselnde Atmosphäre des Romans. Mit den Menttia führt Kneifel ein neues faszinierendes Volk ein, das sich an einen uralten Konflikt mit den Akonen erinnert. Die Akonen wiederum wissen nichts mehr davon, die Lemurer und Terraner schon gar nicht. Dank Rhodans zeichnerischer Künste lässt Kneifel so etwas wie ein Friedensabkommen zustande kommen. Von den wenigen hundert Schiffbrüchigen fühlen sich die Menttia nicht bedroht, und Rhodan kann klar machen, dass von den anderen Gruppen keine Aggressionen zu befürchten sind.
Leider scheint keinem der Handelnden, und damit Kneifel ebenfalls nicht, aufgefallen zu sein, dass der Kommandant der zweiten Arche als Sternensucher bezeichnet wird, während auf der ersten Arche die Sternensucher verfolgt und vernichtet wurden. Das wird natürlich seinen Grund haben, den wir jetzt noch nicht kennen. Trotzdem hätte das gerade Denetree auffallen müssen, da ihr Bruder doch als Sternensucher den Tod gefunden hat.
Die Zellaktivatoren der Kommandanten werden ein größeres Rätsel. In beiden Archen wird einer getragen, doch beide scheinen defekt zu sein: Der erste Kommandant altert trotz Aktivator, nur langsamer, und seine Beweglichkeit wird stark eingeschränkt, der zweite Kommandant, Atubur Nutai, unterzog sich einer regelmäßigen, unbekannten „Verjüngungskur“, in deren Verlauf er immer einen Teil seiner Erinnerungen verlor. Das ist eins der Rätsel, die es zu lösen gilt: Woher kommen die Aktivatoren, warum sind sie fehlerhaft?
Zu Beginn des Romans erfährt man von einem fremden schwarzen Kugelraumschiff, das sich in der Arche befindet. Durch die Darstellungen des „Hüters“ angeregt denkt der kundige Leser sofort an ein Haluterschiff – befindet sich einer an Bord dieser zweiten Arche? Bekanntlich erleidet die Arche Schiffbruch, und man erfährt, dass das schwarze Schiff bei der akonischen Station strandet. In dieser Station werden die Menschen um Rhodan fast von einem aggressiven Ungeheuer überrannt, das die Station zerstört. Rhodan erkennt seinen alten Freund Tolot. Neue Frage: Wie kann Tolot seit fünfzigtausend Jahren an Bord der Arche sein, wenn er aktuell mit Rhodan befreundet ist? Wir ahnen, dass es nicht Tolot sein kann, denn Kneifel lässt Rhodan zum Ende noch ein Funkgespräch mit ihm führen.
Die Miniserie macht einen faszinierenden Eindruck, anders als die Vorgängerserien zieht sie ihr Potenzial nicht aus Action, sondern aus der geheimnisvollen kosmischen Atmosphäre. Trotzdem handelt es sich um Fragen, die einem Serienneuling eventuell nicht viel bedeuten, da sie erst im Serienkontext ihre wahre Größe enthüllen. Unterhaltsam sind die Romane bisher allemal, ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis wird man schwerlich auf dem Buchmarkt finden. Insgesamt kann Kneifel nicht ganz an die Güte seines Vorgängers anschließen, trotzdem steigt die Spannung und macht Lust auf mehr. Im nächsten Band zeigt Andreas Brandhorst, wie er sich im Rhodan-Kosmos zurechtfindet. Man darf wirklich gespannt sein!
Der Autor vergibt: 






Bereits vor dem Erscheinen des ersten Bandes, „Schwarz“ (1982), spukten die Gedanken zu der Gestalt des Roland von Gilead und die Grundlage zu seinem späteren Turmzyklus in Kings Kopf. Das 1855 von Roland Browning geschriebene Gedicht „Childe Roland to the Dark Tower came“ – man findet es auf Kings Dark-Tower-Homepage ]http://www.stephenking.com/DarkTower/ – setzte dabei einen kreativen Prozess in Gang, der sich nach und nach verselbstständigte, King wob immer mehr Bezüge zu seinen Romanen und der realen Welt in die Geschichte um den dunklen Turm ein.
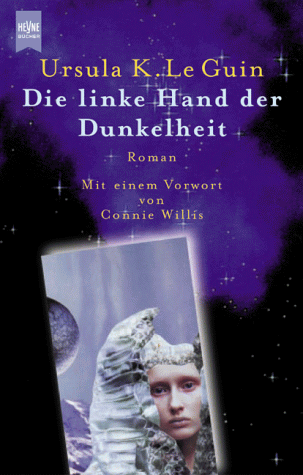
Genly Ai soll die Bewohner für einen Beitritt zur Ökumene gewinnen, doch seine Mission ist nicht leicht, denn Gethen unterscheidet sich sehr von Terra, der Heimat Genlys.
Ursula K. Le Guin – Die linke Hand der Dunkelheit weiterlesen
