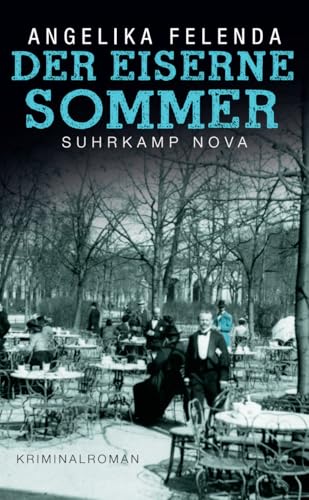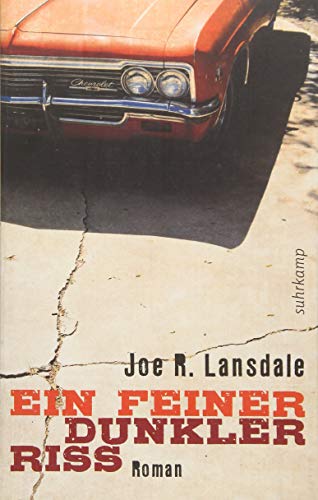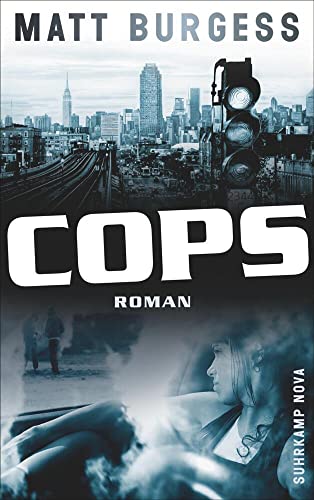
Matt Burgess – Cops weiterlesen
Schlagwort-Archiv: Suhrkamp
Maurice Leblanc – Die Gräfin von Cagliostro oder: Die Jugend des Arsène Lupin

Maurice Leblanc – Die Gräfin von Cagliostro oder: Die Jugend des Arsène Lupin weiterlesen
William Hope Hodgson – Geisterpiraten und andere schauerliche Seegeschichten

Inhalt:
– Geisterpiraten (The Ghost Pirates, 1909): Das Schicksal hat den Seemann Jessop hart gebeutelt. Notgedrungen heute er auf der „Mortzestus“ an. Die letzte Mannschaft ergriff komplett die Flucht, nachdem das Schiff in den Hafen von San Francisco eingelaufen war, denn es soll umgehen auf dem alten Segler, der auffällig oft von Gegenwinden, Flauten und Stürmen geplagt wird.
William Hope Hodgson – Geisterpiraten und andere schauerliche Seegeschichten weiterlesen
John Wyndham – Kuckuckskinder
Under the Dome: Die Alien-Invasion im Hinterland
Als eines Tages im beschaulichen Dorf Midwich ein silbernes UFO landet, fallen alle Bewohner im Umkreis von zwei Meilen in Schlaf, um erst nach anderthalb Tagen zu erwachen. Neun Monate später bringen die Frauen des Dorfes 61 Kinder zur Welt, die alle goldene Augen aufweisen. Sie wurden als Wirtsmütter missbraucht, doch von wem und wofür? Der Schriftsteller Gordon Zellaby hat eine Theorie zu diesen Kuckuckskindern, die seine Nachbarn einfach nicht wahrhaben wollen…
Das Buch wurde bisher zweimal verfilmt, beide unter dem Titel „Das Dorf der Verdammten“: einmal im Jahr 1960 (mit George Sanders als Gordon Zellaby) und das zweite Mal im Jahr 1995 (mit „Superman“-Star Christopher Reeve als Dr. Alan Chaffee).
Der Autor
Algernon Blackwood – Das leere Haus. Phantastische Geschichten
Mit einer Novelle, zwei längeren Erzählungen und einer Kurzgeschichte zeigt sich Algernon Blackwood (1869-1951) als Großmeister einer Phantastik, die über simplen Horror weit hinausgreift und sich ein Weltbild zeichnet, in dem eine belebte, manchmal ‚nur‘ fremde, manchmal bösartige Natur eine von den Menschen fast vergessene aber weiterhin zentrale Stellung einnimmt:
– Das leere Haus (The Empty House, 1906), S. 7-30: Mit ihrem Neffen besucht eine eher neugierige als wagemutige Amateur-Spiritistin ein verrufenes Spukhaus. Die beiden erfahren nicht nur über die Welt der Geister, sondern auch über sich und ihre Ängste mehr, als ihnen lieb ist. Algernon Blackwood – Das leere Haus. Phantastische Geschichten weiterlesen
Anthony Horowitz – Der Fall Moriarty
Im Mai des Jahres 1891 werden sowohl die Kriminalisten als auch die Kriminellen dieser Welt von der Nachricht erschüttert (bzw. erfreut), dass Sherlock Holmes, der geniale Privatermittler, im Kampf gegen seinen Erzfeind Professor James Moriarty an den Reichenbachfällen in der Schweiz den Tod fand. Auch Moriarty starb, was für Pinkerton-Detektiv Frederick Chase einen herben Rückschlag bedeutet, hatte er doch gehofft, über den Professor einem ähnlich üblen Verbrecher auf die Spur zu kommen: Clarence Devereux plant, sein kriminelles Imperium über die USA hinaus nach England zu erweitern. Er wollte einen Pakt mit Moriarty schließen und sich deshalb mit diesem Treffen, doch Zeitpunkt und Ort dieser Zusammenkunft sind unbekannt.
Chase hofft, an der inzwischen gefundenen Leiche Moriartys eine entsprechende Nachricht zu finden. Dem ist tatsächlich so, aber sie ist kodiert. Glücklicherweise kann sein neuer Verbündeter helfen: Inspektor Athelney Jones von Scotland Yard ist ein glühender Verehrer des verstorbenen Sherlock Holmes und hat sich dessen Methoden zu Eigen gemacht. Jones entschlüsselt die Botschaft, doch in London haben sich die neuen Herren der Unterwelt bereits gut etabliert. Da Moriarty tot ist, will Devereux dessen Organisation übernehmen. Er und seine Schergen scheuen dabei vor keiner Brutalität zurück. Anthony Horowitz – Der Fall Moriarty weiterlesen
Isabel Allende – Amandas Suche

[NEWS] Angelika Felenda – Der eiserne Sommer: Reitmeyers erster Fall
Juni 1914: Zwei Schüsse fallen in Sarajewo, und die Welt rückt an den Abgrund. Franz Ferdinand, der Thronfolger Österreich-Ungarns, ist tot. Zur gleichen Zeit steht Kommissär Reitmeyer in München vor einer schwierigen Entscheidung. Er hat es satt, die Marionette des Polizeipräsidenten zu sein. Die Leiche eines jungen Mannes führt ihn von den Arbeitervierteln bis in die Villen der Großbürger. Und in das berüchtigte Café Neptun, Vergnügungsort der Offiziere. Der Polizeipräsident drängt ihn, nicht noch tiefer zu schürfen, und gegen das Militär darf er per Gesetz nicht ermitteln. Da macht Reitmeyer eine ungeheuerliche Entdeckung, die nicht nur ihn selbst zum Abschuss freigibt, sondern die das ganze Land in den Untergang stürzen könnte. (Verlagsinfo)
Taschenbuch: 435 Seiten
Suhrkamp
J. G. Ballard – Der Garten der Zeit. Die besten Erzählungen
Vom Totenkutscher und der Marswüste in Florida
Diese Auswahl versammelt 14 Erzählungen des britischen Erzählers J.G. Ballard. So manche bekannte Story ist darunter, aber auch weniger gute, bei denen sich der Kenner fragt, was sie hier zu suchen haben. Texte aus der „Atrocity Exhibition“ sucht man hier vergeblich, und das lässt sowohl auf Selbstzensur wie auch Berücksichtigung des Massengeschmacks schließen.
„Ich glaube an den Tod von morgen, an die Erschöpfung der Zeit, an unsere Suche nach einer Zeit, die im Lächeln der Kellnerinnen in Autobahnraststätten liegt, in den müden Augen der Fluglotsen aus verlassenen Flughäfen. „Ich glaube an das Nichtvorhandensein der Vergangenheit, den Tod der Zukunft und die unerschöpflichen Möglichkeiten der Gegenwart.“ (Klappentext)
J. G. Ballard – Der Garten der Zeit. Die besten Erzählungen weiterlesen
Arthur Machen – Die leuchtende Pyramide und andere Geschichten des Schreckens
In den schattigen Winkeln der Realität überleben uralten Kreaturen, die denen auflauern, die sich neugierig aber unvorsichtig in ihre Refugien wagen. Die Folgen weiß Arthur Machen in vier Erzählungen und einem Kurzroman meisterhaft und erschreckend zu erläutern:
– Die leuchtende Pyramide (The Shining Pyramid, 1895), S. 7-37: Seltsame Symbole auf einer Mauer verstören einen britischen Landadligen. Gemeinsam mit seinem Freund, einem Schriftsteller, kann er den Code knacken – es ist eine Einladung zum Hexensabbat, der heimlich Folge zu leisten die beiden Hobby-Detektive dummerweise nicht widerstehen können.
– Die Geschichte vom weißen Pulver (The Novel of the White Powder, 1895), S. 39-60: Der Student ist überarbeitet und lässt sich ein Stärkungsmittel verschreiben. Eine Kette unglücklicher Zufälle führt dazu, dass sich das Medikament in ein wahres Teufelsgebräu verwandelt, dessen Einnahme das Opfer in den Urschleim allen Lebens zurücksinken lässt. Arthur Machen – Die leuchtende Pyramide und andere Geschichten des Schreckens weiterlesen
Gilbert Keith Chesterton – Father Browns Einfalt
Die erste Sammlung der berühmten Father-Brown-Geschichten:
– Das blaue Kreuz (The Blue Cross): Hercule Flambeau, König der Diebe, mischt sich in London unter die Teilnehmer eines Kirchenkongresses; Valentin, Chef der Pariser Polizei, ist ihm hart auf den Fersen, um eine wertvolle Reliquie zu retten, deren Hüter, ein kleiner Geistlicher namens Brown, freilich sehr gut selbst auf sich und seinen Schatz aufpassen kann.
– Der verborgene Garten (The Secret Garden): Ausgerechnet im Garten des berühmten Polizeichefs Valentin verliert ein amerikanischer Nabob seinen Kopf; er wird nicht der einzige bleiben.
– Die sonderbaren Schritte (The Queer Feet): Meisterdieb Flambeau sucht sich für seinen neuen Fischzug einen sehr elitären englischen Club aus, in dessen Mauern sich auch Father Brown aufhält. Gilbert Keith Chesterton – Father Browns Einfalt weiterlesen
Joe R. Lansdale – Ein feiner dunkler Riss
13 Jahre ist Stanley jung, als die Familie Mitchel – Vater Stanley, Mutter Gal und Schwester Caldonia, frühreife 16 – in die kleine Stadt Dewmont im US-Staat Texas ziehen. Dort übernimmt der Senior das örtliche Autokino; ein Geschäft, das gut läuft, denn wir schreiben das Jahr 1958.
Allmählich lebt die Familie sich ein. Beim neugierigen Streifzug durch die Wälder der Umgebung stoßen Stanley Junior und Caldonia auf die Ruinen eines Hauses. Hier ging vierzehn Jahre zuvor die Villa der Stilwinds, der ersten Familie des Ortes, in Flammen auf; dabei starb die Tochter Juwel Ellen. Die Tragödie blieb der Bevölkerung auch deshalb im Gedächtnis, weil man in derselben Nacht die junge Margret Wood vergewaltigt und kopflos auf dem Bahngleis fand; der Täter wurde niemals ermittelt. Seitdem spuke Margrets Geist an der Mordstätte umher, heißt es. Joe R. Lansdale – Ein feiner dunkler Riss weiterlesen
Unsere Weihnachtsempfehlungen – Krimis und Thriller
Weihnachten ist nur noch eine Woche entfernt. Wer noch nicht alle Geschenke beisammen hat, findet im letzten Teil unserer Empfehlungen eine große Anzahl von KRIMIS und THRILLERN, die unsere Redakteure dieses Jahr nicht aus der Hand legen konnten.
Lee Child: 61 Stunden, Blanvalet, 2013
„Reacher, reisender Streiter für die Gerechtigkeit, strandet in einer US-Kleinstadt, die von Eis und Schnee isoliert, von rebellischen Bikern belagert und von einem Killer bedroht wird, während ein Drogen-Warlord mit seiner Privatarmee anrückt. – Auch in seinem 14. Abenteuer steht Reacher weitgehend allein gegen offen brutale und getarnte Schurken, die er trotz Überzahl einfallsreich das Fürchten lehrt: spannend und schnell und ungeachtet bekannter Handlungsmuster ausgezeichnete Unterhaltungslektüre.“ (Michael Drewniok)
Bei Amazon kaufen
Harald Gilbers: Germania, Knaur, 2013
„Im Sommer des Jahres 1944 sucht ein Serienkiller Berlin heim. Der zuständige SS-Ermittler zwingt den jüdischen Ex-Kommissar Oppenheimer zur Mitarbeit. Dieser bringt Schwung in die Fahndung, während er gleichzeitig seinen ‚Kollegen‘ im Auge behält, der ihn nach erfolgreicher Jagd ins KZ abschieben müsste. – Hervorragend recherchiert, sauber geplottet, flüssig und ohne erhobenen Zeigefinger geschrieben: ein spannender Roman, der sich vor fremdsprachigen Historien-Thrillern keineswegs verstecken muss.“ (Michael Drewniok)
Unsere Rezension | Bei Amazon kaufen
Michael Hardwick: Dr. Watson, Blitz, 2013
„Eine Menge Unwahrheiten und Verdrehungen sind über Dr. John Hamish Watson und Sherlock Holmes im Umlauf – findet Dr. Watson. Deshalb sieht er sich bemüßigt, endlich mal klar Schiff zu machen und die Wahrheit zu erzählen. Die ist mitunter unangenehm. Der Autor hat es verstanden, die zentralen Motive, die für Watsons Leben bestimmend sind, in Spannungsbögen umzumünzen, die er einen nach dem anderen zu Ende führt. Das sorgt nicht nur für Unterhaltung, sondern auch für Spannung und Zusammenhalt der Erzählung. Der ganze Text wird auf diese Weise kompakt und stabil. Ich fand das Buch sehr unterhaltsam, amüsant, aber auch anrührend.“
(Michael Matzer)
Unsere Rezension | Bei Amazon kaufen
Anthony Horowitz: Das Geheimnis des weißen Bandes, Suhrkamp, 2013
„Im Winter des Jahres 1890 legt sich Sherlock Holmes mit einer Verschwörer-Gruppe an, die sogar die britische Regierung infiltriert hat, weshalb sich der geniale Ermittler plötzlich als Mörder hinter Gitter wiederfindet. – Dieser Historienkrimi ahmt die Doyle-Vorgaben nicht einfach nach, sondern erweitert und modernisiert das klassische Holmes-Universum behutsam und schlüssig um einige Aspekte, die ihm sehr gut bekommen: eines der besseren Holmes-Pastiches.“ (Michael Drewniok)
Unsere Rezension | Bei Amazon kaufen
Dan Simmons: Kalt wie Stahl, Festa, 2013
„Ex-Detektiv Joe Kurtz gerät in die Feuerzone eines Drei-Fronten-Krieges, den sich zwei verfeindete Mafia-Clans und ein zum Schurken mutierter Kriegsveteran liefern; mörderisch mit im Spiel sind außerdem gleich mehrere verrückte, aber ehrgeizige Killer sowie hartnäckige Polizeibeamte. – Im dritten und letzten Kurtz-Roman lässt Autor Simmons es nicht nur kräftig krachen, sondern ordnet Mord und Action einem erstaunlich kohärenten Plot unter: Schade um das Ende dieser Reihe!“ (Michael Drewniok)
Unsere Rezension | Bei Amazon kaufen
Michael Slade: Der Ghoul, Festa, 2012
„In London scheinen gleich mehrere Serienkiller an einem grotesken Wettbewerb um das scheußlichste Verbrechen teilzunehmen; die Spur führt u. a. in die USA, wo einst der Horror-Autor H. P. Lovecraft einen Albtraum in die Welt setzte. – Der zweite Fall des „Special-X“-Teams mischt gut recherchiert Krimi-Realität mit (scheinbarer) Phantastik; der Plot ist irrwitzig, wird aber in einem spektakulären Finale logisch aufgelöst: ein Thriller der härteren, aber lesenswerten Art.“ (Michael Drewniok)
Unsere Rezension | Bei Amazon kaufen
Nichts für euch oder eure Lieben dabei? Stöbert doch auch in unseren anderen Genres! Einen Überblick über alle Empfehlungen findet ihr hier!
Bram Stoker – Im Haus des Grafen Dracula
In neun Erzählungen und einem Kurzroman beweist Bram Stoker, dass er mehr ist als der Schöpfer des Vampir-Fürsten Dracula:
– Die Squaw (The Squaw, 1893): Ein dummer Scherz endet böse und lässt eine Katzenmutter zur rächenden Schicksalsgöttin mutieren.
– Das Festmahl der Ratten (The Burial of the Rats, 1896): Im Paris des Jahres 1850 gerät der unvorsichtige Tourist unter Räuber und Mörder, die ihn durch eine bizarre Unterwelt aus Müll und Schmutz jagen. Bram Stoker – Im Haus des Grafen Dracula weiterlesen
Allende, Isabel – Mayas Tagebuch
Isabel Allende hat erst kürzlich ihren 70. Geburtstag gefeiert. Seit der Veröffentlichung ihres ersten Romans, „Das Geisterhaus“, sind also bereits dreißig Jahre vergangen, in denen sie mit steter Regelmäßigkeit die Öffentlichkeit mit Geschichten versorgt hat. Und trotzdem gehen ihr die Romanideen nicht aus. Mit ihrem neuesten Werk, „Mayas Tagebuch“, möchte sie nun beweisen, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehört.
Dabei bietet sie viel Bekanntes, denn ihre Romane verlangen nach ganz bestimmten Zutaten, um das gewisse magische Allende-Feeling zu versprühen, das ihre Fans so schätzen: ein wenig magischer Realismus, starke Frauenfiguren, schwere Schicksalsschläge, schräge Familien, eine Prise jüngere Geschichte (chilenische, zumeist) und einen guten Schuss Gefühl. Mit diesem Rezept ist sie bisher immer gut gefahren und auch bei „Mayas Tagebuch“ führt dessen Anwendung zu einem lesenswerten und kurzweiligen Ergebnis. Doch das gewisse Etwas, das in keinem Rezeptbuch steht und das sich auf geheimnisvolle Weise aus dem Zusammenspiel der einzelnen Komponenten ergibt, kommt diesmal bei der Lektüre nicht auf.
_Die Titelheldin ist_ gute fünfzig Jahre jünger als die Autorin: Maya ist neunzehn, hat aber in ihrem kurzen Leben schon einiges hinter sich. Sie wächst behütet und glücklich bei ihren Großeltern in Berkeley auf. Diese Großeltern – die chilenische Exilantin Nidia und ihr zweiter Mann Paul – sind typische Allende-Figuren. Sie sind ungewöhnlich und unangepasst, aber dem Leser sofort sympathisch. Beim Lesen sehnt man sich zwangsläufig danach, Bekannte wie Nidia und Paul zu haben: loyal, hilfsbereit, abgedreht und immer mit einer guten Flasche Wein im Haus. Nidia glaubt an Horoskope und sieht die Aura ihres Gegenübers, während Paul per Teleskop in die Sterne guckt und immer Hut trägt. Ihre Erziehungsmethoden sind gewagt, pädagogische Lücken machen sie jedoch durch eine große Portion Liebe und Zuwendung wieder wett. Aus Maya könnte also eine glückliche junge Frau werden, würde Paul nicht an Krebs sterben, als sie gerade in die sowieso schwierigen Teenagerjahre kommt. Dieser Tod wirft beide Frauen aus der Bahn. Doch während Nidia ihrer Trauer Raum gibt und es so schafft, sie schließlich zu überwinden, bleibt Maya in ihrer emotionalen Lähmung gefangen und landet schlussendlich auf der schiefen Bahn. In der Schule gerät sie an die falschen Freundinnen, verdingt sich als Kleinkriminelle und macht erste Drogenerfahrungen. Als sie schließlich in einer schicken Privatklinik für suchtkranke Jugendliche landet, sucht sie das Weite und rutscht – für ihre Großmutter unauffindbar – unrettbar ins Drogenmilieu von Las Vegas ab, wo sie für den Dealer Brandon Leeman Kunden mit harten Drogen beliefert. Da Leeman jedoch noch in ganz anderen illegalen Geschäften die Finger drin hat, wird sie bald von der Polizei und dem FBI gesucht und als sie endlich wieder bei Nidia eintrifft, verschifft diese sie sofort auf ein winziges chilenisches Eiland zu einem alten Bekannten. Dort soll sie sich vor den amerikanischen Gesetzeshütern verstecken und ihre Wunden lecken.
Mayas Zeit auf Chiloé bildet die zweite Erzählebene des Romans und hier läuft Allende wahrlich zu Hochform auf. Mayas Drogenerfahrungen wirken immer eher plakativ als realistisch, eben nur wie eine Zutat zu einem Roman. Doch in die Welt von Chiloé tauchen Allende, Maya und schlussendlich der Leser gemeinsam ein. Die Insel ist nicht unbedingt rückständig – regelmäßig schauen Touristengruppen vorbei, es gibt Strom (meistens), Internet und einmal in der Woche Filmvorführungen im Schulhaus. Doch das Leben fließt merklich langsamer und so wird Maya auf sich selbst zurückgeworfen. Die Zeit tröpfelt träger dahin und man kann ganze Nachmittage nur damit zubringen, aufs Meer zu schauen, ein Buch zu lesen oder mit Nachbarn zusammenzusitzen. Maya findet Freunde auf Chiloé, fühlt sich den Menschen und dem Leben dort mehr und mehr verbunden und kann sich bald kaum noch vorstellen, ins schnelle und laute Berkeley zurückzukehren. Man beneidet Maya zwangsläufig um diese erzwungene Auszeit und bald erkennt auch sie selbst, welch ein Geschenk diese Insel ist.
Auf dieser Erzählebene kann Allende alle ihre Stärken ausspielen und hier wirkt sie am überzeugendsten. Leider schafft sie es nicht, beide Erzählstränge elegant zusammenzuführen. Maya erzählt beides – ihre Lebensgeschichte und ihre Zeit auf Chiloé – in Tagebuchform, doch schon diese Erzählsituation wirkt artifiziell und kaum plausibel. Mit fortschreitender Lektüre hat man mehr und mehr den Eindruck, die drogensüchtige Maya und die in sich ruhende Maya auf Chiloé seien zwei völlig verschiedene Figuren, so wenig haben beide gemein. Obwohl kaum Zeit vergangen ist, kämpft die neue Maya kaum mit ihrer Vergangenheit und schon gar nicht mit ihrer Drogensucht. Ihr Entzug war offensichtlich so erfolgreich, dass sie weder mit Spätfolgen noch mit Zwängen zu kämpfen hat. Nicht mal der überall erhältliche Alkohol lockt sie. Diese Diskrepanz zwischen der hoffnungslosen Drogensüchtigen und der gereiften Maya, die über alles hinweg scheint, nimmt dem Roman ein gutes Stück Glaubwürdigkeit. Ebenso unglaubhaft ist der Krimiplot, den Allende gegen Ende einführt und der recht simplizistisch Mayas Problem mit dem FBI löst. Die Marschrichtung (und der Bösewicht) sind allerdings zehn Meilen gegen den Wind zu erschnuppern und so möchte man Isabel Allende raten, es möglichst nicht noch einmal mit einem „Whodunit?“ zu versuchen. Dieser Teil des Romans geht nämlich gründlich schief.
_Ansonsten lohnt sich_ „Mayas Tagebuch“ vor allem wegen der Nebencharaktere und dem Schauplatz in Chile, nicht so sehr wegen der Beschreibung von Mayas Absturz und Drogensucht. Man könnte Isabel Allende Routiniertheit vorwerfen, doch es ist gerade dieses immer neue Verweben von bekannten Elementen, das ihre Fans so an ihren Romanen schätzen. Und auch wenn „Mayas Tagebuch“ kein Erfolg auf ganzer Linie ist, so verdient er doch einen wohlwollenden erhobenen Daumen.
|Hardcover: 448 Seiten
Originaltitel: El cuaderno de Maya
Übersetzung aus dem Spanischen: Svenja Becker
ISBN: 9783518422878|
http://www.suhrkamp.de
_Isabel Allende auf |Buchwurm.info|:_
[„Im Bann der Masken“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=605
[„Die Stadt der wilden Götter“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=1431
[„Im Reich des goldenen Drachen“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=1432
[„Zorro“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=1754
[„Inés meines Herzens“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=4229
[„Das Siegel der Tage“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=5269
[„Mein erfundenes Land“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=2979
[„Die Insel unter dem Meer“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6604
H. P. Lovecraft – Azathoth. Vermischte Schriften

H. P. Lovecraft – Azathoth. Vermischte Schriften weiterlesen
H. Russell Wakefield – Der Triumph des Todes und andere Gespenstergeschichten

H. Russell Wakefield – Der Triumph des Todes und andere Gespenstergeschichten weiterlesen
(H. P. Lovecraft)/August Derleth – Das Tor des Verderbens

Allende, Isabel – Insel unter dem Meer, Die
_Isabel Allende ist Spezialistin_ für Romane über starke Frauen. Da kommt es auch vor, dass ihre starken Frauen dermaßen unabhängig, freiheitsliebend und übergroß sind, dass der Leser sie für überzeichnet halten könnte, wüsste er nicht, dass Allende selbst diese unglaubliche Stärke und den unbändigen Lebenswillen mit ihrer eigenen Vita immer und immer wieder bewiesen hat. Dass sie, durchaus vom Leben gebeutelt, letztendlich doch immer das Positive in einem Schicksalsschlag sehen kann und nach vorne schaut, ist beeindruckend. Dass sie diese lebensbejahende Stärke mit immer wieder neuen Melodien in ihren Romanen besingt, ist keineswegs langweilige Wiederholung. Es ist Beweis dafür, dass hier eine Autorin ihr Thema gefunden hat – ein Thema, das sich immer wieder auf neue und überraschende Weise interpretieren lässt.
In Isabel Allendes neuem Roman, „Die Insel unter dem Meer“ (ein Euphemismus für das Jenseits), heißt diese starke Frau Zarité. Gleich im ersten Kapitel lernen wir sie als gestandene Frau mittleren Alters kennen, die geliebt und gelitten hat, und uns wird ihre Geschichte versprochen. Doch dann geht es eine ganze Weile erst mal gar nicht um Zarité, denn Isabel Allende hat sich mit „Die Insel unter dem Meer“ ein groß angelegtes Panorama vorgenommen, einen Historienroman allererster Güte.
Die Bühne bietet Saint-Domingue, Ende des 18. Jahrhunderts. Saint-Domingue, das heutige Haiti, war damals französische Kolonie und Exporteur von Zucker. Die zahlreichen Zuckerplantagen, von französischen Kolonialisten geführt, wurden von zahllosen Sklaven bewirtschaftet, die so schlecht behandelt wurden, dass sie in der Regel nach einigen Monaten „verschlissen“ waren und ersetzt werden mussten. In dieses Land, das irgendwo zwischen französischer Hochkultur und gesetzloser Barbarei schwankt, verschlägt es den jungen Toulouse Valmorain. Dessen Vater führte bisher die familieneigene Zuckerplantage, damit die Familie in Frankreich gut leben konnte. Doch nun liegt er im Sterben und Valmorain muss notgedrungen das Zepter übernehmen. Schnell stellt er fest, dass seine aufgeklärten Ansichten, von den aktuellen französischen Philosophen beeinflusst, ihm hier kaum weiterhelfen. Und so akzeptiert er bald ohne jede geistige Gegenwehr die Sklaverei als gottgegeben und unausweichlich, überlässt jedoch die wirklich brutalen Züchtigungen seinem Aufseher und beruhigt sich damit, dass Neger ohnehin weniger Schmerzempfinden haben als Weiße.
Als er auf Kuba seine Frau Eugenia kennenlernt und diese schließlich mit auf die Plantage bringt, kauft er für sie die neunjährige Zarité, damit diese der Herrin zur Hand geht. Bald stellt sich heraus, dass Eugenias Psyche der neuen Umgebung nicht standhält und so sorgt sich Zarité nicht nur um den Haushalt und um den neugeborenen Stammhalter Maurice, sondern auch um Eugenia, die immer mehr dem Wahnsinn verfällt und schließlich stirbt. Währenddessen befiehlt Valmorain Zarité des nächtens in sein Bett, vergewaltigt sie wiederholt und zeugt mit ihr zwei Kinder. Es sind die Kinder, ihre eigenen und auch Maurice, die sie von nun an an Valmorain binden. Selbst als sie die Möglichkeit zur Flucht hat, bleibt sie. Und als der Sklavenaufstand Valmorains Plantage zu überrennen droht, rettet sie ihn – wieder um der Kinder willen. Es verschlägt die beiden nach New Orleans, wo Zarité schließlich ihre Freiheit erzwingt und Valmorain ein zweites Mal heiratet.
_“Die Insel unter dem Meer“_ ist einer dieser historischen Romanen, in denen man sich wunderbar verlieren kann. Das Setting ist exotisch und schon darum ist man fasziniert von all den unbekannten Farben, Lauten, Landschaften und Menschen, die Isabel Allende im Verlauf des Romans zu einem riesigen Wandgemälde fügt. Selbst, als die Handlung nach New Orleans wechselt und die Charaktere die grüne, ungebändigte Hölle des Dschungels gegen die anspruchsvolle und vergnügungssüchtige kreolische Gesellschaft eintauschen, bleibt der Roman voller Sinneseindrücke. Tatsächlich gelingt ihr die Beschreibung New Orleans‘ besser als die der haitischen Plantagen, denn Isabel Allende ist eine Frau der Genüsse und derer bieten sich in dieser großstädtischen Gesellschaft einfach mehr: Da wird geschlemmt und geliebt, gestorben und duelliert, dass es eine Freude ist.
Schade daran ist einzig, dass die Protagonistin des Romans einer der uninteressantesten Charaktere ist. Auch Isabel Allendes Versuch, Zarité durch einzelne, in Ich-Form erzählte Kapitel, erfahrbarer zu machen, scheitert auf ganzer Linie. So unterbricht sie den Fluss der Handlung immer wieder, um Zarité selbst ihre Sicht der Dinge erzählen zu lassen. Doch diese Passagen bleiben blass und wirken seltsam fern. Stattdessen hat man den Eindruck, Zarité wäre der roten Faden, der alle anderen Charaktere dieses Romans verbindet. Und derer gibt es viele. Da wäre natürlich zunächst Valmorain zu nennen, dessen Ansichten über die Sklaverei im Allgemeinen und den Neger im Besonderen große Teile der Erzählung einnehmen. Die Widersprüchlichkeiten in seiner Argumentation sind dabei ein Reiz der Figur. Dass Freiheit offensichtlich ein Gut ist, dass für sich selbst Wert hat, will ihm nicht in den Kopf. Schließlich hat Zarité doch bei ihm alles, was sie braucht. Er sorgt gut für sie, meint er zumindest. Wozu sie also ständig auf ihre Freilassung drängt und diese schlussendlich sogar erpresst, will ihm nicht in den Kopf. Er fühlt sich gar von ihr verraten, als wäre er es, dem hier Unrecht getan wurde. Diese widersprüchliche Argumentationskette lässt vermuten, dass Valmorains gebildeter Verstand anders kaum mit den Gegebenheiten umgehen könnte. Denn im Gegensatz zu seinem Sohn, der zu seinen Überzeugungen steht und gegen die Sklaverei kämpft, ist Valmorain eigentlich zu feige und zu bequem, um an den Zuständen etwas ändern zu wollen. Er arbeitet lieber innerhalb des Systems und baut außerhalb von New Orleans die modernste und menschenfreundlichste Plantage auf. So als wären eine wasserdichte Hütte, regelmäßige Mahlzeiten und eine notdürftige medizinische Versorgung genug Bezahlung für die erzwungene Unfreiheit der Sklaven.
Dann wäre da noch Violette, die freie Mulattin, die als Konkubine große Erfolge feiert und schließlich durch die Heirat mit einem Franzosen in der Gesellschaft aufsteigt. Oder Tante Rose, die Voodoo-Priesterin, die mit Kräutern allerlei Krankheiten heilen kann und sich einen so guten Ruf erarbeitet hat, dass sogar ein französischer Arzt ihre Bekanntschaft sucht, um von ihr zu lernen. Oder Zacharie, der Sklave, der mit seinem herrschaftlichen Benehmen Ärger heraufbeschwört und dafür mit seinem schönen Gesicht bezahlen muss.
_Es gibt also viel_ zu entdecken in Isabel Allendes Roman. Dass da einiges zu bunt und zu überzeichnet gerät, ist fast verzeihlich. So lässt sie es sich nicht nehmen, gegen Ende auch noch eine Inzestbeziehung einführen zu müssen, deren Brisanz fast gänzlich unter den Teppich gekehrt wird, da der viel größere Tabubruch offensichtlich die Gemischtrassigkeit der Eheleute ist. Dass Zarité nach vielen Schicksalsschlägen dann doch Frieden mit der Welt schließt und bei sich selbst ankommt, erwartet man von Isabel Allende. Und sie enttäuscht nicht. Im Großen und Ganzen ist „Die Insel unter dem Meer“ nämlich eine runde Sache.
|Hardcover: 557 Seiten
Originaltitel: La isla bajo el mar
ISBN-13: 978-3518421383|
[www.suhrkamp.de]http://www.suhrkamp.de
_Isabel Allende auf |Buchwurm.info|:_
[„Im Bann der Masken“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=605
[„Die Stadt der wilden Götter“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=1431
[„Im Reich des goldenen Drachen“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=1432
[„Zorro“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=1754
[„Inés meines Herzens“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=4229
[„Das Siegel der Tage“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=5269
[„Mein erfundenes Land“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=2979
Algernon Blackwood – Die gefiederte Seele. Gespenstergeschichten
Mit zehn Kurzgeschichten und einer Novelle zielt der Autor nicht auf den Bauch-Grusel, sondern dringt – manchmal allzu behutsam aber eindrucksvoll und unsentimental – in die Schattenbereiche der menschlichen Seele vor:
– Das dreifache Band (The Threefold Cord, 1931), S. 7-20: Die schöne aber unheimliche Frau hat bereits den Großvater und den Vater in den Tod getrieben, und nun macht sie sich an den Sohn heran.
– Das Land des grünen Ingwer (The Land of Green Ginger, 1930), S. 21-29: Ein ebenso faszinierendes wie verstörendes Erlebnis lässt den späteren Schriftsteller seinen Lebensweg finden. Algernon Blackwood – Die gefiederte Seele. Gespenstergeschichten weiterlesen

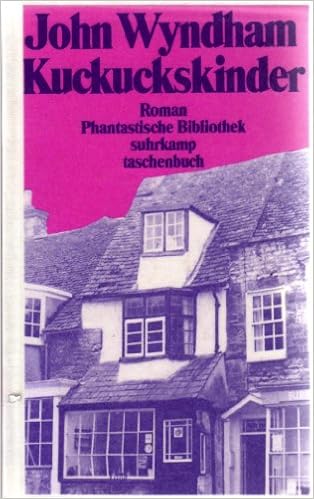

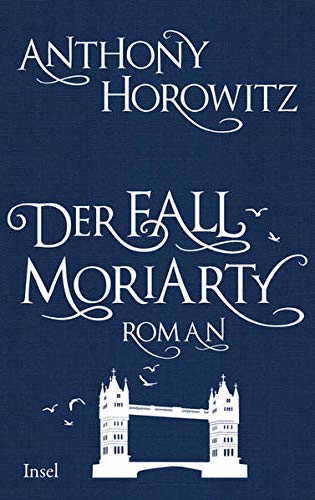
![[NEWS] Angelika Felenda – Der eiserne Sommer: Reitmeyers erster Fall](https://buchwurm.org/wp-content/uploads/2013/03/news-150x100.jpg)