
Die drei ??? und der schwarze Skorpion (Folge 120) weiterlesen

Die drei ??? und der schwarze Skorpion (Folge 120) weiterlesen
_Besetzung_
Erzähler: Klaus D. Klebsch
Jade Morgrave: Christine Pappert
W. Ashton Rawleigh: Thomas Karallus
Charles Desmond: Wolfgang Condrus
Mr. Barker: Andreas Borcherding
Ramon Gúajero: Walter v. Hauff
Miguel Lopez: Wolfgang Bahro
Carlos Sanchez: Michael Scherntaner
Sheriff: Norbert Gastell
Lt. Sergej Vechayew: Peter Groeger
Buch & Idee: Ellen B. Crown
Bearbeitung: Marc Chainiaux / Peter Brandt
_Story_
Vor einer Insel im Pazifik wird in der abgetrennten Hand eines auf merkwürdige Art und Weise umgekommenen Drogenschmugglers die Marke eines seit nunmehr 40 Jahren vermissten Kriegsstrategen entdeckt. Dieser Umstand ruft die Organisation Trinity auf den Plan, die sich eigenartigen Phänomenen wie diesem verschrieben hat und nun zwei ehemalige Agenten rekrutiert, um der Sache nachzugehen. Doch die widerspenstige Jade Morgrave und der ewige Störenfried Ashton Rawleigh lassen sich nicht so leicht in die Dienste des Unternehmens stellen. Erst mit Nachdruck kann Mr. Baker, die rechte Hand von Firmenchef Charles Desmond, die beiden überzeugen, ihr bisheriges, chaotisches Leben hinter sich zu bringen und wieder für die Regierung zu arbeiten.
Als das Duo schließlich nach Südamerika aufbricht, sammeln sich einige Ungereimtheiten um das eigentliche Projekt. Morgrave und Rawleigh begeben sich in Lebensgefahr und stellen ihre Auftraggeber in Frage. Doch in Wirklichkeit ist es etwas ganz anderes, das die heimliche Inselidylle aus der Ruhe bringt …
_Persönlicher Eindruck_
Mystery-Serien und finstere Thriller mit übersinnlichen Inhalten sind derzeit das Top-Thema auf dem Hörspielmarkt, jüngst wieder bestätigt in der Kai-Meyer-Adaption „Die Alchimistin“, deren üppige Ausstattung und majestätische Gestaltung in diesem Jahr gänzlich neue Standards in der Szene gesetzt hat. Derartige Entwicklungen sind auch in der Hörspiel-Schmiede der |vghaudio| und |Maritim-Produktionen| nicht spurlos vorbeigezogen. Neben den vielen Kriminalformaten, mit denen sich der Verlag in letzter Zeit einen Namen gemacht hat, erscheint nun mit „Top Secret“ ebenfalls eine eher düstere Thriller-Reihe, die jedoch in einem äußerst modernen Setting angesiedelt ist. „Akte X“ im Hörspielformat? Nicht ganz, aber so ähnlich …
In Sachen Aufbereitung und Inszenierung knüpft „Top Secret“ jedenfalls schon einmal an die wichtigsten Vertreter der Zunft an und glänzt mit effektvollen Sounds, einer ansprechenden musikalischen Untermalung und ambitionierten Sprechern. In der Auftaktstory „Herz aus Eis“ hat man sich auch direkt ein recht interessantes Thema ausgesucht und es mit den Inhalten einer modern aufbereiteten Kriminal-/Thriller-Handlung kombiniert. Drogenschmuggel, verschollene Persönlichkeiten, zwei ignorante, zunächst weniger sympathische Agenten in der Rolle des Hauptdarstellers und eine Spur Übersinnliches – hier treffen schon einmal ein paar Welten aufeinander, die im literarischen Bereich oftmals getrennt voneinander agieren.
Aber auch die Strukturierung ist bewundernswert dynamisch. Rasche Szenenwechsel, in diesem Rahmen eine ziemlich ausführliche Einführung von Personen und der Organisation, die auch in den kommenden Serientiteln noch eine Rolle spielen wird, und dazu dezente Andeutungen zu Hintergründen und Komplexen, ohne dabei jedoch schon aufs Ganze zu gehen. Schritt für Schritt wird hier ein spannendes Konzept erstellt, in dem langsam aber sicher alle Darsteller ihren Platz finden und welches sich schon zu Beginn als Storyboard für einen potenziellen Mehrteiler vorstellt, ohne dabei jedoch die eigentliche Tragweite der Handlung bewusst zu machen. Hier ist nämlich dann doch das entscheidende Manko von „Herz aus Eis“: Der Detailreichtum ist so immens groß, dass die Geschichte es zum Ende hin kaum mehr schafft, alle Inhalte konsequent abzuarbeiten. Während man sich nämlich in langsamen Schritten auf ein großes Finalszenario vorbereitet, muss man irgendwann verbittert feststellen, dass die Story abrupt und ohne irgendeine Form von Vorwarnung endet – und das kann, zumindest in dieser Form, kaum akzeptiert werden.
Unverständlich ist das rasche Ende der Handlung vor allem vor dem Hintergrund der allgemein knappen Spielzeit. Da wird eine komplette Halbzeit dafür aufgebracht, Rawleigh und Morgrave zu überreden, ins Team einzusteigen, hierbei werden ferner auch manche nutzlosen Dialoge integriert, und wenn es schließlich drauf ankommt, das Konstrukt schön weit aufzuspannen und die Spannung zum Siedepunkt zu bringen, entscheidet sich die Autorin dazu, erst gar nicht mehr in die Tiefe zu gehen und quasi mittendrin abzubrechen. Seltsam, aber leider wahr!
Aus diesem einzigen Grund ist der Auftakt zur neuen Serie im Grunde genommen schon ein klassischer Fehlstart. Viele gute Ansätze werden mit der urplötzlich aufgeworfenen Endsequenz ebenso wieder begraben wie das richtig kraftvolle Potenzial des Plots. Dabei hat „Top Secret“ wirklich alles, was ein gutes Hörspiel benötigt: gute Sprecher, ein funktionierendes Gerüst und einen Hang zur Perfektion bei der Inszenierung. Warum wurde also bei der Ausarbeitung der Story zum Ende hin gespart? Tja, diese Frage kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Dennoch: Schade um die zunächst vergebene Chance, eine gute neue Serie mit einem Paukenschlag zu eröffnen.
|50 Minuten auf 1 CD
ISBN-13: 978-3-86714-141-3|
http://www.maritim-produktionen.de/

Im 11. Jahrtausend tun sich der Imperator und Harkonnen zusammen, um das Haus Atreides unter Herzog Leto zu vernichten. Die große Mausefalle ist der Wüstenplanet Arrakis, der Köder unermesslicher Reichtum in Form des einzigartigen Rohstoffs |Spice-Mélange|. Der Plan klappt wie am Schnürchen, doch eine Kleinigkeit geht schief: des Herzogs Konkubine und sein Sohn Paul entkommen in die Wüste. Dort bauen sie mit den einheimischen Fremen eine Guerilla-Organisation auf, die droht, die lebenswichtige Spice-Produktion zum Erliegen zu bringen – und damit jeden Verkehr im Imperium! Der Imperator, gezwungen von der Raumfahrtgilde, muss nach Arrakis kommen …
Herbert, Frank / Kaiser, Kerstin – DUNE 1: Der Wüstenplanet. Teil 2 von 2 (Hörbuch) weiterlesen
_Inhalt:_
Die Archäologin und Amulett-Forscherin Brenda Logan wacht ohne Gedächtnis in einem Londoner Krankenhaus auf. Geplagt wird sie dabei von merkwürdig real erscheinenden Träumen, in denen sie sich als Mathilda McLillian sieht, die während der Zeit der Kreuzzüge lebte. Gemeinsam mit dem Knappen Philipp versucht sie ihrem intriganten Onkel zu entkommen, der die Herrschaft über das Schloss antreten will, als er erfährt, dass Mathildas Vater auf dem Kreuzzug gefallen ist.
Brenda fällt aus allen Wolken als sie sieht, dass ihr Arzt Dr. Daniel Connors das perfekte Ebenbild von Philipp aus ihren Träumen ist. Doch der Schrecken beginnt erst, als plötzlich ein Mann in ihrem Krankenzimmer erscheint, der genauso aussieht wie Mathildas finsterer Onkel. Er gibt sich als Brendas Ehemann aus und nimmt die junge Archäologin mit sich auf sein Schloss. Brenda gelingt die Flucht und sie läuft dem Arzt Dr. Connors in die Arme, der ihr folgte. Der junge Mann möchte der hübschen Frau helfen, doch die beiden ahnen noch nicht, dass sie mit Mächten konfrontiert werden, die ihr Vorstellungsvermögen sprengen …
_Meine Meinung:_
Ende der 90er Jahre begann im |Kelter|-Verlag eine als Frauen-Grusel deklarierte Heftromanserie, geschrieben von Jan Gardemann unter dem Pseudonym Ira Korona. Zunächst erschienen die Abenteuer der Amulettforscherin Brenda Logan in der Reihe |Spuklicht|. Nach Einstellung dieser Reihe wurde |Das magische Amulett| in die Reihe |Gaslicht| integriert und später als eigenständige Serie ausgekoppelt. Im Gegensatz zum Serientitel ging es allerdings nicht um ein bestimmtes Amulett. In jedem Roman bekam es Brenda Logan mit einem neuen Artefakt zu tun. Mit Band 28 wurde die Serie wieder eingestellt, doch die Romane erscheinen in regelmäßigen Abständen weiterhin in der Reihe |Irrlicht|.
Relativ neu an der Serie war, dass eine weibliche Heldin die Hauptrolle innehatte. Das gab es bis dahin lediglich in den Heftromanserien |Vampira| und |Jessica Bannister|. Im Jahr 2005 nahm sich Sven Michael Schreivogel von |Nocturna Audio| der Serie an, auf der Suche nach einem neuen Heftromanstoff zum Vertonen. Die Drehbuchversion schrieb Susa Gülzow, die bereits mehrfach erfolgreich mit Schreivogel zusammenarbeitete. Die Hauptrolle bekam Katja Brügger, auch bekannt als „Carminia Brado“. Die Hörspielikone ist zugleich auch die Erzählerin der Geschichte, die als Hörbuch mit Spielszenen konzipiert wurde. Fans der Sprecherin kommen voll auf ihre Kosten, denn Katja Brügger hat in all den Jahren nichts verlernt und liefert eine grandiose Vorstellung ab. Ihr zur Seite steht Robert Missler, der in vielen Produktionen von |Nocturna Audio| ganz vorne dabei ist. In der Serie |Kommissar X| spricht er den Protagonisten Jo Walker und auch in der Serie |Gordon Black|, die nächstes Jahr erscheinen wird, hat er die Hauptrolle erhalten. In dem vorliegenden Hörspiel spricht er den Arzt Dr. Daniel Connor, der das Herz der schönen Brenda erobert.
Ebenfalls mit von der Partie sind Christine Pappert als Mathilda und Tim Knauer als Philipp. Als finsterer Zauberer Roderick ist Achim Schülke zu hören, während die Mutter Oberin wunderbar herrisch von Marianne Lund gesprochen wird, hinter der sich niemand anderer als Susa Gülzow verbirgt, die hier ihr schauspielerisches Talent eindrucksvoll unter Beweis stellt. Unbesetzt geblieben ist dagegen die Rolle des Bösewichts John. Hier kommt der Hörbuchcharakter der Produktion zur Geltung, der von Katja Brügger sehr gut in Szene gesetzt wurde. Unterstützt wird sie dabei von einer äußerst realistischen Geräuschkulisse. Der Tonmeister Hans-Joachim Herwald steuerte die stimmungsvolle Musik bei, die gezielt den Charme der 80er Jahre transportiert und die seichte Gruselatmosphäre hervorragend stützt.
Die Vorlage von Jan Gardemann ist auf die weibliche Leserschaft ausgerichtet und bewegt sich auf dem typischen Heftromanniveau. Daher auch die übertrieben schnelle und kitschige Verlobung der beiden Hauptfiguren. Darüber hinaus ist die Story eher dazu angetan, dem Hörer einen leichten Schauder zu bescheren als ihn durch drastische Gewaltszenen und ein Effektfeuerwerk zu beeindrucken. Allerdings hätte das Ende ruhig ein wenig dramatischer ausfallen dürfen.
Die Trackeinteilung ist mit sechs Tracks für 60 Minuten Spielzeit wenig benutzerfreundlich. Die kunstvolle, harmlose Illustration von Ilka Hennemeyer kommt in der Neuauflage und durch das Artwork von Mark Freier viel besser zur Geltung als bei der ersten Auflage unter dem Label |Maritim|. Informationen zum Autor Jan Gardemann, alias Ira Korona, vervollständigen das Begleitheft.
_Fazit:_
„Wiedergeburt des Bösen“ ist ein ruhiges, atmosphärisches Hörspiel im Stil alter Schauerromantik-Geschichten. Die Produktion stellt eine gelungene Mischung aus Hörspiel und Hörbuch dar und wird größtenteils durch die Sprecherin Katja Brügger getragen, die eine exorbitante Leistung abliefert. Ein wenig mehr Dramatik und eine großzügigere Trackeinteilung hätten dem Hörspiel allerdings gut zu Gesicht gestanden.
|60 Minuten auf 1 CD
Titelillustration von Ilka Hennemeyer
Titelgestaltung von Mark Freier|
http://www.nocturna-audio.de
http://www.jangardemann.de
_Florian Hilleberg_

_100A – Das Rätsel der Sphinx_
Weitere Sprecher dieser CD:
Erzfeind der ??? – Skinny Norris: Andreas von der Meden
Jelena Charkova: Alexandra Doerk
_Story_
Conrad Leland trägt ein schweres Los; infolge eines Anschlags lebt er inkognito und operiert nur noch über seine künstliche Intelligenz, mit deren Hilfe das Team X-treme gegründet wurde. Charlie, Race und Kami wurden bei ihrer Aufnahme mit moderner Spezialausrüstung ausgestattet und sollen nun aktiv das Verbrechen bekämpfen und Leland und sein Vermächtnis rächen.
In ihrem aktuellen Fall jagen die drei Agenten einen Falschspieler namens Kanga, der in den Casinos Monacos illegales Geld erspielt und es an Gesetz und Steuern vorbeischleust. Charlie gelingt es, in dessen Hotel einzudringen und einen Datenträger sicherzustellen, der die Machenschaften des Gangsters beweist, wird dabei aber von einem merkwürdigen jungen Mann überrascht, der sich als Kyle Connor vorstellt und unter Amnesie leidet.
Connor war kurz zuvor von einem Gangsterteam überrumpelt worden und hofft nun, mit Hilfe des Team X-treme mehr über seine wahre Identität herauszufinden. Doch aufgrund seines starken Egos wird er von den Mitgliedern der Agententruppe nur schwer akzeptiert. Erst auf Geheiß Lelands findet er Zugang zur Mannschaft und erfährt bald, dass seine Vergangenheit unmittelbar mit dem aktuellen Fall des Teams in Verbindung steht.
_Persönlicher Eindruck_
Neue Helden braucht das Land – vor allem im Hörspielsektor, der gerade im Jugendbereich nach dem steten Qualitätsverlust der „TKKG“-Serie und den zuletzt auch nicht mehr ganz so ereignisreichen Fällen der drei ???-Detektive aus Rocky Beach im Begriff ist, deutliche Einbußen zu verzeichnen. Mit einem renommierten Team hat sich Autor Michael Peinkofer nun an die Herausforderung gewagt, eine neue Agenten-Combo ins Rennen zu schicken und der kultigen Konkurrenz Beine zu machen. Gemeinsam mit Komponist Max Buskohl, der für die Titelmusik verantwortlich ist, und Produzent Oliver Rohrbeck hat Peinkofer das „Team X-treme“ entworfen, eine recht vorlaute junge Truppe, die mit modernen Hilfsmitteln und in riskanteren Missionen in bester James-Bond-Manier um Zuhörer buhlt – und damit auch schnell Erfolg haben dürfte.
Die vorwiegende Stärke der Serie scheint, der ersten Episode nach zu urteilen, vor allem bei der dynamischen Inszenierung zu liegen. Das Erzähltempo ist relativ hoch, darüber hinaus gibt es unzählige flotte Szenenwechsel, und auch auf der Charakterebene passiert eine ganze Menge im zwischenmenschlichen Bereich, auch wenn hier der Anspruch, dem Zielpublikum entsprechend, nicht zu hoch angesetzt werden darf. Natürlich wimmelt es dabei auch vor Rezitierungen aus dem Kosmos der großen, bekannten Hörspielserien. Kleine Machtkämpfe zwischen den männlichen Protagonisten, leicht klischeebesetzte Bösewichte, manchmal überzogen scharfe Sprüche – das „Team X-treme“ schreckt grundsätzlich vor nichts zurück, was ein modernes Jugendhörspiel ausmacht, teilweise aber auch belastet.
Allerdings ist das grundlegende Setting hier ein anderes und aufgrund der interessanten Background-Story auch durchaus reizvolles. Die Hintergründe um die mysteriöse KI des Conrad Leland bieten ordentliches Potenzial, aber auch die Teammitglieder scheinen individuell noch einiges zu verbergen haben und können sich relativ problemlos als neue Serienmannschaft etablieren. Einzig die manch etwas sehr flachen Dialoge und die Spitzen, die Kyle und die übrigen Jungs untereinander austauschen, könnten etwas spärlicher gesät sein. Dies jedoch macht „Alles oder nichts“ mit einer richtig guten Story, einem schlüssigen, temporeichen Handlungs-Arrangement und einer lebendigen, aufwändigen Inszenierung wieder wett.
Aus diesen Gründen darf man den Start der Serie auch größtenteils als gelungen bezeichnen. Ob man die starke |Europa|-Konkurrenz wirklich angreifen kann, muss sich zwar noch herausstellen, doch mit dem Debüt ist zumindest schon einmal die Saat für eine viel versprechende Zukunft auf dem Hörspielmarkt ausgelegt.
|56 Minuten auf 1 CD
ISBN-13: 978-3-7857-3555-8|
http://www.luebbe-audio.de
http://www.stiftung-x.de
http://www.michael-peinkofer.de
http://www.wellenreiter.la
_Spannender Provinzkrimi mit kleinem Schönheitsfehler_
Als die Familie seines besten Freundes Adam verreist, versteckt sich der 17-jährige Derek im Keller, um sich später im leeren Haus mit seiner Freundin Penny treffen zu können. Der Junge kauert noch unter der Treppe, als die Familie überraschend zurückkehrt. Während Derek in seinem Versteck darüber nachdenkt, wie er seine Anwesenheit erklären soll, klingelt es an der Tür. Mr. Langley öffnet die Haustür – und wird sofort niedergeschossen. Derek muss mit anhören, wie der Killer auch seinen Freund und dessen Mutter niederschießt. Er selbst entgeht dem suchenden Blick des Mörders, bis dieser das Haus wieder mit seinem Komplizen verlässt. Derek kehrt völlig verstört nach Hause zurück, wo er kein Wort sagt.
Weil er nicht wagt, sich als einziger Zeuge an dem Dreifachmord bei der Polizei zu melden, kommt viel zu spät ans Licht, dass es der Mörder gar nicht auf die Nachbarn abgesehen hatte, sondern auf Dereks Eltern …
_Der Autor_
Der Kanadier Linwood Barclay machte seinen Abschluss in Literatur an der Trent University in Petersborough, Ontario. Anschließend arbeitete er lange Jahre als Journalist und hatte bis 2008 eine beliebte Kolumne im „Toronto Star“. [„Ohne ein Wort“, 3947 sein erster Psychothriller, wurde zum internationalen Bestseller und nominiert für den |Arthur Ellis Award|, den |Barry Award| und landete bei den |International Thriller Writers| auf der Shortlist als bester Roman.
_Der Sprecher_
Frank Arnold ist Schauspieler, Rundfunksprecher und Dramaturg. Er führte bei zahlreichen Theater und Opern-Produktionen Regie, arbeitet für verschiedene Sendeanstalten und ist ein gefragter Hörbuchsprecher.
Gabriele Kreis führte im Eimsbütteler Studio Regie.
_Handlung_
|PROLOG|
Als die Familie seines besten Freundes Adam verreist, versteckt sich der 17-jährige Derek Cutter in einem Verschlag im Keller, um sich später im leeren Haus mit seiner Freundin Penny treffen zu können. Der Plan, von dem Adam nichts weiß, geht auch beinahe auf. Er hat nur zwei Fehler: Penny hat wegen eines Blechschadens, den sie am Wagen ihres Vaters verursacht hat, Hausarrest. Und zweitens kehrt Adams Familie zurück, weil sich Adams Mutter Donna unwohl fühlt. Derek eilt sofort in sein Versteck zurück und hofft, später, wenn alle schlafen, aus der Hintertür schleichen zu können. Die Kombination der Alarmanlage kennt er längst.
Nach 22 Uhr scheint sich die Lage gerade zu beruhigen, als an die Haustür geklopft wird. Mister Langley öffnet. Anscheinend sind es zwei Männer, und einer von ihnen schreit: „Schande! Dreckskerl!“ Dann hört Derek voll Entsetzen einen Schuss, dem ein Poltern folgt. Adam will wegrennen, wird aber von hinten niedergeschossen. Als Mrs. Langley aus dem Obergeschoss herabkommt, um nachzusehen, was los ist, ereilt auch sie der Tod. Der Schütze schleicht durchs Haus, um es zu durchsuchen, doch Derek bleibt zum Glück unentdeckt. Als er ein Auto wegfahren hört, wagt er sich aus seinem Versteck, eilt durch die Diele und zur Haustür hinaus. Er kann kaum seinen Schock angesichts der drei Leichen beherrschen, doch er bleibt nicht stehen, bevor er zu Hause angelangt ist: auf dem hundert Meter entfernten Nachbargrundstück, dem Heim der Cutters.
|Haupthandlung.|
Promise Falls liegt im Norden des Bundesstaates New York und ist ein friedliches Städtchen, denkt Jim Cutter, als er am Samstagmorgen um halb sieben aufsteht. Aber immerhin ist das Städtchen bedeutend genug, um ein eigenes Uni-College vorzuweisen, an dem seine Frau Ann als Organisatorin des alljährlichen Literaturfestivals für Professor Chase arbeitet. Jim selbst arbeitet mit seinem Gartenservice an den Rasen und Bäumen der Bewohner, seit er vor zwei Jahren Bürgermeister Randall Finlay, dessen Fahrer er war, einen Nasenstüber versetzte.
Jim will aufbrechen, doch weil Derek ihm helfen soll, weckt er ihn: Derek pennt in seinen Kleidern! Diese Jugend von heute! Weil Derek kein Frühstück will, brechen sie gleich auf. Jim bemerkt, dass bei den Langleys zwei Autos vorm Haus stehen. Wollten die nicht verreisen? Als er einen Anruf von Ann erhält, kehrt er nach Hause zurück. Sheriff Barry Duckworth will ihn sprechen. Bei der Rückkehr ist jede Menge Polizei vorm Haus der Langleys zu sehen, und sogar die Zufahrt zum Cutter-Haus ist abgesperrt. Ann holt sie ab, völlig außer sich: Die Langleys seien alle tot. Weil Albert Langley ein angesehener Rechtsanwalt und Strafverteidiger war, ist das Aufsehen entsprechend groß.
|Alibis|
Als der Sheriff Jim, Ann und Derek nach einem Alibi befragt – was Ann gehörig aufbringt -, gibt Jim seinem Sohn ein Alibi. Das ist nett, aber nicht besonders schlau. Duckworth hegt einen kleinen Verdacht gegen einen gewissen Mr. McKindrick, erwähnt aber auch, dass schon zuvor zwei Morde entdeckt worden seien. Mit dem Frieden in Promise Falls scheint es vorbei zu sein. Kein Wunder, dass Ann am liebsten sofort wegziehen würde. Aber wie würde das in den Augen des Sheriffs wirken, fragt sich Jim. Er ist fürs Bleiben, obwohl er schon ein paar „Leichen“ im Keller hat, so etwa die, dass Ann ein Verhältnis mit dem Universitätsleiter Conrad Chase hatte. Und die Sache mit dem Bürgermeister.
Am Sonntagmorgen bittet Duckworth Derek, der Adam Langley ja als Letzter lebend gesehen habe, um eine Besichtigung des Tatorts. Ob irgendetwas verändert sei, will er wissen. Der Siebzehnjährige muss sich sehr beherrschen, um die Blutflecken auf dem Boden zu übersehen und alle Fragen zu beantworten, ohne dass der Sheriff Verdacht schöpft. Er erzählt auch von Penny Tucker und ihrem Hausarrest. Er habe das Haus zwei Stunden vor der Tatzeit verlassen, also etwa um acht Uhr abends. Auch diese Falschangabe erweist sich später als Fehler.
|Der Verdacht|
Als er allein mit seinem Vater ist, erzählt Derek Jim, dass er bemerkt habe, dass der Computer aus Adams Zimmer verschwunden sei. Na und, will Jim wissen. Na ja, Derek hatte Adam die Kiste ausgeliehen. Er selbst hatte sie von Jims Kundin Agnes Stockwell erhalten. Und die wiederum hatte den Rechner von ihrem Sohn Brad. O nein – der junge hoffnungsvolle Student, der sich an den Promise-Wasserfällen umbrachte. Tja, fährt Derek herumdrucksend fort, auf der Festplatte des Rechner befand sich ein Romanmanuskript, das ziemlicher Schweinkram sei.
Zum Glück hat Derek eine Kopie auf Diskette gezogen und kann seinem Vater einen Ausdruck des Romans geben. Jim erkennt den Text sofort wieder: Es ist der Anfang von Conrad Chases erotischem Roman „Das beste Stück“. Das Buch, das Chase zu Ruhm, Ehre, Geld und Uni-Posten verhalf, steht in der elterlichen Bibliothek. Und jetzt stellt sich heraus, dass Chase die Grundlage seines Reichtums, seines Ansehens und seiner Macht seinem Studenten Brad Stockwell gestohlen hat.
Was wenn Chase sich veranlasst sah, die letzte Kopie dieses Originals durch den Diebstahl des Rechners von den Langleys zu beseitigen, grübelt Jim zusammen mit Ann, der er seine Entdeckung mitteilt. Aber wozu dann drei Leichen hinterlassen? Ann hindert Jim daran, sofort zu Chase zu laufen. Er würde nur als gehörnter Ehemann erscheinen, der nun zurückschlagen wolle, und nichts weiter erreichen. Nein, sie müssten die Diskette zurückgeben!
Jim starrt sein Eheweib an, als wäre sie von allen guten Geistern verlassen. Auf welcher Seite steht sie eigentlich? Erst später weiht sie ihn ein, dass auch sie eine Vergangenheit mit Conrad Chase und Brad Stockwell verbindet. Aber dann ist der Fall Langley bereits zu einem Albtraum für die Tuckers geworden.
_Mein Eindruck_
Die Welt ist voller Heuchler und Geheimnisse. Das gilt ganz besonders für die Provinzstadt Promise Falls. Sie hat einen sprechenden Namen: „promise“ – das Versprechen (des amerikanischen Traums?) – „falls“: fällt; gemeint sind aber auch die lokalen Wasserfälle. Man könnte Promise Falls sehr gut mit dem Städtchen Twin Peaks in David Lynchs TV-Serie vergleichen. Hier ist im Grunde fast alles möglich: von Massenmord bis zu nächtlichen Orgien, von vergleichsweisen „Lappalien“ wie Ehebruch und Sex mit Minderjährigen ganz zu schweigen.
Das Vergnügen, diese Geheimnisse aufzudecken, sorgte für mein anhaltendes Interesse an diesem Thriller aus dem kühlen Kanada. Und Jim Cutter (ebenfalls ein sprechender Name) ist kein Mann, der etwas anbrennen lässt oder ein Blatt vor den Mund nimmt. Ganz besonders dann nicht, wenn es um die Zukunft seiner Ehe und Familie geht. Schlimm genug, dass sein eigener Sohn als Dreifachmörder der Langleys verhaftet und angeklagt wird. Das kann einen Vater schon zum Wahnsinn treiben. Nein, auch seine eigene Frau, die liebe Ann, hintergeht ihn und scheint ein falsches Spiel zu treiben. Das bringt die Grundfesten ins Wanken, denn Jim ist weder ein Collegeabsolvent noch hat er einen vernünftigen Beruf gelernt. Ein (beinahe) grundehrlicher Bursche wie du und ich also.
Die zwei Kidnapper, die Jim gefangen nehmen und foltern, scheinen aber nichts mit Ann zu tun zu haben, denkt Jim. Denn auch Ann ist gefesselt und geknebelt. Merkwürdig findet es aber schon, dass Morty, sein Folterknecht, ihn penetrant nach der Diskette mit dem Romanmanuskript Brad Stockwells fragt und die Kopie haben will. Da steckt am Ende also doch Anns Lover, dieser fiese Conrad Chase, dahinter, denkt Jim. Aber die Sache ist dann doch etwas komplizierter, als er denkt. Und weitaus blutiger im Verlauf.
Dass Jims Arbeitsersatz für Derek, dieser schweigsame Drew Lockus, einiges auf dem Kerbholz haben muss, merkt man sofort, doch Jim ist voll Vertrauen in den entlassenen Sträfling. Ganz besonders nach der Sache mit den beiden Kidnappern, die Drew ganz allein angriff. Ein gewiefter Krimileser hat aber einige Vorbehalte gehen den ebenso hilfsbereiten wie schweigsamen Drew und zählt zwei und zwei schon lange zusammen, bevor Jim es tut. Drew hatte eine Tochter, die vor kurzem im Krankenhaus starb. Wir erinnern uns an Randall Finlays Begegnung mit einer minderjährigen Prostituierten. Und dass ausgerechnet Jim Cutter seinen Namen und seine Telefonnummer in deren Notizbuch schrieb.
Die Vorhersehbarkeit der an Drew gebundenen Handlung stellt sich aber als doch nicht so abträglich für die Spannung heraus. Denn Drew hat eine ganz besondere Forderung an den Sünder Randall Finlay. Der Bürgermeister von Promise Falls soll seine Sünde öffentlich bekennen, und zwar nicht irgendwo, sondern auf der Bühne, auf der er seine Kandidatur für den US-Kongress bekanntgeben will. Finlay hält diese Forderung natürlich für völlig absurd, aber Jim sorgt dafür, dass Finlay die handfesten Argumente Drews berücksichtigt: Drew bedroht Jims Sohn und Frau mit dem Tode.
Was nun Ann mit Conrad Chase und Brad Stockwell zu tun hat, ist eine völlig andere Geschichte, wie es scheint. Und deshalb sollen die Feinheiten dieser falschen Fährte nicht weiter dargelegt werden. Ein Red Herring wie dieser dient lediglich dazu, weiter Belege für die Heuchelei und Geheimnisse der Provinz zu liefern. Aber zufrieden stellte ich fest, dass so das Rätsel um „Das beste Stück“ ebenso gelöst wird wie die scheinbar dubiose Loyalität von Ann Cutter.
Und wozu mag all dieser Tumult in der Provinz gut sein, mag sich der Leser fragen. Nun, der Autor will wohl zeigen, dass nichts ist, wie es scheint, und dass Ehre nicht immer ehrenvoll erworben sein muss. Und dass Selbstmord nicht immer Selbstmord ist, und ehrbare Ehefrauen auch mal mit dem Sohn des Nachbarn ins Bett gehen können, um Spaß zu haben. Und wenn sich der Pulverdampf verzogen und der Schurke im Stück seine gerechte Strafe erhalten hat, dann können die Hauptfiguren möglicherweise zu neuen Ufern aufbrechen. Ein weiteres „Promise Falls“ lockt sie, denn der amerikanische Traum, er währet ewiglich. Jedenfalls bis zur nächsten Krise.
|Der Sprecher|
Dass Frank Arnold ein Theatermann ist, merkt man an seiner Vortragsweise. Sie unterscheidet sich kaum von anderen Meistern der Stimme, aber er beherrscht die Darstellung sämtlicher Emotionen auf dem Effeff. Das lässt die Szenen sehr lebendig erscheinen. Mehr als einmal ertappte ich mich dabei, mir die jeweilige Szene bildlich vorzustellen. Arnold kann aber auch von den lauten Tönen des Zorns und des Erstaunens schnell wieder umschalten auf leise Töne des Schmerzes und der Zärtlichkeit. Die Story gibt beide Stimmungslagen in reichlichem Maße her.
Selbstredend sprechen die männlichen Figuren in einer tieferen Tonlage als die weiblichen. Besonders Sheriff Duckworth sticht durch seine sehr tiefe, autoritäre Stimme hervor. Sein genaues Gegenteil ist der aalglatte und hinterfotzige Universitätspräsident Conrad Chase. Chase ebenbürtig ist seine Frau, ein ehemaliges Hollywood-Starlet mit familiären Verbindungen zur Mafia. Auch sie säuselt so blond und täuschend freundlich, dass man kaum glaubt, dass sie einen Mordauftrag vergeben haben soll.
Ganz wunderbar gelungen fand ich auch die Figur des Bürgermeisters Randall Finlay. Obwohl der schmierige, aber leutselige und charmante Typ immer wieder ins Amt gewählt wird, erfahren wir doch im Laufe von Jims Enthüllungen, dass es Finlay mit einer Nutte trieb, die sich als minderjährig entpuppte. Das brachte ihm Jims Nasenstüber ein. Nun, Finlay wird seine Strafe erhalten und so für den Showdown mit dem Mörder der Langleys sorgen.
Die Aufnahme hat nur einen einzigen Schönheitsfehler. Dieser geht nicht aufs Konto des Sprechers, sondern auf das des Aufnahmeleiters und des Schnitts. Wird er deshalb nicht namentlich erwähnt? Wie auch immer: Auf CD Nr. 3 tritt bei der Marke von 54:06 Minuten eine unmotivierte Pause ein, die etwa fünf Sekunden anhält, bevor die Aufnahme fortfährt. Zum Glück geht keine Information des Textes verloren, aber etwas irritierend und ablenkend ist diese Lücke schon.
_Unterm Strich_
Dies ist kein Copthriller und schildert auch nicht die Ermittlung gegen den klischeehaften Serienkiller. Vielmehr betrachten wir das Geschehen, das nach dem kriminellen „Erdbeben“ des Mordes an den Langleys stattfindet, aus der Sicht eines gewöhnlichen Bürgers: des Nachbarn. Ein einfacher Gärtner, Fahrer und Hobby-Kunstmaler. Was könnte unverdächtiger sein? Aber unversehens sieht sich Jim Cutter in sinistre Abläufe verwickelt: als Opfer von Folterknechten, unsichtbaren Strippenziehern und natürlich dem Serienmörder, der die Langleys auf dem Gewissen hat.
Glücklicherweise legt Jim Cutter nicht die Hände in den Schoß und sagt: Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen, sondern packt die Sache auf bewährte Yankeeweise an. Doch weil nichts ist, was es zu sein scheint, muss er auch seine eigene Ehefrau verdächtigen und fällt aus allen Wolken, als sein Sohn ihm ein geheimes Sexleben offenbart. Außerdem glaubt er sich auf der Spur eines Literaturskandals erster Größenordnung, der sich zudem als tragische Verkettung von Taten und Unterlassungen entpuppt.
Es gibt einige schöne Höhepunkte, von denen vielleicht der witzigste die Selbstenthüllung des Bürgermeisters als Freier einer minderjährigen Nutte ist. (Natürlich tut er das nicht freiwillig.) Aber auch die Bloßstellung von Conrad Chases Frau Eliana als zwielichtige Mordauftraggeberin ist eine köstliche Szene. Enthüllungen gibt es reihenweise, und manche davon sind so verzwickt und heikel, dass man nicht anders kann, als entsprechende Geduld mitzubringen. Die Wahrheit über Brad Stockwells angeblichen Selbstmord ist solch eine Szene.
Barclays Thriller eilt von Höhepunkt zu Höhepunkt, und so manche Szene mag an den Haaren herbeigezogen erscheinen. Aber die Story sorgt für eine Menge spannender Unterhaltung, ohne dabei in Kitsch oder Klamauk abzugleiten. Ob der richtige Mörder der Langleys am Schluss gestellt wird, ist eine Frage, die einen Spannungsbogen über die ganze Handlung errichtet. Darunter hat der Autor eine Reihe weiterer, kleinerer Spannungsbögen errichtet. Und kaum glaubt der Leser mit Jim eine Verschnaufpause einlegen zu können, geht unversehens die Action erneut los. Feine Sache.
|Das Hörbuch|
Frank Arnold gestaltet seinen Vortrag dieses spannenden Krimis sehr lebhaft und unter hohem Einsatz seiner Stimmfertigkeit. Schon nach wenigen Minuten achtete ich kaum noch auf seinen Ausdruck in der Charakterisierung der Figuren, so sehr hatte mich seine Versiertheit überzeugt. Daher konnte ich mich an den emotionalen Einzelszenen erfreuen, ohne mich von den gelieferten Informationen, welche die Beweiskette gegen diverse Verdächtige aufbauen, ablenken zu lassen.
Ein Fehler im Schnitt der Aufnahme verblüffte mich indes. Einfach so eine Lücke von rund fünf Sekunden entstehen zu lassen beziehungsweise zu überhören – das findet man nicht alle Tage.
|Originaltitel: Too close to home, 2008
Aus dem kanadischen Englischen übersetzt von Sky Nonhoff
457 Minuten auf 6 CDs
ISBN-13: 978-3-89903-636-7
Buchausgabe bei Ullstein Taschenbuch unter der ISBN-13 978-3-548-26744-9|
http://www.hoerbuch-hamburg.de
http://www.ullsteinbuchverlage.de
_Holmes singt: ein garstig‘ Lied in Scharlachrot_
Das Wort „Rache“ ist an die Wand eines leeren Hauses in London gekritzelt, in dem die Polizei die Leiche eines Mannes gefunden hat. Um das Rätsel zu lösen, bittet Scotland Yard einen jungen Mann um Hilfe, der über einen analytischen Verstand verfügt und dem es offenbar Vergnügen bereitet, die kniffligsten Rätsel zu lösen: ein gewisser Sherlock Holmes. Als dieser Holmes zusammen mit seinem neuen Wohngenossen Dr. John Watson auf der Szene des Verbrechens erscheint, zweifeln die Inspektoren und Polizisten des Yard erst einmal, was Amateure wie diese beiden ausrichten können. Sie sollen sich schon bald wundern.
_Der Autor_
Sir Arthur Conan Doyle lebte von 1859 bis 1930 und gelangte mit seinen Erzählungen um den Meisterdetektiv Sherlock Holmes zu Weltruhm. Dabei begann der Mediziner, der eine eigene Praxis hatte, erst 1882 mit dem Schreiben, um seinen Einkommen aufzubessern. Neben mystischen und parapsychologischen Themen griff er 1912 auch die Idee einer verschollenen Region (mit Dinosauriern und Urzeitmenschen) auf, die von der modernen Welt abgeschnitten ist: [„The Lost World“ 1780 erwies sich als enorm einflussreich und wurde schon 13 Jahre später von einem Trickspezialisten verfilmt.
Weitere Holmes-Hörspiele auf Englisch im |Hörverlag| sind „The Hound of the Baskervilles“ und „The Sign of Four“.
Mehr von Arthur C. Doyle auf |Buchwurm.info|:
[„Eine Studie in Scharlachrot“ 1780 (Buchausgabe)
[„Die geheimnisvolle Kiste“ 3756 (Hörbuch)
[„Der Patient“ 3609 (Hörspiel)
[„Der griechische Dolmetscher“ 2427 (Hörspiel)
[„Im Zeichen der Vier“ 2285 (Hörbuch)
[„Der Bund der Rothaarigen“ 2268 (Hörbuch)
[„Neue Fälle von Sherlock Holmes & Dr. Watson“ 2148 (Hörspiel)
[„Sherlock Holmes Collectors Edition II“ 2130 (Hörspiel)
[„Sherlock Holmes Collectors Edition I“ 1950
[„Der Hund der Baskervilles“ 1896
[„Die vergessene Welt“ 1780
[„Der Fall Milverton / Der Teufelsfuß“ 1410 (Hörspiel)
[„Der Vampir von Sussex / Das gefleckte Band“ 1240 (Hörspiel)
[„Das Zeichen der Vier“ 1234 (Hörspiel)
Themenverwandtes bei |Buchwurm.info|:
[„Sherlock Holmes und der Fluch von Addleton“ 417
[„Sherlock Holmes – Mythos und Wahrheit. Eine Spurensuche mit Musik und Geräuschen“ 3916
[„Sherlock Holmes. Die unautorisierte Biographie“ 3428
[„Sherlock Holmes und die Riesenratte von Sumatra“ 3083
[„Sherlock Holmes und der Fall Houdini“ 2339
[„Sherlock Holmes: Schatten über Baker Street. Mörderjagd in Lovecrafts Welten“ 1893
_Die Sprecher & die Inszenierung:_
|Sherlock Holmes:|
Clive Merrison, geboren 1945, wurde bekannt durch seine Arbeit beim Fernsehen, am Theater und beim Rundfunk. Seine erfolgreichsten Produktionen sind „Dr. Who“, „Yes, Prime Minister“ und „Saving Grace“ (Grasgeflüster). Merrison ist der einzige Schauspieler, der es geschafft hat, Holmes in den Bearbeitungen sämtlicher Kurzgeschichten und Romane zu spielen, in denen der berühmte Detektiv auftritt (und das sind mehrere Dutzend Werke).
|Dr. John Watson:|
Michael Williams, geboren 1935, war ein britischer Schauspieler irischer Herkunft. Er trat regelmäßig im Fernsehen und in Filmen wie „Educating Rita“ oder „Henry V.“ auf. In Radiospielen lieh er vielen Figuren seine Stimme. 1971 heiratete er die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin Dame Judi Dench (geb. 1934, ‚M‘ in „James Bond“), mit der er erfolgreich in mehreren Sitcoms zusammenarbeitete. Williams starb 2001.
Regie führte Ian Cotterel, die Hörspielfassung erarbeitete Bert Coules, für eine Produktion der BBC aus dem Jahr 1998. Die Violine spielt laut Booklet Abigail Young, laut Ansage aber Alexander Balanescu. Vielleicht spielten ja beide.
_Handlung_
Um das Jahr 1886 lebt der Militärarzt Dr. John Watson wieder in London, nachdem er im zweiten Afghanistankrieg verwundet wurde und an Typhus erkrankt war. Nun lebt er von einer winzigen Rente und erträgt die Schmerzen in seiner Schulter. Da kommt ihm das Glück zu Hilfe. Sein guter Bekannter Stanford, ein Medizinstudent, erzählt ihm von einem Mann an der Uni, der einen Mitbewohner für eine gemeinsame Mietwohnung sucht. Watson ist sofort hellhörig, aber Stanford warnt ihn vor diesem seltsamen Vogel. Dieser Sherlock Holmes betreibe makabere Experimente mit Tierkadavern. Indeed!
Waltson und Holmes nehmen die Wohnung, die Mrs. Hudson in der Baker Street 221B anbietet, und versuchen, sich aneinander zu gewöhnen. Holmes ist wirklich gewöhnungsbedürftig, und Watson macht sich eine ganze Liste mit seinen Mängeln, insbesondere seiner Ahnungslosigkeit auf bestimmten Wissensgebieten. Eines Tages verrät ihm Holmes endlich, was er eigentlich beruflich tut: er ist beratender Ermittler. Private und behördliche Schnüffler bitten ihn um seine Dienste, sein bester Kunde sei Inspektor Lestrade vom Scotland Yard, der britischen Kripo. Aber die Zeiten sind Holmes zu ruhig – er kann seine Fähigkeit der analytischen Deduktion kaum unter Beweis stellen. Da kommt ihm ein neuer Mord wie gerufen.
Zusammen mit Dr. Watson, den er als Assistenten missbraucht, besichtigt Holmes den Tatort, der sich in einem leerstehenden Haus in Brixton befindet. Die Inspektoren Lestrade und Tobias Gregson sind bereits vor Ort. Holmes warnt Watson, dass der Tatort seine Nerven belasten könnte. In der Tat sieht all das viele Blut um die Leiche eines Mannes am Boden nicht sehr beruhigend aus. Dessen Körper ist völlig verdreht, weist aber seltsamerweise keine Wunde auf. Doch einmal am Mund des Toten geschnuppert und beide wissen Bescheid: Gift. Und an einer Wand des Zimmers steht mit Blut geschrieben das deutsche Wort „RACHE“. Für Lestrade ist der Fall klar: Es hat etwas mit einer Frau namens RACHEL zu tun. Holmes ist sich da nicht so sicher. Er gedenkt seinen Fall zu einem Gesamtkunstwerk zu machen, das er „Eine Studie in Scharlachrot“ (A Study in Scarlet) nennen will.
Der Tote wird als der Amerikaner Enoch Drebor identifiziert, er habe in der Pension einer Madame Charpentier logiert, zusammen mit seinem Sekretär Joseph Stangerson. Hier bohrt Tobias Gregson besonders intensiv nach und fördert schon bald zutage, dass Charpentiers Sohn Arthur heftigen Streit mit den beiden Amis hatte, weil sie sich an seiner Schwester Alice vergriff. Es kam zu einer Schlägerei auf der Straße und Arthur verschwand. Alles klar wie Kloßbrühe: Arthur muss der Mörder sein.
Holmes beliebt, anderer Meinung zu sein, ist aber weit davon entfernt, Gregson den Tag zu vermiesen. Für ihn ist das wichtigste Indiz an der Leiche der weibliche Ehering, der so gar nicht zu den beiden Amis passt. Es geht also um eine Frau innerhalb einer Dreiecksgeschichte. Holmes gibt in Watsons Namen (er will nicht in Erscheinung treten) eine Zeitungsannonce auf, in der er nach dem Besitzer des Rings sucht. Unterdessen lässt er seine Kindertruppe von Möchtegernpolizisten nach Verdächtigen suchen.
Gregson triumphiert gerade über seinen Fahndungserfolg, als Lestrade eintrifft. Er habe einen weiteren Ermordeten entdeckt. Dreimal darf man raten, um wen es sich handelt.
_Mein Eindruck_
Schon in dieser ersten Erzählung, die im Dezember 1887 veröffentlicht wurde und ihren Helden unsterblich machte, bietet der Autor fast alle Charakteristika auf, die den berühmten Detektiv kennzeichnen. Er hat einen scharfen, wenn auch etwas eingleisigen Verstand, praktisch kein Privatleben, spielt leidenschaftlich gerne die Geige und ist stets für einen blutigen Mord zu haben. Dass er sich so gut mit Kindern und seiner Haushälterin/Vermieterin versteht, grenzt an ein Wunder.
|Der Auftrag|
Noch erstaunlicher ist sein letzter Satz: „Write your book, Dr. Watson“, aber das geschieht aus purem Eigennutz. Die beiden stümperhaften Inspektoren Lestrade und Gregson beanspruchen nämlich laut Zeitung alle Lorbeeren für sich und wagen es sogar, den „Amateur-Detektiv“ Sherlock Holmes ihren „Schüler“ zu nennen – diese Unverfrorenheit! Um der Nachwelt ein „richtiges“ Bild vom Schaffen des kompetentesten Detektivs der Welt zu hinterlassen, kommt ihm Dr. Watson als Biograph gerade recht. Das kann Dr. Waltson nur angenehm sein, denn er hat bereits seine Bewunderung für Holmes ausgedrückt. Der Titel für das erste Werk dürfte wohl klar sein.
|RACHE|
Doch worin liegt nun die Lösung des blutigen Doppelmordes, mit diesem mysteriösen Wort „RACHE“ an der Wand? Die Kripo verfällt natürlich auf das Naheliegende, dass sich hier nämlich politische Flüchtlinge aus Deutschland an Amerikanern rächen wollten. Doch Holmes ist alles andere als ein Freund des Naheliegende und Offensichtlichen. Das könnte ja jeder Stümper kapieren, aber das sei genau das, was die Verbrecher wollten. Nein, so blöd ist er nicht.
Allerdings ist auch Holmes nicht allwissend, denn der Verdächtige schlägt ihm geschickt ein Schnippchen. Um den Ring abzuholen, tritt eine ältere Dame auf, die sich Mrs. Sawyer nennt. Nachdem sie gegangen ist, folgt er ihr unauffällig oder vielmehr ihrer Droschke. Als die Mietkutsche an ihrem angegebenen Ziel eintrifft, ist jedoch von „Mrs. Sawyer“ weit und breit nichts zu sehen. Sie hatte sich verkleidet und war natürlich ein Mann! Homes lacht herzhaft über seine eigene Stupidität.
|Das Geständnis|
Sobald der Täter sich dann selbst zeigt – was an sich schon recht verwunderlich ist -, will er auch sogleich ein Geständnis ablegen. Schließlich sei er ein todkranker Mann, der jeden Augenblick den Löffel abgeben könne, erkennt Dr. Watson. Bequemerweise erfolgt das Geständnis im Kripohauptquartier, vor den Ohren von Lestrade und Gregson, und natürlich Holmes. Die ganze verhängnisvolle Dreiecksgeschichte begann vor nicht weniger als vierzig Jahren in jenem trockenen Landstrich westlich der Rocky Mountains, der den Briten als „Zentralamerikanische Wüste“ bekannt ist.
Durch die Assoziation mit den Mormonen erklärt sich auch der erstaunliche Titel des zweiten Teils des Hörspiels: „The Country of the Saints“. Die Mormonen nennen sich bekanntlich gar nicht nach dem Buch Mormon ihres Gründers John Smith, sondern als „Heilige der letzten Tage“ (Latter Day Saints). Ihre Hauptstadt ist Salt Lake City. Ich war selbst dort und habe die riesige Kathedrale bewundert – den Tempel! – und das Hochhaus, in dem sich das Hauptquartier des Ordens befindet.
|Die Wirkung|
Ich werde hier nicht das ganze Geständnis wiedergeben, das Jefferson Hope ablegt. Aber der Fall ist im Grunde klar. Für die von ihnen geraubte Braut rächte er sich an Drebor und Stangerson auf grausame Weise, nach zwanzig Jahren der Verfolgung. Diese Geschichte bildet den Kern des zweiten Teils: sehr romantisch und bewegend mit einer tragischen Romanze und einer erbitterten Verfolgungsjagd, schon fast ein Western.
Die Zeitgenossen des Autors müssen hingerissen gewesen sein, obwohl das Buch zuerst in den USA erschien und als „shilling shocker“ (= Pulp Fiction) nicht gerade höchsten literarischen Rang genoss. Ganz im Gegenteil. Erst die Sherlock-Story „Ein Skandal in Böhmen“, die ab 1891 im „Strand Magazine“ erschien, brachte ihrem Autor den erhofften Durchbruch.
_Die Inszenierung_
|Die Sprecher|
Das ganze Hörspiel dreht sich im Grunde nur um die zwei Hauptfiguren Watson und Holmes. Folglich sind ihre Sprecher die wichtigsten im ganzen Ensemble – und es ist ein beachtlich kompetentes Ensemble, gegen das sie sich durchsetzen müssen. Dass Michael Williams seinen Dr. Watson wie den älteren Herrn spielt, den wir alle sattsam aus unzähligen Holmes Verfilmungen kennen, war zu erwarten. Doch Williams verleiht Watson keineswegs den Charakter eines leicht debilen, gutgläubigen Medizinmannes, wie er so unsäglich von Nigel Bruce porträtiert wurde. Dieser Watson ist ein Armeemann und hat einiges vom Leben gesehen. Dennoch bereitet ihm der blutige Tatort in Brixton Albträume.
Die eigentliche Überraschung liefert Clive Merrison (der auf dem Foto auf der CD-Rückseite selbst etwas debil dreinschaut), denn mit dem herzhaften Lachen, in das Holmes so häufig und gerne ausbricht, hatte ich nicht gerechnet. Das ist ein ganz anderer Holmes als der von Basil Rathbone, nicht düster, sondern weltoffen und verständnisvoll, nicht neurotisch, sondern einfühlsam. Dies ist ein menschliches Wesen, mit dem wir – beinahe – mitfühlen können, so etwa, wenn er sich um seine Meriten als Detektiv Sorgen macht und an eine Art PR-Feldzug denkt, mit Watson als Manager.
|Geräusche|
Wozu kleckern, wenn man auch klotzen kann, dachte sich wohl der Sounddesigner und lässt das Hörspiel gleich mit Kanonnendonnern und Gewehrschüssen beginnen. Verwundete schreien nach Doktor Watson, da fallen zwei Schüsse – Watson hat’s erwischt, verkündet die unheilvolle Stille. Nach der Ansage beginnt Dr. Watsons alias Michael Williams‘ ruhige Stimme von den nachfolgenden Ereignissen zu berichten, die zu seiner langen Bekanntschaft mit Holmes führen sollten.
Die Geräusche im Hintergrund sind realistisch, passend und verdecken nie den Dialog. Allerdings muss man sich eine Szene, die in sukzessiven Ausschnitten dargestellt wird, selbst zusammenreimen. Es handelt sich um die Auseinandersetzungen in der Pension der Madame Charpentier, bei denen die betrunkenen Amerikaner ihre Familie drangsalieren. Diese Szene ist clever eingesetzt, denn sie lässt ein Rätsel offen: Hat Arthur Charpentier wirklich Enoch Drebor getötet – oder war es ganz anders?
Es gibt ein paar Soundeffekte, die mich stutzen ließen. Einer davon ist der einer riesigen schlagenden Uhr, als ob sich das Uhrwerk Big Bens (nicht die Glocken!) im Wohnzimmer befände und mit einem feinen Mikro aufgenommen und tausendmal verstärkt würde. Die Wirkung ist unheimlich, denn der Sound kündet Unheil an, nach dem Motto: Wem die Stunde schlägt …
|Musik|
Ich bin nicht sicher, ob das Geigenspiel Basil Rathbones zur Musik zählt, aber dasjenige, das wir in diesem Hörspiel zu hören bekommen, tut es ganz bestimmt. Wir hören lieblichen Bach, elegischen Wagner und noch einiges mehr. Im Outro erklingt die Violine zusammen mit einer Flöte und einem romantischen Piano und geleitet den Hörer wieder zurück in seine eigene Welt. Holmes singt sogar! Dies ist das erste Mal, dass ich Holmes singen hörte. Vielleicht zählt das zu seinem Gesamtkunstwerk „Studie in Scharlachrot“.
Relativ unheimlich ist der gestrichene Kontrabass, der am Anfang der zwei Teile mit tiefsten Bässen erklingt. Dagegen hebt sich die flotte Pausenmusik, welche die Szenen trennt, geradezu wohltuend ab. Man sieht, dass es eine ganze Palette von Musik gibt. Trotzdem ist das Hörspiel weit davon entfernt, ein Musical zu sein.
_Unterm Strich_
Sherlock Holmes und Dr. John liefern sich bereits in diesem ihrem ersten Fall die typischen Diskussionen, wobei Watson stets der Stichwortgeber ist und Holmes allzu häufig der Schlaumeier, der sich alles bereits aus winzigsten Details zusammenreimt. Schon die erste Begegnung ist symptomatisch. Holmes begrüßt Watson als Mann, der in Afghanistan war. Der gute Doktor ist natürlich von den Socken, aber Holmes hält mit des Rätsels Lösung nicht hinterm Berg.
Spannung, Action, Humor, geistvolle Diskussionen, eine Romanze – alle Sherlock-Freunde kommen also schon im ersten Fall voll auf ihre Kosten. Unglaublich, dass der Autor seinen Helden bereits sieben Jahre später, 1893, sterben ließ. Auf Druck des Publikums (und der Königsfamilie) musste er Holmes eine Auferstehung widerfahren lassen, so dass ab „The Hound of the Baskervilles“ (1901/02) weitere Geschichten mit dem beliebten Detektiv erscheinen konnten.
|Das britische Hörspiel|
In zweimal 56 Minuten erzeugt der Dramaturg Bert Coules erst eine Menge Spannung, dann eine ganze Menge von Action und Rührung. Schließlich geht es um eine tragische Dreiecksgeschichte. Der erste Teil gefiel mir wesentlich besser, weil er spannender und optimistisch gestimmt ist.
Das Englischniveau ist nicht „beginner“, sondern „intermediate“, also mittelschwer. Das erfordert Gymnasial- oder Uni-Ausbildung. Auch ich mit abgeschlossenem Magister und Englandaufenthalt konnte nicht alles restlos verstehen. Zum Glück reden die Sprecher wenigstens keinen Dialekt wie etwa Cockney. Ein Akzent ist aber dennoch hin und wieder zu hören. Merrison und Williams befleißigen sich aber des reinsten |BBC|-Englisch und sind sehr klar zu verstehen. Englischlernende dürfen aufatmen.
|A Study in Scarlet, 1887
BBC-Produktion 1998
112 Minuten auf 2 CDs
ISBN-13: 978-3-86717-303-2|
http://www.hoerverlag.de
_Die perfekte Ermittlung, mit Schwächen_
„Schlimmer geht es nicht“, denkt Chief Inspector Frank Jacobson, als in Crowby ein Drogendealer gefoltert und verbrannt aufgefunden wird. Nur 48 Stunden später gibt es einen noch grausigeren Fund: Das Oberhaupt von Crowbys „Familie des Jahres“ hat, wie es aussieht, erst seine Frau und die drei Kinder umgebracht und dann sich selbst erhängt. Nur eine hat das Blutbad überlebt: die Freundin der Jüngsten – und Tochter von Sheryl Holmes, der Geliebten des toten Drogendealers. Doch die Zehnjährige spricht nicht mehr. (Verlagsinfo)
_Der Autor_
Iain McDowall wurde in Kilmarnock, Schottland, geboren und war Universitätsdozent für Philosophie und Computerfachmann, ehe er als Autor von Kriminalromanen hervortrat. Heute lebt er im englischen Worcester, in den Midlands, wo sich seine fiktive Stadt Crowby befindet. Hier spielen McDowalls Romane um die Polizisten Jacobson und Kerr.
Weitere Crowby-Romane, die bei |dtv| erschienen, sind „Zwei Tote im Fluss“ und „Gefährliches Wiedersehen“. Für August 2009 ist „So gut wie tot“ angekündigt.
_Sprecher & Produktion_
Herbert Schäfer, 1968 in Bonn geboren, absolvierte seine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule. Es folgten Engagements an den Münchner Kammerspielen, am Ulmer Theater, am Düsseldorfer Schauspielhaus sowie am Theater Freiburg. Er arbeitete mit namhaften Regisseuren zusammen und ist zudem regelmäßig in Kino- und Fernsehproduktionen zu sehen.
Schäfer liest eine von Cathrin Claußen gekürzte Textfassung. Regie führte Sebasian Reiß. Die Aufnahme erfolgte bei Acoustic Media in Freiburg.
_Handlung_
Darauf haben Charlie Taylor und Billy „Florida Boy“ Billston gewartet: Sheryl Holmes verlässt mit ihren zwei Töchtern Ann Marie und Lucy den Wohnblock, um sie zur Schule im „guten Viertel“ The Bartons zu bringen. Sie kommt aus der Sozialwohnung, in der sich noch ihr Lover David Carter befindet. Dave ist Barmann im Pub „Poet’s“ und Drogendealer. Charlies und FBs Auftrag lautet, Dave eine Abreibung zu verpassen.
Doch als sie Dave aus dem Bett zerren und mit der Drohung, ihn mit dem elektrischen Kamin zu verbrennen, gefügig machen wollen, macht der einen auf Macho und wehrt sich. Na so was! Das treibt den eh schon labilen FB zur Weißglut. Mit einem Montiereisen schlägt er Dave den Schädel ein. Au Backe, was wird wohl der Auftraggeber davon halten, fragt sich Charlie. Der will von der ganzen Geschichte nichts wissen. Sie haben’s verbockt, nun müssen sie sehen, wo sie bleiben. Tja, Probezeit ist harte Zeit. Und dass sie ihn ja nie wieder anrufen! Dabei hat ihm Charlie noch gar nicht alles gesagt, was sie angestellt haben …
Florida Boy hat sich Verbrennungen zugezogen, doch sie können damit nicht zum Arzt, ist ja logo. Deshalb muss Charlies Bekannte, die schnuckelige Lisa, ran und die Wunden behandeln. Lisa glaubt, er wolle was von ihr, und findet sich dazu bereit. Aber als Charlie mitbekommt, welchen Zinnober die Bullen wegen des Todes von Dave veranstalten, kriegt er kalte Füße: Sie müssen weg. Auch dagegen hat Lisa nix einzuwenden. Klasse, denkt Charlie mit einem Blick auf Lisas Brüste, und klaut das nächstbeste Auto.
Für Chief Inspector Frank Jacobson ist der Fall David Carter ein Fall wie jeder andere. In dem Sozialghetto Woodlands ist so was ja nichts Ungewöhnliches. Carter war Drogendealer und muss jemanden gelinkt haben. Der Inspektor lässt seine Untergebenen ihre Pflicht und Schuldigkeit tun und tröstet Sheryl Holmes, die von dem Verlust ihres Geliebten und ihrer abgefackelten Wohnung ganz schön erschlagen ist. Nur noch ihre persönlichen Dokumente hat sie gerettet, weil sie die stets in ihrer Handtasche mit sich herumschleppt.
Doch es gibt wenigstens einen kleinen Lichtblick. Sie kommt bei ihrer Freundin Candice unter und Ann Marie darf sogar bei den Eltern ihrer Schuldfreundin Sarah Adams übernachten. Vielleicht hat sie nochmal Glück gehabt, denn ihre neue Sozialwohnung bekommt sie sicher erst in ein paar Tagen gestellt. Und Ann Marie bekommt mal ein schönes Heim zu sehen statt der Drecklöcher, in denen sie sonst mit ihrer alleinerziehenden Mutter leben muss. Doch auch dieser Traum währt nicht lange …
Der Bauunternehmer Stephen Adams, der Vater von Sarah und ihren zwei Brüdern, weiß schon seit Monaten, dass sein Unternehmen am Abgrund steht, dazu braucht er nicht erst die Kassandrarufe seines freiberuflichen Buchhalters Alan Jones zu hören. Darauf einen Doppelten! Steve macht sich erst einmal einen schönen Abend bei einer Preisverleihung der Lokalzeitung: Die Adams‘ werden als „Familie des Jahres“ ausgezeichnet. Nach einem weiteren Doppelten wirft sich Steve auf dem WC noch eine Doppeldosis Antidepressiva ein. Gleich fühlt sich total entspannt. Der Abend wird wunderbar. Um Mitternacht beginnen die Albträume …
Als Frank Jacobson zum Haus der Adams gerufen wird, warnt ihn der Leiter der Spurensicherung vor: Es ist schlimm. In der Eingangshalle baumelt ein Mann vom Treppengeländer herab. Das war wohl mal der Herr des Hauses. „Es gibt noch mehr.“ Sie gehen nach oben. Das Zimmer der Jungs ist voll Blut, sie haben sich wohl gewehrt. Nicht so hingegen die Ehefrau Marion und die Tochter Sarah. Steve Adams hat sie wohl mit einem Kopfkissen erstickt.
Als Jacobsons Blick aus dem Fenster in den Garten fällt, eilt er hinunter ins Erdgeschoss, dann in den Garten. Er geht zu einem großen Baum, in dem er ein Baumhaus erspäht hat. Darin kauert ein kleines Mädchen und zittert am ganzen Leib. Es ist Ann Marie Holmes, wie sich herausstellt. Und sie ist unfähig, über das zu sprechen, was sie in der vergangenen Nacht im Haus gesehen hat, als der Tod sein Werk verrichtete.
_Mein Eindruck_
Natürlich hängt der Tod von Dave Carter, dem Drogen dealenden Barmann, mit dem von Steve Adams zusammen. Aber wie das genau erfolgt ist, das herauszufinden ist die Aufgabe von Chief Inspector Frank Jacobson. Zum Glück ist Jacobson sowohl ein gewiefter Bursche, der sich einen Fall nicht einfach durch die Drogenfahndung wegnehmen lässt, als auch ein energischer Fahnder, der seine Leute in alle Richtungen mit Nachdruck und Hartnäckigkeit ermitteln lässt. Von ihm könnte sich der behäbige Inspektor Barnaby noch ein Stück abschneiden, der im idyllischen Midsomer aufklärt.
|Familienvernichter|
Dass Jacobsons neuer Fall berührt, ist der Familientragödie um Steve Adams zu verdanken. Das Täterprofil entspricht dem des „Familienvernichters“: Wenn er schon selbst untergehen soll, dann soll auch seine Familie mit – und dran glauben. So ist es erst vor wenigen Wochen ganz real in England passierte, als der bankrotte Familienvater, ein Unternehmer, nicht nur sämtliche Angehörigen meuchelte, sondern auch die Haustiere nicht verschonte, um schließlich auch noch das Haus abzufackeln. So sollte seinen Gläubigern nichts mehr zu holen übrig bleiben.
|Bindeglied|
Im Fall Steve Adams sprechen jedoch einige Indizien und eine Zeugenaussage gegen die Vermutung, dass sich Adams auch selbst umbrachte. Der Täter ist das zweite Bindeglied zwischen dem Mord an Carter und dem an Adams. Das erste Bindeglied ist Ann Marie, die Tochter Sheryl Holmes‘. Die Genesung des Mädchens durch eine Expertin der psychologischen Betreuung ist wirklich anrührend. Erst durch Malen kann sich die wichtigste Zeugin ausdrücken. Zum Schrecken ihrer Mutter.
|Bad boys|
Diese Tragödie steht im krassen Gegensatz zu den frivolen Aktivitäten Charlie Taylors und seiner Freundin Lisa, von Florida Boy ganz zu schweigen. Hier wird ohne Fingerzeig deutlich gemacht, dass diese jungen Leute keine Hoffnung und keine Zukunft haben. Charlie hofft lediglich, noch ein paar Tage mehr in Freiheit bleiben zu können, bevor sie ihn schnappen. Er kann im Fernsehen zusehen, wie ihm die Bullen auf die Schliche kommen und sich nähern. Von einem „Getaway“ ist er jedoch weit entfernt. Hundertprozentig hat mich seine Figur nicht überzeugt: zu wenig Reflexion, zu wenig Energie. Und was er zusammen mit Lisa mit Florida Boy angestellt hat, wird zwar ganz am Schluss in einem der zahllosen inneren Monologe verraten, aber so ganz leuchtet es auch nicht ein. Warum sollte Lisa auf FB wütend sein?
|Der Sprecher|
Herbert Schäfer, den ich bislang nicht kannte, hat mich durch seine Vielseitigkeit in der stimmlichen Darstellung beeindruckt. Ihm gelingt es, sowohl weibliche wie männliche Figuren glaubhaft sprechen zu lassen, und zwar so, dass sie der Hörer leicht unterscheiden kann. So ist beispielsweise Lisa mit einer hohen Stimme versehen. Sie klingt zwar nicht wie Charleys Tante, ragt aber natürlich heraus, und man wartet schon aufs nächste Mal, dass sie wieder zu hören ist. Wesentlich glaubwürdiger ist die ungewöhnlich sanfte Stimme der Psychotherapeutin Burke, die Ann Marie betreut.
Ihr Gegenteil sind sicherlich die Tunichtgute Charlie, der Autoknacker, und Florida Boy, der labile Ausraster. Auch deren Auftraggeber Terry Shields klingt wie ein harter Bursche. Doch er beißt sich an Frank Jacobson die Zähne aus, der zudem noch viel Erfahrung mitbringt. So kann es der Chief Inspector locker nicht nur mit Typen wie Shields und Fliegengewichten wie Ray Walsh – ebenfalls eine tolle Charakterstimme – aufnehmen, sondern mit solchen aufgeblasenen Wichtigtuern wie seinem Chef DCS Greg Salter, der total arrogant und aalglatt daherkommt.
Der Abschuss ist sicherlich Alan Jones, der hochmütige Buchhalter des armen Steve Adams. Sehr interessant fand ich auch die Nebenfigur Peter Robinson (der Mann trägt den gleichen Namen wie ein erfolgreicher britischer Krimiautor). Der Pathologe wird durch seine besondere Redeweise zum Leben erweckt: Er stottert und stammelt, dass das, was er zu sagen hat, ganz besonders spannend wird. Es gibt noch andere Figuren, so etwa den mampfenden Kollegen Jacobson, der erstmal sein Mittagessen im Meeting runterwürgen muss – und währenddessen spricht. Kein schöner Klang.
Schäfer macht also auch noch aus den Nebenfiguren interessante Eindrücke. Erst so ergibt sich aus dem Gesamtbild der Figuren das Abbild einer sozialen Gemeinschaft. Und das ist genau das, was der Autor beabsichtigt hat (und was jedem Krimiautor am Herzen liegen sollte).
Geräusche und Musik gibt es nicht, weshalb ich darüber kein Wort zu verlieren brauche. Was mich jedoch geärgert hat, ist die Tatsache, dass nirgendwo auf dem Hörbuch die Längenangabe vermerkt ist. Neben dem Preis ist dies jedoch eine wichtige Größe, um das Verhältnis zwischen Preis und Leistung (= Länge der Aufnahme) abzuschätzen. Erst im Vergleich mit anderen Produkten anderer Verlage vermag der potenzielle Käufer dann dieses Preis-Leistungs-Verhältnis zu beurteilen. Wer solche Kenngrößen vorenthält, der stellt sich automatisch ins Zwielicht. Leider ist diese Unterlassungssünde bei |Hoffmann & Campe|-Hörbüchern Usus.
_Unterm Strich_
Es ist saubere Polizeiarbeit, die Jacobson den Fall aufklären lässt – so viel darf man auf jeden Fall erwarten. Dass auch in (erfundenen) Städten wie Crowby eine Zweiklassengesellschaft existiert, aber beide Klassen gleichermaßen vom Gleichmacher Heroin erfasst werden, hat man schon in Soderberghs Film „Traffic“ eindrucksvoll geschildert bekommen. Neu ist vielleicht die Botschaft , dass Drogen auch den englischen Alltag einer ländlichen Stadt längst durchdrungen haben. Und dass die Dealer nicht irgendwelche russischen Mafiosi sind, sondern brave britische Buchhalter. Etwas bizarr fand ich, dass eben dieser Buchhalter auch der Territorial Army angehört, die wohl der amerikanischen Nationalgarde entspricht, die ja auch nur eine bessere Miliz ist.
Vergleicht man Jacobsons effiziente Ermittlung, so erscheint die Flucht der Mörder Dave Carters zunehmend als überflüssiges Beiwerk, als eine Art „Getaway“-Szenario, komplett mit Gangsterliebchen Lisa. Klischeehafter geht’s nicht, aber das Leben entpuppt sich ja zunehmend als Abziehbild der Medien, so dass man schon bei manchen Szenen wie etwa einem Brand oder Autounfall allein beim Hinsehen ein Déjà-vu-Gefühl bekommt.
|Das Hörbuch|
Es kann aber auch sein, dass die Bearbeiter des Textes diesen so weit kürzten, dass die wichtigen Zwischentöne, die das Buch unverwechselbar machen, unter den Tisch fielen. Die zahlreichen inneren Monologe sind ein wichtiges Stilmittel, um die Motivation der Figuren zu verdeutlichen. In einer dramatischen Handlung dürfen sie jedoch nicht überhand nehmen, um keine Langeweile aufkommen zu lassen. In dieser Hinsicht ist das Hörbuch dem Buch unterlegen. Dies muss der Sprecher mit entsprechenden stimmlichen Mitteln des Vortrags jedoch auszugleichen wissen. In gewissen Maße gelingt dies Herbert Schäfer auf eindrucksvolle Weise.
|Originaltitel: Perfectly dead, 2003
Aus dem Englischen übersetzt von Werner Löcher-Lawrence
ca. 154 Minuten auf 2 CDs
ISBN-13: 978-3-455-30581-4|
http://www.hoca.de
http://www.dtv.de
http://www.crowby.co.uk
_Im Macbeth-Land: Seestück für Geduldige_
Anonyme Briefe aus Schottland, ein verschwundener Mann und die Schatten der Vergangenheit: Als Kommissar Erik Winter sich auf die Suche nach dem Vater seiner Jugendliebe Johanna Osvald macht, ahnt er noch nicht, worauf er sich einlässt. Axel Osvald ist nach Schottland gereist, um das Rätsel um das Verschwinden seines Vaters John zu lösen. John, ein einfacher Fischer, gilt seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen. Doch auch Axel kehrt nicht zurück. Winter reist in die schottischen Highlands, und es wird eine Reise in die Abgründe der menschlichen Seele …
_Der Autor_
Åke Edwardson, Jahrgang 1953, lebt mit seiner Frau und zwei Töchtern in Göteborg. Bevor er sich dem Schreiben von Romanen widmete, arbeitete er als erfolgreicher Journalist u. a. im Auftrag der UNO im Nahen Osten, schrieb Sachbücher und unterrichtete an der Uni Göteborg „Creative Writing“. Er schrieb bislang zwölf Kriminalromane; zuletzt erschienen auf Deutsch „Segel aus Stein“ und [„Zimmer Nr. 10“ 2792 sowie „Rotes Meer“.
_Der Sprecher_
Boris Aljinovic, geboren 1967 in Berlin, war nach dem Schauspielstudium an der Hochschule „Ernst Busch“ am Berliner Renaissance-Theater und am Staatstheater Schwerin engagiert. Es folgten zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen, so etwa 1999 in „Drei Chinesen mit dem Kontrabaß“ und 2004 in Otto Waalkes‘ Filmerfolg „Sieben Zwerge – Männer allein im Wald“. Seit 2001 spielt er den Kommissar Felix Stark an der Seiten von Dominic Raacke im Berliner „Tatort“. Der Schauspieler lebt in Berlin. Er liest eine gekürzte Fassung.
Regie führte Gabriele Kreis im |studio-wort|, Berlin Juni 2008.
_Handlung_
Ein alter Mann, den wir als schließlich als John Osvald kennenlernen, verbringt seine Tage in einem kleinen Fischerort an der schottischen Ostküste. Er lebt in einem abgelegenen Haus, geht täglich ins Pub, schaut sich die Gegend an, als warte er auf etwas. Doch in seiner Jackentasche steckt eine Pistole. Unentwegt fleht er bei sich: „Jesus, save my soul.“ Er ahnt, dass das Ende nah ist.
|Göteborg|
Der schreckliche G8-Gipfel in Göteborg ist vorüber, und so hat Kommissar Winter endlich wieder Zeit für seine Familie. Er fährt mit seiner Frau Angela und der vierjährigen Tochter Elsa an die Küste, wo sie sich ein Baugrundstück kaufen wollen. Aber im Polizeipräsidium wartet wieder Arbeit auf ihn. Johanna Osvald, um die vierzig wie er selbst, hat ein Anliegen. Sie war mal seine Jugendliebe in einem sehr schönen Sommer. Er kann ihr ihren Wunsch also nicht abschlagen.
Sie berichtet, dass ihr Großvater John Osvald im II. Weltkrieg als Fischer sein Auskommen in Schottland suchte, doch auf einer Fahrt anno 1940 sank sein Schiff. Man hielt ihn für tot. Aber vor zwei Wochen hat sie einen Brief aus Inverness in Schottland erhalten. Winter liest: „Things are not what they look like. John Osvald is not what he seems to be.“ Ein Absender fehlt. Vor zehn Tagen sei ihr Vater Axel Osvald nach Inverness gereist, um Nachforschungen anzustellen, doch seit vier Tagen habe sie keine Nachricht mehr von ihm. Sie befürchtet, dass ihrem Vater ein Unglück geschehen ist.
Winter ruft seinen Kollegen Steve MacDonald in London an. Der ist Schotte, ausgerechnet aus Inverness. MacDonald ruft seinen Kollegen Craig in Inverness an. Winter hat noch keinen Plan, aber er könnte sich vorstellen, zusammen mit MacDonald in Inverness nach den Osvalds zu suchen. Als Stützpunkt könnten sie Steves Schwester Eilidh, eine Juristin, nutzen. Doch zunächst besucht er Johanna und ihren fischenden Bruder Erik auf der Insel Donsö. Dort erfährt er einiges über das, woran Fischer und Seeleute glauben, wenn sie auf dem Meer sind. Wichtiger ist jedoch, was er über John Osvald und dessen Mannschaft im II. Weltkrieg erfährt. Möglicherweise umgibt den Untergang von Johns Schiff ein größeres Geheimnis, als man bislang dachte.
|Auf den Schären|
Es gab zwei Überlebende in Johns Mannschaft, die vom Untergang verschont wurden: Bertil Osvald ist schon tot, aber der alte Arne Algotson lebt noch, mit seiner Schwester Ella. Von ihm erfährt Winter, wo er am besten mit der Suche anfangen sollte: in Frazierburgh, nicht in Aberdeen oder Peterhead. Dort sei John Osvald oft an Land gegangen. Frans Karlsson, einer der Ertrunkenen, war Ellas Verlobter. Das Schiff wurde nie gefunden. Aber warum fuhren Arne und Bertil auf jener letzten Fahrt nicht mit? Diese Frage bleibt unbeantwortet, denn der alte Arne leidet unter Altersdemenz und singt statt einer Antwort nur „Bucky boys are back in town“. Er nennt leise einen Namen: Cullen. Winter findet den Ortsnamen im Atlas. Es ist morgens um vier Uhr dreißig.
Interpol ruft an. Es ist Kommissar Graig aus Inverness. Man hat Axel Osvald tot an einem See im Hochland gefunden. Er war nackt, seine Kleider waren über mehrere Meilen verstreut, wahrscheinlich starb er an einem Herzinfarkt durch Unterkühlung. Offenbar war er geistig verwirrt in Fort Augustus am Loch Ness aufgetaucht und habe Touristen angesprochen. Johanna fliegt sofort hin, um ihn zu identifizieren und nach Schweden zu bringen. Auch Graig sagte: „Things are not the way they look like.“ Wie in dem Brief des Unbekannten.
|Schottland|
Als Winter seine Frau fragt, ob sie sich eine Woche Urlaub in Schottland vorstellen könne, ist die ziemlich erstaunt. Winter schlägt vor, die kleine Elsa bei seiner Schwester Lotte unterzubringen, denn die lebe jetzt ganz allein. Angela kommt also mit nach Inverness. Dort treffen sie Steve MacDonald und dessen Frau Sarah. Während sich die Frauen die schönen Highlands und die Stadt Edinburgh ansehen, setzen sich die beiden Kriminaler auf die Fährte von Axel und John Osvald.
Der alte Mann geht wie immer täglich in den Pub, trinkt Bier und Whisky, schaut die Kellnerin an, die Touristen – Kontrollblicke. Dann fallen ihm die zwei Männer auf, die ebenfalls Kontrollblicke schweifen lassen. Er packt die Pistole in seiner Jackentasche fester …
_Mein Eindruck_
Wenn man Krimis mit Begriffen aus der Malerei bezeichnen dürfte, so würde ich diesem Buch das Etikett „Seestück“ aufkleben. Das Meer und seine Nutzer spielen eine zentrale Rolle: Es trennt und verbindet, es nährt und vernichtet. Die Geschichte besteht daher wie das marine Wetter fast nur aus Stimmungen, kaum aus Handlungen und Dialogen. Diese Stimmungen sind jedoch mit der Last der Vergangenheit aufgeladen, mit einer großen Schuld, die auf den Tätern und den Überlebenden lastet. Wer weiß, wie weit diese Schuld noch verteilt ist. Am Schluss müssen sich diese Spannungen jedoch entladen. Niemand ahnt, wen die gewaltsame Entladung treffen wird. (Und ich werde mich hüten, dies zu verraten.)
Kommissar Winter ahnt nicht, worauf er sich einlässt, als er seiner Jugendliebe hilft, ihren Vater und Großvater zu finden. Er muss sich auf das völlig Fremde einlassen, erst auf das Meer und seine Tücken und Bewohner, dann auf das fremde Land, das er nur von einer Studentenreise kennt. Noch unheimlicher ist jedoch die Vergangenheit, auf die er mit Steve stößt. Schmuggler trieben und treiben an der schottischen Küste ihr Unwesen, und im Krieg beförderten sie auch Waffen. Aber nicht etwa für die regulären Streitkräfte, sondern mitunter für schottische Widerstandsgruppen, die gegen die Engländer kämpften. Ein höchst riskantes Geschäft, auf das sich auch die Schweden um John Osvald einließen.
Während Winter und MacDonald in Schottland dem Krümelpfad der Hinweise folgen, machen sie sich – und nicht zuletzt uns – vertraut mit dem Land und seinen Bewohnern. Die Highlands – da gibt es guten Whisky, und an der See, da gibt es leckere Seafood-Gerichte, unter anderem Cullen Skink, eine Fischsuppe. Wie mit allen Dingen sind auch damit Schicksale verbunden. Winter denkt wiederholt an Shakespeares „Macbeth“, an Orten wie Cawdor und Macduff kommt er sogar vorbei. Ist John Osvald so etwas wie Banquos Geist, der seinem Sohn Axel nachging und das Leben aussaugte?
Manche Schicksale sind auf Fotos aus der Vergangenheit dokumentiert, viele nicht. Eines dieser Fotos aus dem Jahr 1945 oder 46 zeigt John Osvald im Profil. Und zum Glück erinnert sich Winters Unterbewusstsein an dieses Foto, bevor sie das Land wieder verlassen. Dieses Tor zur Vergangenheit gewährt Zutritt zum Finale.
|Der Sprecher|
Dass Boris Aljinovic einen „Tatort“-Kommissar spielt, gereicht ihm in vielerlei Hinsicht zum Vorteil. Die Aufgabe, die verschiedenen Figuren stimmlich und sprachlich auf erkennbare Weise zu charakterisieren, bewältigt der Sprecher mit Bravour – ohne sich jedoch zu Karikaturen hinreißen zu lassen. Ich bewundere, wie es ihm gelingt, die einzelnen Figuren auseinanderzuhalten und stets die gleiche Ausdrucksweise für die jeweilige Figur zu finden.
Winter hat stets die gleiche tiefe, ruhige Stimme und langsame Ausdrucksweise, doch in der Ruhe liegt die Kraft. Steve MacDonald ist im Vergleich dazu etwas lebhafter. Man kann sich leicht vorstellen, dass Winter mit MacDonald und Graig englisch spricht. Der Sprecher hat mit Englisch überhaupt kein Problem. Er kann sogar Englisch mit schottischem Akzent sprechen.
Die Frauen haben stets die gleiche höhere Stimmlage, so dass man sie leicht von den männlichen Figuren unterscheiden kann. Und die Alten, von denen es natürlich im Rahmen der Vergangenheitsbewältigung eine Menge gibt, treten stets mit einem gewissen Krächzen auf – tief bei einem Mann, höher bei einer Frau.
Womit sich der Hörer als Erstes auseinandersetzen muss, ist jedoch die ruhige Sprechweise, die Aljinovic dem Erzähler gegeben hat. Auch der Erzähler ist so nordisch ruhig und langsam wie Erik Winter. Das zwingt den Hörer dazu, ebenfalls Geduld zu haben und sich in die Stimmung einzufühlen. Oder er lässt es frustriert bleiben und wählt ein anderes Hörbuch.
_Unterm Strich_
Dieses Buch unterscheidet sich deutlich von anderen Edwardson-Romanen wie etwa dem ausgezeichneten [„Rotes Meer“ 5192 oder „Zimmer Nr. 10“. Es ist sehr langsam, bietet keinerlei Action außer im Finale und verlässt sich stark auf Stimmungen. Wer nun neugierig darauf wartet, was sich denn an Bord der „Marino“, John Osvalds Schiff, vor ihrem Untergang zugetragen hat, der wird a) wenig erfahren und ist b) sowieso auf dem Holzweg.
Denn es geht ja nicht um Aufklärung des Untergangs, sondern um die des Todes von Axel Osvald und aller Rätsel, die damit zusammenhängen. Wer war beispielsweise der Absender jenes Briefes an Johanna, der Axels Reise ausgelöst hat? Wenigstens dies kann Winter herausfinden – mit einer faustdicken Überraschung. Nichts ist ja, wie es zu sein scheint. Und dieser Zustand muss beendet werden, um die Lebenslüge John Osvalds zu einem Ende zu bringen, auf welche Weise auch immer. Dies bedeutet auch die Bewältigung des Krieges und seiner Nachgeschichte. Deshalb endet die Geschichte auf einer heiteren Note, die hoffen lässt.
|Das Hörbuch|
Stimmungen sind in einem Hörbuch leider schwer herzustellen. Darüber sollte sich der Hörer im Klaren sein und nicht etwa auf signifikante Schritte einer Ermittlung hoffen, wie man sie von Arne Dahls A-Gruppe kennt. Vielmehr fühlt sich Erik Winter erst in die Familie Osvald ein und dann in die schottische Umgebung und Kultur. Das ist ein langsamer Prozess, der sich hinzieht. Vielleicht ist das Hörbuch deshalb weniger für ungeduldige Zuhörer geeignet als für Leute, die Zeit mitbringen. Ja, die es sich sogar zweimal anhören würden. Auch die „Entdeckung der Langsamkeit“ will geübt sein.
Sie ist mir leider nicht gelungen, sondern ich bin fast dabei eingeschlafen. Immerhin ist die letzte CD die ereignisreichste, und man sollte dabei genau hinhören, was vor sich geht.
|Originaltitel: Segel av sten, 2002
Aus dem Schwedischen übersetzt von Angelika Kutsch
403 Minuten auf 6 CDs
ISBN-13: 978-3-89903-418-9|
http://www.hoerbuch-hamburg.de
http://www.akeedwardson.se
Es mag auf den ersten Blick albern anmuten, dass Garth Stein in seinem Roman „Enzo. Die Kunst, ein Mensch zu sein“ einen Hund als Ich-Erzähler auftreten lässt. Doch das kann eigentlich nur derjenige behaupten, der sich nicht näher mit dem Buch befasst hat. Denn wer genauer hinschaut, der muss schnell einsehen, dass der vierbeinige Ich-Erzähler ein äußerst raffinierter Zug des Autors ist – und das nicht nur, weil Enzo genau der treue und liebe Weggefährte ist, den sich jeder Hundefreund wünscht …
Enzo lebt mit Herrchen Denny in Seattle und ist mit seinem Leben eigentlich sehr zufrieden. Nach dem, was er im Fernsehen gesehen hat, ist er sich sicher, dass er in seinem nächsten Leben ein Mensch sein wird, und so beobachtet Enzo die Welt um sich herum ganz genau – schließlich hat er noch eine Menge zu lernen.
Herrchen Denny ist ihm da ein guter Lehrmeister. Er ist Rennfahrer und auf bestem Wege, ein Profi zu werden, und vom Rennsport kann auch Enzo eine Menge über das Leben lernen. Ihrer beider Leben verändert sich mit dem Auftauchen von Eve. Enzo weiß, dass Eve für Denny zu wichtig ist, als dass er eifersüchtig auf sie sein sollte, und so lernt er, Eve zu akzeptieren. Eve und Denny heiraten und das Glück ist perfekt, als die kleine Zoë geboren wird.
Doch schon bald legt sich ein dunkler Schatten auf das Familienglück und ihnen allen stehen harte Zeiten bevor. Enzo würde gerne seinen Beitrag leisten, aber da ihm nur die einfachsten Gesten bleiben, kann er sich nicht verständlich machen. Und so muss er zuschauen, wie das Familienglück dahinbröckelt …
Ein Hund als Ich-Erzähler ist für sich genommen schon mal ungewöhnlich, denn eine solche Entscheidung ist immer auch eine Gratwanderung. Schnell kann eine Geschichte auf diese Weise ins Lächerliche abgleiten, weil die Art und Weise der Hauptfigur einfach albern wirkt. Nicht so bei „Enzo“. Garth Stein gelingt das Kunststück, uns einen Hund als Protagonisten vorzusetzen, der zu keinem Zeitpunkt albern wirkt. Enzo ist ein ernstzunehmender Protagonist und ein wahrer Philosoph auf vier Pfoten.
Stein nutzt Enzos Perspektiven, um menschliche Verhaltensweisen aus einem verschobenen Blickwinkel zu betrachten. Enzo beobachtet, kommentiert und lernt. Und als philosophische Spiegelfläche muss immer wieder der Rennsport herhalten, der nicht nur Denny begeistert, sondern seinen Hund gleichermaßen. Immer wieder zieht Stein Vergleiche anhand exemplarischer Beispiele aus dem Rennsport, und so muss auch Enzo mit der Zeit begreifen, dass ein Rennen nie in der ersten Kurven gewonnen wird, dort aber durchaus verloren werden kann.
So entsteht eine Geschichte, die einen wunderbaren Tiefgang beweist. Enzo als Ich-Erzähler läuft damit zu keinem Zeitpunkt Gefahr, lächerlich zu wirken, vielmehr ist er der staunende Außenstehende, welcher der Geschichte durch seine Versuche, die Menschen zu verstehen, eine wunderbare Wärme und Tiefe verleiht.
Was Denny an Schicksal ertragen muss, ist allerhand und schon fast ein bisschen viel des Guten. Doch Denny ist ein Kämpfer und Enzo steht ihm dabei zur Seite – auf seine ganz eigene Art. „Enzo. Die Kunst ein Mensch zu sein“ ist eine Geschichte voller Tragik. Enzos Perspektive sorgt dabei aber auch immer wieder für humorvolle Momente, denn nicht selten ist es gerade das Verhalten des Hundes, das zum Schmunzeln anregt.
Und so entwickelt sich „Enzo. Die Kunst, ein Mensch zu sein“ zu einem Wechselbad der Gefühle und zu einer Geschichte, die weit mehr Tiefgang entwickelt, als man ihr anfänglich zutrauen möchte. Durch Enzos Beobachtungen lernt auch der Leser/Hörer eine Menge über die Menschen – über Freundschaft, Liebe und Verantwortung und darüber, wie man auch im Leben nicht gleich in der ersten Kurve aus dem Rennen fliegt.
Das Konzept von „Enzo. Die Kunst, ein Mensch zu sein“ wirkt so einfach und funktioniert dabei so wunderbar. Man kommt nicht umhin, am Ende zugeben zu müssen, dass „Enzo“ ganz tief zu rühren vermag, und so muss man sich im Finale dann auch mal die eine oder andere Träne wegdrücken.
Seinen Beitrag zum Gelingen des Hörbuchs aus dem |Argon|-Verlag steuert auch Helmut Krauss bei, seines Zeichen Synchronsprecher von Marlon Brando, John Goodman und Samuel L. Jackson. Seine raue, tiefe Stimme passt wunderbar zu Enzo und verleiht der Geschichte zusätzliche Wärme und Tiefe.
Insgesamt bleibt damit ein sehr positiver Eindruck zurück. Eine wunderbar warmherzige Geschichte, die so einfach und doch voller Intensität erzählt wird. Ein sympathischer Titelheld, den nicht nur Hundeliebhaber schnell ins Herz schließen dürften, und ein Plot, der unter die Haut geht. Enzo, den Philosophen auf vier Pfoten, muss man einfach mögen. Und so kommt unterm Strich eine uneingeschränkte Empfehlung dabei heraus, insbesondere auch für das von Helmut Krauss so wunderbar gelesene Hörbuch.
|Originaltitel: The Art of Racing in the Rain
Aus dem Amerikanischen von Werner Löcher-Lawrence
314 Minuten auf 4 CDs
ISBN-13: 978-3-86610-557-7
gebundene Ausgabe bei Droemer, 2008|
http://www.argon-verlag.de
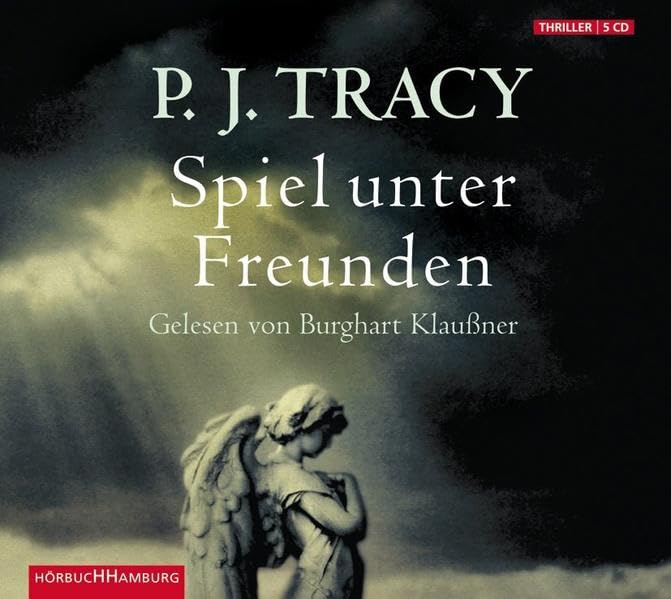
„Monkeewrench“ nennt sich die auf charmante Weise verrückte Fünfergruppe, die in einem Loft in einem abgelegenen Lagerhaus Computerspiele entwickelt. Gerade haben sie ihr neuestes Werk „Fang den Serienkiller“ für den Testbetrieb ins Internet gestellt. Doch ein Spieler dort draußen lässt die Morde detailgetreu und äußerst grausam Wirklichkeit werden.
Die Cops in Minneapolis und im verschlafenen Wisconsin erfahren: Das Spiel hat 20 Levels, und die Zeit drängt. In einem furiosen Showdown zeigt das Böse schließlich sein Gesicht. Und es war die ganze Zeit über beängstigend nah … (Verlagsinfo)
_Inhalt:_
Scotland-Yard-Ermittler Mason Flint steht vor einem Rätsel: Insgesamt fünf Tote wurden in London gefunden, die keinen Tropfen Blut mehr in den Adern hatten und mit einer silbernen Hutnadel gepfählt wurden. Flint glaubt nicht an Vampire, doch bald muss er umdenken, als seine Freundin Frenchy mit einem posthypnotischen Befehl gezwungen wird, ihn zu töten. Kurz darauf verschwindet sie spurlos. Flint verfolgt die Spur unterdessen bis zur amerikanischen Botschaft, und schon bald muss der Sonderermittler feststellen, dass seine Gegnerin übermächtig ist …
_Meine Meinung:_
Nun ist auch Jason Darks neueste Horror-Serie als Hörspiel erhältlich. „Die Hexerin“ ist Trash pur und bildet ein buntes Potpourri aus den unterschiedlichsten Grusel-Klischees der Heftromanliteratur. Allein der Titel erinnert bereits an Wolfgang Hohlbeins Lovecraft-Hommage „Der Hexer“ aus diesem Genre. Der wenig originelle Name der Titelheldin, Doriana Gray, ist natürlich an Oscar Wildes berühmte Romanfigur angelehnt, woraus der Autor auch nie einen Hehl gemacht hat. Interessant ist allerdings, dass Doriana in dieser Folge die Seite des Bösen verkörpert und die Gegenspielerin des Helden Mason Flint ist. Ein wenig erinnert das Gespann an Dorian Hunter und Coco Zamis, beziehungsweise an Mike Hunter und Damona King.
Trotzdem die Vorlage als Taschenbuch im |Mira|-Verlag publiziert wurde, bewegt sich das Niveau der Bücher auf Heftromanlevel und dient lediglich der schnellen Unterhaltung – also die besten Voraussetzungen für eine temporeiche Hörspielserie. Leider machte es sich der Drehbuchautor Marcell Gödde sehr einfach und kürzte das Buch lediglich um einige überflüssige Passagen, übernahm allerdings die Dialoge zum Teil eins-zu-eins aus der Romanvorlage. Da Jason Darks aktuelle Werke immer wieder durch abgehackte, unnatürliche Gespräche glänzen, wirkt auch das Hörspiel oft unfreiwillig komisch – vor allem, weil viele Handlungen der Figuren von diesen im Selbstgespräch erläutert werden. So würde kein normaler Mensch reden, und irgendwie erinnern diese Szenen an die alten |John Sinclair|-Hörspiele aus dem |Tonstudio Braun|.
Dabei erledigt das Gros der meist unbekannten Sprecher seinen Job sehr gut. Vor allem Suzan Erentok als Doriana und Michael-Che Koch als Mason Flint geben glaubhafte Darstellungen ihrer Charaktere ab, und auch Bodo Primus ist als Erzähler eine gute Wahl gewesen. Außerdem hat sich |Cocomico| ein Beispiel an |WortArt| genommen und dem Verfasser der Romane, Jason Dark, ebenfalls einen kleinen Auftritt verschafft. In diesem Fall darf der |John Sinclair|-Erfinder mit seinem harten Ruhrpott-Akzent einen Türsteher mimen, was ihm auch leidlich gut gelingt. Die Musik von Andy Muhlack ist wirklich gelungen und passt gut zur jeweiligen Szenerie. Die Effekte scheinen aus einer professionellen Datenbank zu stammen und wirken sehr authentisch.
Leider ist die Story wirklich trashig und bar jeglicher Innovation. Dark versucht krampfhaft, mit aufgesetzter, peinlich naiver Erotik zu punkten, die sich in unbeholfenen Beschreibungen und der Verwendung von Kraftausdrücken erschöpft. Die Charaktere wirken wie am Fließband entwickelt und werden auf Äußerlichkeiten reduziert. Mason Flint ist der typische Alleskönner mit einem blendenden Aussehen, und die Beschreibung seiner Gespielin erschöpft sich in der Aussage, dass sie aussehe wie die junge Sharon Stone. Dafür gelingt es Dark zum Ende hin, mit einigen Überraschungen zu punkten, und der Cliffhanger macht trotz aller Mängel Lust auf den zweiten Teil. Unterm Strich bekommt der Hörspielfan eine typische Jason-Dark-Story präsentiert, die klingt, als ob ein Hörspiel des |Tonstudios Braun| (Dialoge und Skript) mit einem |WortArt|-Produkt (Musik und Effekte) verschmolzen ist.
Die Titelillustration von Emil Bartlomiejczak ist wirklich gut gelungen und übertrifft das Taschenbuchcover bei weitem. Der Zwiespalt der Titelfigur wird plastisch dargestellt und die düstere Farbgebung passt besser zur Story als das doch recht bunt geratene Bild auf dem Roman.
_Fazit:_
„Die Hexerin“ ist das neueste Produkt des Fließbandautors Jason Dark als anspruchsloser Gruseltrash zum Hören. Gute Sprecher, hervorragende Effekte und eine klangvolle Musik können nur unzureichend das schwache Skript kompensieren. Das Finale legt aber dramaturgisch noch mal zu und macht trotz einiger Schwächen Lust auf den zweiten Teil.
_Die Sprecher:_
Doriana Gray: Suzan Erentok
Mason Flint: Michael-Che Koch
Frenchy Davis: Annika Wichmann
Sprecher: Bodo Primus
Inquisitor: Kai Helm
Kincaid: Reinhard Schulat-Rademacher
Rymer: Frank Bahrenberg
Horseman: Holger Schulz
Bancroft: Thomas Linden
Hill: Oliver Dollansky
Eve Darling: Sarah Podransky
Edwin Sharp: Benjamin Werres
Mike Burton: Malcolm Walgate
Ray Garland: Jens-Peter Fiedler
Victor Flemming: Karl-Heinz Zmugg
Elmar Jackson und Türsteher: Jason Dark
Penner: Marcell Gödde
|64 Minuten auf 1 CD
Titelillustration/Titelgestaltung von Emil Bartlomiejczak
ISBN-10: 3-89941-598-1
ISBN-13: 978-3-89941-598-8|
http://www.cocomico-mystery.de
MIRA Taschenbuch
_Florian Hilleberg_
_Knallharter Schottenkrimi_
Als seine Tochter tot aufgefunden wird, ist der Geldeintreiber Joe Hope nicht mehr aufzuhalten. Er wird die Mörder finden – auch wenn er dafür jeden verdächtigen muss, dem er bisher getraut hat. Doch dann wird Hope selbst zum Verdächtigen … (Verlagsinfo)
_Der Autor_
Allan Guthrie ist Autor und Literaturagent. Für seine Kriminalromane wurde er bereits vielfach ausgezeichnet, „Abschied ohne Küsse“ war 2005 sein Debüt. Guthrie lebt mit seiner Frau Donna in Edinburgh, Schottland. (Verlagsinfo)
_Der Sprecher_
Reiner Schöne lebte lange in Hollywood und drehte dort mit Filmgrößen wie Client Eastwood und Lee van Cleef. Der Schauspieler, Synchronsprecher und Sänger mit der tiefen, markanten Stimme trägt die passende raue Note bei. (abgewandelte Verlagsinfo)
Regie führte Thomas Wolff. Die Buchvorlage erschien 2008 bei |Rotbuch|.
_Handlung_
Im schönen Edinburgh treibt Cooper als Kredithai sein Unwesen, und Joe Hope ist sein Geldeintreiber. Joes bevorzugtes Schlaginstrument, mit dem er Coopers Ansprüche anschaulich durchsetzt, ist sein Baseballschläger. Natürlich ist er als Schotte keineswegs ein Baseballfan, aber nichtsdestotrotz hat er diesen Schläger. Und dass er ihn effektvoll einzusetzen weiß, kann Billy Strachan bezeugen, der jetzt mit einigen gebrochenen Knochen im Krankenhaus liegt.
Nach diesem harten Job kehren Joe und Cooper in einer Bar. Coopers 17-jährige Freundin Sally, die Mutter seines Sohnes Gary, ist nicht da. Joe schaltet sein Handy ein: 16 nicht abgehörte Nachrichten. Er ruft seine Frau Ruth an. Sie heult etwas Hysterisches in den Hörer von wegen, Gem sei tot. Er legt sofort auf. Was soll der Scheiß, fragt sich Joe. Gemma, seine 19-jährige Tochter, ist längst ausgezogen, um sich auf den stürmischen Orkney-Inseln einem Typen namens Adam Wright anzuschließen, der eine Schriftstellerpension führt. Wie soll dort Gemma irgendetwas passieren können?
Ruth betrügt Joe schon seit langem mit einem Studenten, weiß er, und deshalb steht es um ihre Ehe nicht gerade zum Besten. Kaum hat ihm Ruth gesagt, Gem habe sich umgebracht, fährt er zu seiner eigenen Freundin Tina, einer Prostituierten und Kampfsportlehrerin. Er schläft nie mit ihr, gibt ihr bloß Geld fürs Zusammensein -obwohl sie nicht abgeneigt wäre und ihn mit Streicheleinheiten für das Geschenk von 1000 Pfund belohnt. Nach einem Zwischenstopp bei Ruth übernachtet er bei Cooper und dessen Familie.
Am nächsten Morgen ruft ihn Adam Wright, um ihn wüst zu beschimpfen, doch Joe, ein harter Kerl, der sich nichts bieten lässt, zahlt es ihm heim. Er packt seine Sachen – Ruth ist nicht daheim – und fliegt auf die Orkneys. Kaum betritt er Adams Haus, das merkwürdig dunkel ist, wird Joe von zwei Seiten in die Mangel genommen: Die Polizei nimmt ihn fest. Wegen Mordes an seiner Frau Ruth. Joe ist perplex. Doch die Bullen können ihn mal kreuzweise, und in der Auseinandersetzung mit Detective Sergeant Monkman kriegt Joe ein paar heftige Stiefltritte in die Rippen. Das macht ihn nicht unbedingt kooperationsbereiter. Sie fliegen ihn zurück nach Edinburgh.
Joe ruft Cooper an, der ihn brüllend fragt, warum er den Mord begangen hat, was Joe natürlich abstreitet. Cooper besorgt ihm einen jungen Schnösel von Anwalt, Ronald Brewer. Aber Brewer hat mehr drauf, als Joe glauben würde. Und weil Tina Joe ein Alibi gibt, kann Brewer ihn rausholen. Tina ist von Cooper und dessen Gentleman-Auftragsmörder Parke unmissverständlich und für die fürstliche Summe von 10.000 Pfund „gebeten“ worden, Joe das Alibi zu geben. Wenn das auffliegt, wird sie wegen Meineid belangt.
Wieder auf freiem Fuß, kann Joe mit Brewers und Tinas Hilfe endlich versuchen, den wahren Mörder seiner Frau zu finden. Und natürlich Vergeltung zu üben. Doch er hat keinen konkreten Verdacht, bis ihm Adam Wright unverhofft ein brisantes Dokument in die Hand drückt: Gemmas privates Tagebuch. Und was Gemma über einen gewissen „Daddy“ schreibt, den sie nicht verraten dürfte, obwohl er sie vergewaltigte, treibt Joe zur Weißglut. Denn es kann nur einen Mann geben, der sich diesen Ehrentitel anmaßen darf …
_Mein Eindruck_
Nach einem langsamen Start, der uns Joe Hope, den gescheiterten Lehrer, vorstellt und mit ihm sein detailliert geschildertes Alibi, kommt die Geschichte nach dem ersten Drittel richtig in Fahrt. Joe ist auf freiem Fuß, misstrauisch verfolgt und beschnüffelt von den Bullen, ebenso misstrauisch beschattet von Cooper und dessen Leuten. Es sieht nicht gut aus für Joes Alibi, trotz der erstaunlich loyalen Tina, die in ihm ihren Helden sieht, aber auch auf ihren Vorteil bedacht ist.
Das Schicksal beutelt Joe, den |ordinary guy|, doch er ist hart im Nehmen und ebenso hart im Austeilen. In dieser Lage erweist es sich, ob ein Mann wirklich Freunde hat – oder nur Speichellecker. Wenn Tina sich erfreulicherweise auf seine Seite stellt, so ist Joe umso mehr überrascht, dass sich der Junganwalt Ronald Brewer auf seine Seite stellt. Noch mehr ist er verblüfft, dass sich ausgerechnet Adam Wright, der ihm seine Tochter abspenstig gemacht hat, wie Joe glaubt, anerbietig macht, Gemmas Vergewaltiger zu finden und Joe zu helfen.
Allerdings weiß Joe nur zu genau, dass diese „Zivilisten“ nichts gegen die Feuerkraft der Gegenseite ausrichten können, und geht einen Pakt mit dem Teufel ein: Er schließt einen Deal mit Coopers Auftragsmörder Parke. Doch auf welche Seite wird sich Parke stellen, wenn es hart auf hart kommt? Wem gehört des Teufels Loyalität? Nur ihm selbst. Das sollte Joe eigentlich wissen.
An den Mann, den er unbedingt haben will, kommt Joe aber nicht heran, denn die Bullen beschatten ihn schon. Deshalb muss sich der trauernde und wütende Joe den rauchenden Schädel zerbrechen, wie an den Gegner heranzukommen ist. Glücklicherweise kann er auf drei Helfer zurückgreifen, die eine Falle aufstellen, in der sich die Beute fangen soll. Doch als es in einer ehemaligen Kirche zum Showdown kommt, fallen die Würfel nicht ganz so, wie Joe es geplant hat. Denn der Gegner wartet mit Enthüllungen auf, deren Ungeheuerlichkeiten Joe ins Wanken bringen …
|Das andere Edinburgh|
Wer einmal wie ich in Edinburgh, der Hauptstadt Schottlands, gewesen ist, der ahnt vielleicht, dass sich die alte keltische Gründung im Laufe der Jahrhunderte nicht bloß die Schokoladenseite auf der Princes Street zugelegt hat, sondern auch eine dunkle Hinterhofpersönlichkeit besitzt, der man nicht im Dunkeln begegnen möchte. Dort treiben sich hartgesottene Halunken wie Cooper und Hope herum. Sie haben einen harten Schlag drauf und lassen sich keinen Scheiß bieten, erst recht nicht von den Bullen. Ich bin selbst 1984 mit einem angetrunkenen Schotten aneinandergeraten und weiß, wovon ich rede. Man sollte es sich zweimal überlegen, bevor man sich mit so einem Typen einlässt. Bullen dagegen haben keine Wahl.
|Ringen um eine gute Seele|
Joe Hopes Seele ist, metaphysisch gesehen, ein Kriegsschauplatz zwischen Gut und Böse. Von seinen Lehrerträumen ist nichts übrig geblieben, als Ruth mit Gemma schwanger wurde und er sich einen lukrativeren Job suchen musste, um eine Familie zu ernähren. Geldeintreiben? Easy money! Doch Leute umzulegen, ist eine ganz Nummer schlimmer, und davor versuchen ihn die Schutzengel Tina, Adam und Brewer zu bewahren. Joes Teufelspakt ist ihren Bemühungen, ihn von der schiefen Bahn abzubringen, nicht gerade förderlich. Prompt sieht er sich denn auch verraten. Wie passend, dass der Showdown mit Satan in einer ehemaligen Kirche stattfindet. Nicht nur wegen der hübschen Beleuchtung.
|Schläge unter die Gürtellinie|
Der Autor versteht sein Handwerk. Er überrascht den Leser – und Joe – des Öfteren aus dem Hinterhalt, um ihm die volle Dröhnung zu verpassen. Als wolle er ihn am Schlafittchen packen und ihm eindreschen: „Dies ist das echte Leben, Kumpel!“ Dass sein Held Joe ausgerechnet „Hoffnung“ heißt und das Finale in der Kirche stattfindet, ist möglicherweise auf das traditionell protestantische geistige Umfeld des Autors zurückzuführen.
Im Widerspruch dazu steht jedoch scheinbar, dass die Figuren, die er vorstellt, der Selbstzerstörung nahe sind, als hätten sie jede Hoffnung verloren. Die Krönung ist die Enthüllung von der Vergewaltigung Gemmas durch ihren eigenen Vater – wer auch immer das nun eigentlich sein mag. Der Autor teilt Schläge aus, und manche landen wie dieser unter der Gürtellinie.
|Der Sprecher|
Reiner Schöne war schon vor 30 Jahren in den Hörspielen des |Bayerischen Rundfunks| zu hören, so etwa in der Titelrolle als Paul Cox. Seine Stimme ist „männlich herb“, tief und etwas rau, also genau richtig für ein kriminelles Milieu, in dem die Sitten ebenso rau sind. Er kann heiser auflachen, aufgebracht aufschreien, und zwar sowohl in einer männlichen wie einer weiblichen Rolle. Die Figuren zeichnet er in all ihrer Lautstärke und Emotionalität, lässt sie rufen, brüllen, schniefen, lachen und flüstern.
Für die Charakterisierung der Figuren steht ihm allerdings nur ein begrenztes Instrumentarium zur Verfügung. Die Charakterisierung erfolgt eher durch Situationen und Emotionen, die eine entsprechende Ausdrucksweise, wie oben aufgelistet, erfordert. Einmal verleiht er einem Spanier einen entsprechenden Akzent.
Schöne eignet sich mit seinem harten Image auch ausgezeichnet für die nicht gerade höfliche oder gar politisch korrekte Ausdrucksweise der Figuren. Dass sie vom Ficken reden, als wäre es Wassertrinken, ist eh klar. Es ist aber auch vom Mösenschnorcheln („muff diving“) die Rede, was eine volkstümliche Umschreibung des Cunnilingus ist. Der Hörer muss auf derlei Ausdrücke stets gefasst sein, und zwar in der ganzen Hard-Case-Reihe.
_Unterm Strich_
Der Anti-Held Joe Hope ist ein Bursche, der es einem nicht leicht macht, ihn zu mögen: hart im Austeilen, aber auch im Nehmen, und stets auf Kriegsfuß mit der behelmten Obrigkeit und Jung-Anwälten, die für ihn nur ahnungslose Schnösel sind. Zum schönen Geschlecht hat er ein zwiespältiges Verhältnis. Er liebt seine Tochter ebenso wie seine platonische Prostituierten-Geliebte, doch von seiner Frau Ruth ist er schwer enttäuscht, und nicht nur weil sie ihn mit einem jungen Studenten betrügt. Was bleibt einem Mann dann noch, wenn er fälschlich des Mordes angeklagt wird?
Die Story beginnt langsam, steigert sich dann aber über mehrere Stationen hin zu einem fulminanten Showdown, der dem Helden etliche Tiefschläge versetzt – und uns natürlich ebenso. Der Autor präsentiert ein ungeschminktes Gesicht der Königin des britischen Nordens, eines, das Inspektor Rebus des ungleich populäreren Ian Rankin wohl nur selten zu Gesicht bekommt. Höchste Zeit, dass Rankin seinen Inspektor in Rente schickt.
|Das Hörbuch|
Reiner Schöne zuckt mit keiner Wimper, wen sich seine Figuren gegenseitig die Visage demolieren oder sich Unflätigkeiten an den Kopf werfen. Es ist nicht seine Aufgabe, sich einzumischen, wenn die schlimmsten Sünden ans Tageslicht gezerrt werden: Vergewaltigung, Inzest und dergleichen mehr. Aber es ist sehr wohl seine Aufgabe, sich ins Zeug zu legen, um die Figuren zum Leben zu erwecken. Das gelingt ihm auf glaubhafte und konsistente Weise, so dass wir auf weitere erstklassige Hard-Case-Crime-Krimis hoffen dürfen.
|Originaltitel: Kiss her goodbye, 2005
Aus dem Englischen übersetzt von Gerold Hens
301 Minuten auf 4 CDs
ISBN-13: 978-3-86610-454-9|
http://www.argon-verlag.de
http://www.rotbuch.de
_Inhalt:_
In Point Whitmark locken seltsame Elfenerscheinungen Hunderte von Touristen in die kleine Stadt. Zunächst sieht alles nach einem harmlosen Scherz aus. Das ändert sich, als Point Whitmark von einer Schlangenplage heimgesucht wird und im Dunkel der Nacht ein Ungeheuer sein Unwesen treibt. Es ist der geheimnisvolle Oxman aus einer alten Legende. Jay, Tom und Derek wollen dem Geheimnis auf den Grund gehen und geraten selbst ins Visier des Monsters …
_Meine Meinung:_
Die zweite Folge steht der ersten in Puncto Spannung in nichts nach und legt in Sachen Tempo und Originalität sogar noch einiges drauf. Musik und Effekte sind wieder einmal perfekt und lassen keine Wünsche offen. Das Hörspiel beginnt abermals mit einer düsteren und stimmungsvollen Szene aus der Vergangenheit, bevor die Helden der Serie zu Wort kommen.
Abermals sprechen die Schauspieler ihre Parts mit vollem Einsatz. Hinzu kommen einige Nebenrollen, die ebenfalls grandios besetzt wurden. An dieser Stelle seien Helga Uthmann und Rolf Jülich als Ehepaar Chapman genannt, die das leicht vertrottelte Pärchen gekonnt und komödiantisch überzogen darstellen. Die Handlung ist im Gegensatz zu Folge eins noch mysteriöser und unheimlicher, und obwohl auch hier wieder eine reale Lösung auf den Hörer wartet, ist die Stimmung trotzdem ein wenig düsterer als bei den |Drei Fragezeichen|. Als Gimmick gibt es wieder eine kleine Vorschau auf die nächste Folge, sowie, dahinter ‚versteckt‘, einen kleinen Bonustrack.
Die Aufmachung ist spitze. Das Leuchtturm-Layout vermittelt dem Kunden, welche Zielgruppe angesprochen wird, wobei auch Erwachsene an den liebevoll produzierten Hörspielen ihre Freude haben werden. Das Cover zeigt in einer guten Mischung aus grellen und dunklen Farben, was einen in den kommenden 58 Minuten erwartet.
_Fazit:_
Die Macher haben sich wieder alle Mühe dabei gegeben, den Hörer von 8 bis 88 angenehm und kurzweilig zu unterhalten. Bei |Point Whitmark| stimmt einfach alles – so müssen Hörspiele klingen.
Nach einer Erzählung von Bob Lexington
Idee & Konzeption: Volker Sassenberg
Drehbuch: Raimon Weber & Decision Products
Musik: Volker Sassenberg, Markus Segschneider und Manuel Rösler in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Staatsorchester Weißrussland und Victor Smolski (|Rage|)
Ton & Schnitt: Erik Anker
Tonassistenz: Thorsten Hohagen
Illustration: MD
Regie: Volker Sassenberg
Produktion: Volker Sassenberg
Aufgenommen und gemischt unter Finians Regenbogen
|Sprecher:|
Erzähler: Jürg Löw
Jay Lawrence: Sven Plate
Tom Cole: Kim Hasper
Derek Ashby: Gerrit Schmidt-Foss
Sera Goodwinter: Isabella Lewandowski
Mrs Chapman: Helga Uthmann
Mr Chapman: Rolf Jülich
McCarthy: Michael von Rospatt
Mrs Bushland: Ines Burkhard
Kathy Goodwinter: Esther Münch
Sheriff Baxter: Andreas Becker
Cassandra Harris: Tanja Kuntze
Deputy Nelson: Roger Trash
Vater Callahan: Heinz Ostermann
Junge: Max Hoffmann
Indianer: Hans Paetsch
sowie Leopold von Verschuer, Udo Rau, Volker Sassenberg, Frank „Digger“ Rademacher und Andreas Ksienzyk
|58 Minuten auf 1 CD
ISBN-13: 9783829118941|
http://www.pointwhitmark.de
http://www.karussell.de/0__point__whitmark__22460.jsp
Point Whitmark auf |Buchwurm.info|:
[„Point Whitmark 01: Die Bucht der 22 Schreie“ 5128
[„Point Whitmark 22: Die blutenden Schlüssel“ 4793
[„Point Whitmark 23: Der Duft der Finsternis“ 5058
_Florian Hilleberg_
Episode 1: [„Die Zusammenkunft“ 4811
Episode 2: [„Verwandlungen“ 4826
Episode 5: [„Dämonische Leidenschaft“ 4833
Episode 6: [„Ravens Geheimnis“ 4850
Episode 10: [„Das Böse im Menschen“ 4910
Episode 11: [„Wendepunkt“ 4955
Episode 12: [„Tag der Vergeltung“ 4968
Episode 13: [„666 – Das Zeichen des Bösen“ 5095
Endlich erkennt Faith, hinter welcher menschlichen Maske sich das große Tier 666 verbirgt. Doch die Erkenntnis kommt fast schon zu spät. Gemeinsam mit ihren Freunden nimmt sie den Kampf gegen Aleister Crowley und seine dämonischen Kreaturen auf, auch wenn die Schlacht schon verloren scheint und viele Opfer fordert …
_Meine Meinung:_
Die letzte Episode der ersten Staffel endet mit einem Paukenschlag und führt fast alle Handlungsfäden zu einem schlüssigen Ende. Das Rätsel um die Identität des Biestes ist Simeon Hrissomallis perfekt gelungen, denn bis zum Schluss ist man sich im Unklaren darüber, wer denn nun Faith‘ erbittertester Feind ist. Die Wahrheit ist dann natürlich umso schockierender, zumal Faith und ihre Freunde vor ihrem wirklich schwersten Kampf stehen und nicht alle Freunde heil davonkommen. Die Folge hält für die Fans, die von Anfang an dabei sind, eine Menge Überraschungen parat und steigert sich in Puncto Spannung und Dramatik erheblich im Vergleich zur vorherigen Episode. Leider erinnert der Kampf zwischen Faith und dem Tier 666 zuletzt ein wenig an eine Manga- oder Anime-Schlacht aus dem Fernsehen, mit all den himmlischen Waffen und dem heroischen Gerede.
Ein ganz großes Lob gebührt wieder mal den Effekten, die alles, was bisher in der Serie geboten wurde übertreffen. Besonders die Stimmverzerrung des Biestes ist hervorragend gelungen und hört sich um einiges schauriger an als die dumpfen Dämonenstimmen der |John Sinclair|-Hörspiele. Schließlich wurde diese Verzerrung vorher auch nicht so häufig angewendet, weshalb sie viel wirkungsvoller ausfällt. In Sachen Musik kann sich die |R & B Company| ebenfalls steigern und legt einen Soundtrack ab, dessen Stücke nie deplatziert sind und immer zum Geschehen passen. Viele Worte über die Sprecher kann man nicht mehr verlieren. Hier liefert jeder Einzelne eine grandiose Arbeit ab und ist mit Leib und Seele dabei.
Besonders vielversprechend ist der Dialog am Ende der CD, der bereits einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf die nächste Staffel liefert, die im Herbst starten soll. Lutz Riedel ist jedenfalls die perfekte Besetzung für die Rolle. Immerhin hat er ja schon Erfahrungen mit dieser Figur gesammelt.
Zur Aufmachung: Timo Würz schuf für den letzten Teil der Trilogie ein beeindruckendes und treffendes Cover, welches Faith im Kampf mit dem großen Tier 666 zeigt.
_Fazit:_
„Die letzte Schlacht“ ist ein würdiger und extrem spannender Abschluss der ersten Staffel. Hier werden noch mal alle Register gezogen: Action, Dramatik und Spannung gehen Hand in Hand. Sämtliche Charaktere haben sehr gute und denkwürdige Auftritte, und von einigen lieb gewonnenen Personen muss man sich schließlich verabschieden. Mit dem Ende der finalen Trilogie wird ein erster großer Schnitt in der Serie vollzogen und gleichzeitig der Beginn der zweiten Staffel vorbereitet. Musik, Effekte und Sprecher bewegen sich auf hohem Niveau und machen diese Folge zu echtem Ohrenkino.
_Die Sprecher:_
Faith Miles: Nana Spier (Sarah Michelle Gellar, Claire Danes, Drew Barrymore)
Shania Francis: Dorette Hugo (Jennifer Garner, Christina Ricci in „Ally McBeal“)
Vin Masters: Boris Tessmann (David ‚Angel‘ Boreanaz)
Raven: David Nathan (Johnny Depp, Christian Bale, James ‚Spike‘ Marsters)
Christopher Lane: Thomas Nero-Wolff (Hugh Jackman, Jason Statham, Anthony ‚Giles‘ Head)
Hunter: Udo Schenk (Ray Liotta, Ralph Fiennes, Kevin Bacon, Gary Oldman, Jeffrey Combs …)
Direktor Arowic: Helmut Krauss (Marlon Brando, James Earl Jones, John Goodman, Jerry ‚Deep Throat‘ Hardin in „Akte X“)
Wanja Antonowic: Klaus Sonnenschein
Arnulf Wilberg: Tobias Meister (Brad Pitt, Kiefer Sutherland, ‚Yoda‘)
Baltram Wilberg: Kim Hasper
Alex Christ: Torsten Michaelis (Wesley ‚Blade‘ Snipes, Sean Bean)
Dr. Cromwell: Aart Vader
Nathan Pierce: Martin Kessler (Nicolas Cage, Vin Diesel)
Erzählerin: Barbara Stoll
Stella Wuzunidu: Roswitha Benda
Brandolf Welf: Thomas Danneberg (Dan Akroyd, John Travolta, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Nick Nolte, Dennis Quaid, Rutger Hauer …)
Sakis Rimas: Thilo Schmitz (Ving Rhames, Michael Clarke Duncan, Ron Perlman)
Elias Christopoulos: Lutz Mackensy (Al Pacino, Christopher Lloyd)
Tim Kosiminos: Dieter Klebsch (Alec Baldwin, Gabriel Byrne, Peter Stormare)
Alexis Pardamidis: Wolfgang Strauss
Soldaten: Thomas Birker, Joschi Hajek
Georg/Pater Wassilios: Christian Rode (Christopher Plummer, Michael Caine)
Magdalena: Dagmar Dreke
UND
Lutz Riedel (Timothy Dalton, Udo Kier, Tom Wilkinson, Jonathan Pryce)
|67 Minuten auf 1 CD|
http://www.rb-company.de
http://85.25.136.73/shop2/index.php?user=rbcompany
_Florian Hilleberg_
_Monumentale Japan-Saga: das Ende der Otori_
Seit 16 Jahren herrschen Takeo und Kaede Otori gemeinsam über die Drei Länders des Westens Japans. Ihre Liebe und Harmonie, aber auch die perfekte Balance zwischen männlicher und weiblicher Kraft haben ihrem Land dauerhaften Frieden und großen Reichtum beschert.
Das bleibt auch dem Kaiser im fernen Miyako und seinem obersten General, Saga Hideki, nicht verborgen. Der General fordert Takeo zu einem Wettkampf in Miyako heraus. Wenn Takeo verliert, muss er nicht nur abdanken und das Land verlassen, sondern auch in eine Heirat seiner Thronerbin Shigeko mit Saga einwilligen. Mit seinen treuesten Gefolgsleuten reist Takeo in die Hauptstadt. Und schon bald überschlagen sich die Ereignisse, denn ein schwerer Verrat durch Kaedes Schwester und ihren Mann Zenko droht alles zu zerstören, was Takeo und Kaede in langen Kämpfen aufgebaut haben. (abgewandelte Verlagsinfo)
_Die Autorin_
Lian Hearn, die eigentlich Gillian Rubinstein heißt und vor etwa 60 Jahren geboren wurde, lebte als Journalistin in London, bevor sie sich 1973 mit ihrer Familie in Australien niederließ. Ihr Leben lang interessierte sie sich für Japan, lernte dessen Sprache und bereiste das Land.
|Der Clan der Otori|:
1) [Das Schwert in der Stille 950 (dt. 2004)
2) [Der Pfad im Schnee 979 (2005)
3) [Der Glanz des Mondes 2180 (2005)
4) Der Ruf des Reihers (2007)
5) erschien im Sept. 2007 im Original
„Das Schwert in der Stille“, der mittlerweile in 26 Sprachen übersetzt wurde, wurde mit dem Deutschen Jugendbuchpreis 2004 ausgezeichnet. Mehr Infos unter http://www.otori.de.
_Die Sprecher_
Marlen Diekhoff, vielseitige Bühnen- und Filmschauspielerin, gehört nach Verlagsangaben seit vielen Jahren zum Ensemble des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg. Für |Hörbuch Hamburg| hat sie bereits Texte von Alessandro Baricco, Amélie Nothomb, Sidonie-Gabrielle Colette, Sándor Márai und „Tausendundeine Nacht“ gelesen.
Peter Jordan gehört zu den erfolgreichsten deutschen Bühnendarstellern. Seit 2000 ist er festes Mitglieder im Ensemble des Hamburger Thalia-Theaters. Im Rahmen des Kunstpreises Berlin 2003 wurde er mit dem Förderpreis der Akademie der Künste ausgezeichnet. Er war in Kinofilmen wie „Ausreißer“ zu sehen, der 2006 als Bester Kurzfilm eine |OSCAR|-Nominierung erhielt.
Heikko Deutschmann war nach seinem Schauspielstudium Ensemblemitglied an der Berliner Schaubühne, am Hamburger Thalia-Theater, im Schauspiel Köln und Schauspielhaus Zürich. Mittlerweile ist er in zahlreichen Film- und Fernsehrollen zu sehen gewesen, so etwa „Der Laden“, „Operation Rubikon“, „Der Aufstand“ oder „Die Affäre Kaminski“.
Regie führte bei diesem Hörbuch Gabriele Kreis. Auch diese Lesung ist wie die der Vorgängerbände gekürzt. Das Titelbild zeigt die Abbildung der Buchausgabe.
_Vorgeschichte_
Japan, Ende des 15. Jahrhunderts: Eines Morgens wird Takeos Dorf überfallen, und er überlebt als einziger. Lord Shigeru vom Clan der Otori rettet ihn und nimmt ihn in seine Familie auf. Von ihm, einem Helden wie aus versunkenen Zeiten, lernt Takeo die Bräuche des Clans. Er lehrt ihn Schwertkampf und Etikette. Die Liebe zu Kaede entdeckt Takeo allein.
Als er herausfindet, dass er dunkle Kräfte besitzt – die Fähigkeit, an zwei Orten gleichzeitig zu sein und sich unsichtbar zu machen, und dass er so gut „hören kann wie ein Hund“ – gerät er immer tiefer in die Verstrickungen der Lügen und Geheimnisse, aus denen die Welt der Clan-Auseinandersetzungen besteht. Trotz seines Widerwillens ist es ihm bestimmt, sich an den Mördern seiner Familie zu rächen. Takeo verbindet sein Schicksal mit dem der Otori.
Am Schluss von Band 1 ließ Lord Shigeru sein Leben, nachdem auch Lord Iida getötet worden war. Als Folge dieser beiden einschneidenden Ereignisse kam es in der Hauptstadt Inuyama zu einem Aufstand, den sich die Armee unter Lord Arai Daiichi zunutze machte, um die Macht zu übernehmen und die tyrannischen Tohan zu stürzen. Er bringt die Drei Länder in seine Gewalt.
Man glaubt, Takeo sei Iidas Mörder, doch in Wirklichkeit war es Lady Kaede. Takeo ist verschwunden, was Arai, der auf ein Bündnis mit dem Krieger hoffte, erzürnt. Er beschließt, gegen den „Stamm“, der ihm Takeo entrissen hat, vorzugehen. Es ist abzusehen, dass Takeo und Kaede im Machtspiel zwischen den Otoris, Lord Arai und dem „Stamm“ eine Schlüsselrolle zufällt. Wenn sie nicht aufpassen, könnte dies ihren Untergang bedeuten.
Doch inzwischen hat sich Takeo dem „Stamm“, aus dem sein leiblicher Vater Isamu stammte, unterwerfen müssen. Mit der Kikuta Yuki zeugte er ein Kind, doch Yuki, die ihm einst in Inuyama Shigerus Schwert brachte, wurde Takeo entrissen und musste einen Stammesangehörigen heiraten. Takeo kann sich nicht mit den opportunistischen Zielen des Stammes anfreunden, er flieht über die Berge. Mehrere Anschläge überlebt er und begegnet einer heiligen Frau, die ihm sein Schicksal prophezeit (s.o.).
Außerdem lernt er die „Verborgenen“ kennen, die verfolgten und ausgestoßenen Christen. Seine Eltern hingen selbst diesem Glauben an, der alle Werte, die die Japaner hochhalten, für ungültig erklärt und sie unterminiert. Der Christ Jo-an hilft ihm, ins Kloster Terayama zu entkommen. Dort kann er endlich Kaede heiraten und die Übernahme ihres Erbes vorbereiten: der Domänen Shirakawa und Maruyama. Dann wäre er als Clanherr eine beachtliche Macht im Westen.
Kaede erwartet Takeos Kind. Es werden Zwillingstöchter. Vielleicht ist das aber auch ganz gut so. Die heilige Frau hat nämlich geweissagt, Takeo werde einst von der Hand seines eigenen Sohnes den Tod finden …
HINWEIS: Der Familienname steht vor dem Eigennamen.
_Handlung_
Sechzehn Jahre sind seit den Ereignissen in „Glanz des Mondes“ vergangen, als es Kaede und Takeo gelang, ihre Sippen Shirakawa und Otori durch Heirat und siegreiche Schlachten ebenso zu vereinen wie die drei Fürstentümer des Westens. Wohlstand ist eingekehrt, doch nicht alles ist friedlich. Lord Arai Zenko, Gatte von Kaedes Schwester Hana, hegt einen Groll gegen den „Emporkömmling“ Takeo wie auch Kikuta Akio, dessen Vater durch Takeo zu Tode gekommen sein soll. Diese Altlasten erweisen sich nun langfristig als Takeos Verhängnis.
Akio will ebenso wie Zenko die Oberherrschaft im „Stamm“, jenem verborgenen Netzwerk von Menschen mit erstaunlichen Fähigkeiten und Gaben. Takeo ist selbst mit der Gabe des Unsichtbarmachens und dem Zweiten Ich gesegnet. Besorgt bittet er seinen Mentor Muto Kenji, das Oberhaupt des „Stammes“, um Vermittlung eines Waffenstillstands mit Akio. Doch dieser lehnt nicht nur brüsk ab, sondern zwingt Kenji sogar dazu, Selbstmord zu begehen.
Doch zuvor hat Kenji den 15-jährigen Jungen Hisao kennengelernt, angeblich der Sohn Akios, doch in Wahrheit Takeos Sohn, den ihm Kenkis Tochter Yuki gebar. Hisao ist also Kenjis Enkel. Nun wird Hisao vom Geist Yukis verfolgt, denn er ist mit der Gabe des Geistersehens, wie er denkt, verflucht und verbirgt dies vor Akio. Die Nachricht vom Tod Kenjis verwirrt Hisao und betrübt Takeo. Er bestimmt die alte Lady Shizuka zur Nachfolgerin ihres Onkels, doch weder Zenko noch Akio erkennen sie an und unterminieren Takeos Nutzung des Stammesnetzweks als geheime Post. Dadurch fangen sie Nachrichten an Takeo ab, den Oberbefehlshaber der Drei Länder.
Arai Zenko hat es selbst auf die Oberherrschaft im Westen abgesehen. Er hat zwar Takeo Treue geschworen, gibt aber nichts darauf. Heimlich schließt er einen Pakt mit dem Kaiser, der Takeos Reichtum begehrt, und lädt die fremden Barbaren in seine Domäne ein, um an ihre Feuerwaffen zu gelangen. Ja, zum Entsetzen Shizukas, seiner Mutter, konvertiert er sogar zur fremden Religion und gibt vor, Deus zu verehren. Aus Protest begibt sie sich in Hungerstreik im Tempel. Zenkos Untertanen geraten in Aufruhr ob dieses schlechten Omens und verwünschen ihren abtrünnigen Lord. Dieser tut sich mit Kikuta Akio zusammen.
Lady Shizuka hat die beiden Zwillingstöchter Kaedes und Takeos in den Stammeskünsten ausgebildet, im Unsichtbarwerden und dem zweiten Ich. Maya und Miki sind beide 13 Jahre alt und sehr unglücklich. Sie werden von den Bürgern geschnitten, denn Zwillinge werden normalerweise gleich nach der Geburt getötet. Und dazu haben sie nun auch noch Stammestalente, die sie dem Rest der Leute unheimlich machen, obendrein auch ihrer Mutter. Maya lernt sogar, sich in eine Katze zu verwandeln. Takeo schickt Maya und Miki auf abgelegene Höfe zu Verwandten und lässt sie dort unterrichten. Maya büchst aus und gelangt mit Shizuka an Zenkos Hof.
Dort spitzt sich die Lage zu, als Zenko seinen eigenen Bruder Muto Taku verrät, den obersten Spion Takeos. Maya hat viel von Taku und seiner Konkubine Sada gelernt, so auch das Geheimnis, das Hisao umgibt. Als Taku ahnt, dass sein Bruder etwas im Schilde führt, drängt er Sada und Maya zum Aufbruch, doch das Trio kommt nicht weit. Akio und Hisaos neue Feuerwaffe verrichtet ihr unheilvolles Werk. Maya lernt so Akio und Hisao als Gefangene kennen. Hisao gebietet über alle Geister, und da in Maya der Geist einer Katze wohnt, kann er sie zwingen, bei ihm zu bleiben. Erst als Miki ihr hilft, kann sie fliehen. Sie wollen zu Kaede, ihrer Mutter. Sie ahnen nicht, dass bereits alles verloren ist.
Mittlerweile ist nämlich ihr Vater der Einladung des Kaisers gefolgt und in die ferne Hauptstadt gezogen. Weil der General des Kaisers, Lord Saga, ihn im Namen seines Herrn aufgefordert hat, abzudanken und ins Exil zu gehen oder sich das Leben zu nehmen, ist Takeo äußerst vorsichtig. Er lässt seinen Feldmarschall eine Armee an der Ostgrenze aufstellen. Zusammen mit seiner Tochter, der sechzehnjährigen Lady Maruyama Shigeko, zieht er nach Miyako. Shigeko ist eine echte, voll ausgebildete Kriegerin.
Zunächst verläuft alles gut, und es gelingt ihm, die Gunst des Kaisers zu erlangen, indem er ihm eine Giraffe schenkt: ein Zeichen der Gunst der Götter. In einem Wettstreit, bei dem alles auf dem Spiel steht, gewinnt sogar Takeos Mannschaft dank Shigekos Kunst gegen Lord Sagas Team. Sie muss Lord Saga also nicht heiraten und bleibt eine Fürstin, Takeo behält seine Länder.
Doch auf der Hochfläche am Grenzpass kommt es zu dem Unglück, das Takeo schon lange befürchtet, seit die Giraffe zu ihm zurückgekehrt ist: Lord Saga greift ihn mit einer Armee an. Zu spät erreicht ihn die Nachricht, dass gleichzeitig Lord Arai Zenko mit seiner eigenen Armee gegen die Hauptstadt zieht.
Krieg und Bürgerkrieg zugleich – kann es schlimmer kommen? Es kann. Denn Zenkos Frau Hana spinnt nun ihre heimtückische Intrige gegen Takeo bei Kaede, ihrer eigenen Schwester.
_Mein Eindruck_
Wie schon an diesem stark verdichteten Handlungsabriss zu erkennen ist, macht es die Autorin dem Leser nicht gerade einfach, das Geflecht der zwischenmenschlichen Beziehungen zu durchschauen. Dieses Verständnis ist unerlässlich, um die Motivationen der Akteure zu verstehen und die Aktionen einordnen zu können. Bei einer Familiensaga wie dieser war es aber noch nie anders, weder in den Vorgängerbänden noch bei anderen Autoren (man denke nur an „Die Buddenbrooks“). Im Buch findet sich deshalb eine hilfreiche Gedächtnisstütze in Form eines Personenverzeichnisses. Nach einer Weile fand auch ich mich zurecht.
All die Nebenhandlungen sind geschickt angelegt, um die Lage für Takeo, der die Haupthandlung bestreitet, noch weiter zu verschärfen. Während er im Ausland sein Land verteidigt, bricht ihm genau dieses im beginnenden Bürgerkrieg weg. Doch was sind nun die zerstörerischen Kräfte, die den Untergang der Otori herbeiführen, mag sich der Leser fragen.
Neid und Missgunst sind altbekannte Feinde aller Herrscher, und auch Takeo sieht sich ihnen gegenüber. Zenko ist missgünstig, der Kaiser bzw. dessen General Saga ist neidisch. Hinzu kommt der rachedürstende Akio, der wie Zenko nicht vor Brudermord haltmacht. Und Arai Hana, die Frau Zenkos, zerstört das Vertrauensverhältnis zwischen Kaede und Takeo. Das Resultat ist ein verbrannter Palast.
Rätselhaft sind die Absichten der fremden „Barbaren“. Es sind Portugiesen, die, seit Magellan 1487 die Welt umrundete, von Indien her den Fernen Osten erkunden und missionieren wollen. Da sie über Feuerwaffen verfügen, stellen sie einen beachtlichen Machtfaktor dar. Seit Takeo einen Deal mit den Piraten abgeschlossen hat, hat er auf dem Festland das Monopol über Feuerwaffen inne. Dieses verliert er durch Verrat und den Knowhow-Transfer, den die Fremden an Zenkos Hof in Gang setzen. So lernt Hisao, eine Schusswaffe zu konstruieren und zu schmieden. Wie wirksam diese Waffe ist, erfahren Muto Taku und Sada zu ihrem Leidwesen am eigenen Leib.
Langfristig sind die Fremden wohl auf eine Machtbasis aus, denn sie beantragen die Errichtung eines Handelspostens. Interessant ist die Reaktion der Japaner auf ihre Vorstellung von einem strafenden und rachsüchtigen Gott. Dies steht völlig im Gegensatz zu ihrem eigenen buddhistischen Glauben an die gütige Göttin Kannon und ihr Pantheon. Die Wiedergeburt im nächsten Leben ist keine Strafe, sondern eine ausgemachte Gewissheit von Belohnung.
Zu guter Letzt entscheidet der altbekannte Krieg das Geschick Takeos. Erst hier wird das Buch wirklich spannend. Die Action kann sich durchaus mit der von männlichen Autoren wie David Gemmell oder Bernard Cornwell messen. Natürlich spielen die Frauen eine besonders herausragende Rolle. Shigeo entscheidet die Schlacht mit einem Husarenstück, indem sie Lord Saga verletzt und vertreibt.
Letztlich bleibt nur die Frage offen, ob und wie sich die Prophezeiung erfüllen wird (siehe oben). Nun hat nämlich Takeo auf einmal zwei Söhne, seinen Neugeborenen und eben Hisao. Das sorgt für weitere Spannung und sogar für packende Action. Es lohnt sich also, bis zum Schluss dranzubleiben.
|Die Sprecher|
Peter Jordan ist für die meisten männlichen Rollen zuständig, insbesondere für Takeo und dessen engste männliche Freunde. Sein besonderes Kennzeichen ist die Beherrschtheit Takeos in praktisch allen Lebenslagen, denn Takeo wurde gemäß dem Code des Kriegers zu Selbstkontrolle erzogen. Diese Zurückhaltung jedoch macht Jordans Vortrag ziemlich eintönig, selbst wenn sich der Sprecher bemüht, etwas Pfiff hineinzubringen. Ziemlich verwirrend war Jordans Eigenart, zwischen Szenen keine Pause zu machen. Schwupps, befindet sich die Handlung ganz woanders! Da kann man leicht den Faden verlieren.
Deshalb war es unbedingt nötig, für Abwechslung zu sorgen. Der naheliegende, aber teurere Weg: Man lässt andere Sprecher ans Mikrofon. Marlen Diekhoff ist für zahlreiche weibliche Rollen zuständig. Insbesondere ist dabei Kaede zu nennen, aber auch ihre zwei Töchter Maya und Miki sowie die alte Dame Shizuka, die Mutter Zenkos und Takus. Diekhoff braucht nicht mit Emotionalität zu sparen, und so wird ihr Vortrag zu einem wahren Lichtblick innerhalb der Lesung. Mitunter sind ihre Szenen sogar lustig.
Auch Heikko Deutschmann spricht vor allem männliche Rollen, doch achtet er ebenfalls auf Abwechslung. Diese gestaltet er in erster Linie durch das Variieren der Lautstärke. Es gab Passagen, in denen er so leise spricht, dass ich die Regler meines Anlage hochfahren musste, um ihn verstehen zu können. So zwingt er den Hörer, ganz genau darauf aufzupassen, was gerade gesagt wird. Aber er kann auch ohne weiteres Figuren durch eine unterschiedliche Ausdrucks- und Sprechweise charakterisieren. So kann man sie leicht unterscheiden.
Die drei Sprecher bewältigen die sprachlichen Schwierigkeiten, die das Japanische bietet, mit großer Bravour. Sie haben sich offenbar kundig gemacht. Sie müssen mit vielen Namen zurechtkommen, die stets ein wenig von der Schreibweise abweichen. Ein paar Beispiele:
Otori: Die Betonung liegt im Japanischen eine Silbe |vor| derjenigen, die im Indogermanischen betont wird. Hier würde man „Otori“ auf der zweiten Silbe betonen: otóri. Doch im Japanischen liegt die Betonung auf der ersten: Es klingt wie [ottori]. Analog dazu wird „Shirakawa“ auf der zweiten statt der dritten Silbe betont: [shirà kawa]. Analog dazu die Städtenamen Inúyama, Yamágata und Teráyama. Der Name der Lady Kaede wird in nur zwei Silben ausgesprochen, denn [ae] ist ein Doppellaut und klingt wie [ei], nicht wie [ä].
|Personenliste|
Obwohl das Personal recht umfangreich ist, enthält das Hörbuch nicht jene Liste der auftretenden Figuren, die im Buch unschätzbare Dienste leistet. Aber auch bei der Buchausgabe bleibt stets eine Quelle der Verwirrung: Ständig tauchen Angehörige des Stammes auf, die als „Skuta“ bezeichnet werden.
Manchmal steht diese Bezeichnung für den Stamm im allgemeinen (z. B. Skuta-Schlaf), dann aber wieder nur für die bestimmte Familie Skuta, die sich Takeo zum Feind gemacht hat – im Unterschied zu der Stammesfamilie der Muto. (Der Stamm ist also gespalten.)
Um die Verwirrung vollständig zu machen, tauchen die Skuta überhaupt nicht im Personenregister des Buches auf, sondern nur die Stammesfamilie Kikuta hat die entsprechenden Vornamen. Das ist also eine Ausspracheabweichung: Skuta = Kikuta!
Lediglich im Buch kann sich der Interessierte anhand einer Landkarte orientieren, wie die Ortsnamen und die Namen der Clan-Domänen geschrieben werden. Meine Schreibweise ist der im Buch angeglichen.
|Das Booklet|
Der Inhalt des Booklets listet weder, wie zuvor üblich, die Figuren auf, noch liefert er einen Abriss der vorausgehenden Ereignisse. Lediglich die Autorin und die drei Sprecher sowie die anderen Hörbücher werden knapp vorgestellt. Die vierte Seite enthält die Credits und bibliografischen Angaben. Mit anderen Worten: Es ist in keiner Weise hilfreich, sondern verweist den Hörer auf die vorhergegangenen Hörbücher, um zu verstehen, was los ist.
_Unterm Strich_
Dieser Band bringt das Ende der Otori-Herrschaft und der Abenteuer Takeos und Kaedes. Aber das muss nicht heißen, dass die Geschichte total deprimierend ist, denn die Autorin baut vier Kinder dieses Paares als Erben auf und führt sie durch die ersten Prüfungen. Sie geben Anlass zur Hoffnung, dass die revolutionären Ideen Takeos und Kaedes – etwa die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen an der Herrschaft – fortbestehen werden, selbst nach der Eroberung der Drei Länder durch den Kaiser. Der Wandel ist bekanntlich das Einzige, das beständig ist, und so muss auch das Reich der Otori vergehen, um seinen Beitrag zu einem größeren Ganzen leisten zu können. Hier lobt die Autorin den Beitrag der Frauen zur Geschichte des Landes, vielleicht ein wenig blauäugig und utopisch.
Wie zu erwarten, fand ich die Handlung weitverzweigt und abwechslungsreich. Das erfordert allerdings, sich jede Menge Namen zu merken. Nach einem Auftakt mit leichter Action – Attentäter werden unschädlich gemacht – ist klar, dass in allen möglichen Ecken Gefahren die Otori-Herrschaft bedrohen. Doch erst mit der monumentalen Drei-Tage-Schlacht findet diese unterschwellige Spannung ihren offensichtlichen Ausbruch.
Das ist ein ziemlich langer Spannungsbogen. Und er wird von den Konflikten um Zenko, Akio, Taku und Hisao in einem zweiten Spannungsbogen ergänzt. Das Ergebnis sind Krieg und Bürgerkrieg. Mit bemerkenswertem Geschick fädelt die Autorin alle Konflikte ein und löst sie wieder auf. Sie schreckt vor keiner Konfliktart zurück, und seien es eine Palastintrige oder der Tod eines Babys. Zarte Gemüter seien gewarnt.
|Originaltitel: The harsh Cry of the Heron, 2006
Aus dem Englischen übersetzt von Henning Ahrens
589 Minuten auf 8 CDs
ISBN-13: 978-3-86742-007-5|
http://www.otori.de
http://www.lianhearn.com
http://www.hoerbuch-hamburg.de
Folge 1: [„Der Stein der Weisen“ 5052
Folge 2: [„Das Erbe des Gilgamesch“ 5155
_Story_
Sieben lange Jahre verbringt Christopher in Gefangenschaft, nachdem er beim Versuch, Lysander zu stellen, gefasst wurde. Ausgemergelt und ohne jeglichen Lebensmut, wird er von seiner Stiefschwester Aura Institoris mit einer List aus dem Gefängnis befreit. Diese jedoch nutzt ihn nur als Mittel zum Zweck, um Lysander ein weiteres Mal zu überfallen und die verschollene Sylvette zu befreien.
In den Katakomben der Wiener Hofburg finden die Halbgeschwister jedoch nur einen zu Tode geschwächten Mann – vermeintlich der gezeichnete Lysander – und ein junges Mädchen vor, welches sich als Sylvettes Tochter Tess entpuppen soll. Aura und Christopher führen das Kind mit auf das Anwesen der Institoris, wo Christopher auch Gian kennenlernt, den Nachwuchs aus Auras Beziehung mit dem für tot erklärten Gillian. Jedoch erwartet die beiden auch schon die nächste Überraschung: Tess und Gian berichten von merkwürdigen Visionen, die sie gemeinsam in ihren Träumen durchleben. Je tiefer sie in ihre Gedanken eindringen, desto klarer eröffnen sich die Bilder von Lysander und dessen Vergangenheit, aber auch die Ereignisse, die damals zwischen Lysander und Auras Vater standen.
Dadurch öffnet sich eine neue Spur zum verschollenen Erzfeind, der scheinbar auf den Spuren der Tempelritter im Kaukasus gastiert. Die Pläne von Aura und Christopher, Lysander und seinem Tross nach Georgien zu folgen, werden aber jäh unterbrochen, als die mittlerweile dem Wahnsinn verfallene Charlotte Institoris ihren Hass auf die Kinder abwälzt und Gian bei der Flucht vor seiner grausamen Großmutter eine noch seltsamere Entdeckung macht.
_Persönlicher Eindruck_
Die dritte Episode von Kai Meyers Meisterwerk „Die Alchimistin“ beginnt mit einer enormen Überraschung; der Autor wagt einen deutlichen Zeitsprung von immerhin sieben Jahren und vollzieht hierbei einen radikalen Schnitt, der die gesamte Szenerie in ihren Grundzügen verändert. Die Personen, die Aura bis dato etwas bedeutet haben, sind allesamt dahingeschieden, die Fehde mit Lysander erhält plötzlich eine ganz andere Perspektive, aber auch die generellen Personenkonstellationen erfahren einen teils sehr heftigen Wandel, ganz besonders, was die Beziehung zwischen Aura und Christopher anbelangt. Nach den anfänglichen Anfeindungen entsteht hier zunächst eine Zweckgemeinschaft, in der die beiden Protagonisten lernen, den jeweils anderen zu schätzen und schließlich auch Emotionen aufzubringen, die über Auras Hass und Christophers Ablehnung hinausgehen. Und dies ist nur eine von vielen unerwarteten Entwicklungen innerhalb der Handlung.
So tauchen innerhalb der Story wieder Figuren auf, die man eigentlich schon im Jenseits wähnte, was partiell aber auch zu Widersprüchen in der Handlungslogik führt. Gerade was den Aufenthalt und die Befindlichkeit von Lysander betrifft, läuft hier manche Erklärung ein wenig aus dem Ruder, wird aber dankenswerterweise im Nachhinein wieder aufgefangen. Derlei Ungereimtheiten sind dieses Mal häufiger an der Tagesordnung, zumeist jedoch auf das noch deutlicher verschachtelte Konzept zurückzuführen, dessen Komplexität durch die sehr rasanten Fortschritte der Story noch einmal gehörig anwächst. Doch bei der souveränen Bewältigung der unheimlich verzwickten Story-Arrangements trennt sich in diesem Fall die Spreu vom Weizen, was schließlich dazu führt, dass „Die Alchimistin“ spätestens mit dieser Episode an vergleichbaren Produktionen wie „Das Schwarze Auge“ vorbeizieht und in Führung geht.
Allerdings lehnen die Macher sich auch sehr weit aus dem Fenster; die Einbeziehung des Templerordens ist in Zeiten von literarischen Verschwörungstheorien sicherlich ein riskantes Element (andererseits erschien „Die Alchimistin“ bereits 1998 und die diesmal herangezogene Fortsetzung 2001, also einige Jahre vor dem Dan-Brown-Boom), wird in dieser Folge aber erst einmal nur grob angerissen.
Die vereinzelten morbiden Inhalte sowie das Spiel mit den grausamen Visionen indes bedürfen auch einer detailreichen Inszenierung, um nicht aufgesetzt zu wirken. Aber auch in diesem Bereich erlaubt man sich keine Schnitzer und überzeugt mit vielen genialen Ideen und einer astreinen Leistung auf Seiten der Sprecher. Yara Blümel-Meyers (Aura), Timmo Niesner (Christophr) und vor allem Friedhelm Park in der Position des Erzählers erledigen einen richtig guten Job und empfehlen sich einmal mehr für noch größere Aufgaben. Hinzu kommt schließlich der majestätische Soundtrack, der an den entsprechenden Stellen für Gänsehaut sorgt und die dichte Atmosphäre des Hörspiels adäquat unterstützt. Alles andere als von Ohrenkino zu sprechen, wäre daher auch eine glatte Untertreibung.
Zusammengefasst kristallisiert sich mit „Die Katakomben von Wien“ das bisherige Highlight der Serie heraus, da es die Story auf ein noch höheres Niveau bringt, zusätzlich aber auch mit viel Risikobereitschaft neue Entwicklungen zulässt, welche die Geschichte ziemlich auf den Kopf stellen. Fortschritte beim Charakterdesign und vor allem inhaltlicher Natur vollenden schließlich einen nahezu ausnahmslos gelungenen Versuch, ein perfektes Hörspiel zu kreieren und mit modernen Mitteln auszustaffieren. Spätestens mit dieser Episode entwickelt sich „Die Alchimistin“ zur Hörspiel-Referenz im Jahr 2008.
|70 Minuten auf 1 CD
ISBN-13: 978-3-7857-3593-0|
http://www.kai-meyer.com
http://www.luebbe-audio.de
http://www.stil.name
Weitere Titel von Kai Meyer auf |Buchwurm.info|:
[Interview mit Kai Meyer]http://www.buchwurm.info/artikel/anzeigen.php?id=11
[„Der Brennende Schatten“ 4506 (Hörspiel)
[„Die Vatikan-Verschwörung“ 3908 (Hörspiel)
[„Die Wellenläufer“ 3247 (Hörbuch)
[„Die Muschelmagier“ 3252 (Hörbuch)
[„Die Wasserweber“ 3273 (Hörbuch)
[„Frostfeuer“ 2111 (Hörbuch)
[„Die Alchimistin“ 73
[„Das Haus des Daedalus“ 373
[„Der Schattenesser“ 2187
[„Die Fließende Königin“ 409
[„Das Buch von Eden“ 890 (Hörbuch)
[„Das Buch von Eden“ 3145
[„Der Rattenzauber“ 894
[„Faustus“ 3405
[„Seide und Schwert“ 3558 (Das Wolkenvolk 1, Hörbuch)
[„Lanze und Licht“ 4549 (Das Wolkenvolk 2, Hörbuch)
[„Drache und Diamant“ 4574 (Das Wolkenvolk 3, Hörspiel)
Wie auch der „Super-Papagei“, der „Phantomsee“ und der „Karpatenhund“, gehört „… und die schwarze Katze“ ebenfalls zur ersten Tranche der Veröffentlichungen aus dem Hause |EUROPA| und datiert somit zurück auf den 12. Oktober 1979. Im Laufe der folgenden (fast) 30 Jahre summierten sich die Hörspiele der drei kultigen Junior-Detektive auf über 120 auf. Zwischendrin gab es in den Neunzigern mal einen etwas größeren Hänger und neuerliche Lizenzstreitigkeiten, welche Ende 2007 beigelegt wurden. Seither geht es mit den Vertonungen der Buchreihe weiter, was Fans – altgediente und neue – zum Aufatmen brachte.
_Zur Story_
Ein Wanderzirkus/Jahrmarkt gastiert in Rocky Beach, und unsere drei Helden Justus, Peter und Bob liefern für den Zirkus etwas im Auftrag von Justus‘ Onkel Titus, den Schrotthändler, aus – ein Podest für die Löwen-Nummer. Dabei werden sie Zeugen eines Diebstahls: Ein bärtiger Mann mit Schlapphut entwendet eine hässliche, schwarze Plüschkatze von einem Stand und schickt sich an, sich aus dem Staub zu machen. Flugs nehmen die drei Junior-Detektive die Verfolgung in sicherem Abstand auf. Als der Dieb in eine scheinbare Sackgasse flüchtet, werden die Gesichter der drei ??? und der herbeigeeilten Sicherheitskräfte lang: Der Mann ist verschwunden.
Obwohl ein etwa vier Meter hoher und massiver Bretter-Zaun sein Entkommen hätte verhindern müssen, ist er offensichtlich weg; seine Fußspuren führen bis zum besagten Zaun und enden dort abrupt. Zumindest war er nicht in der Lage, die Katze endgültig zu entwenden, denn sie liegt zurückgelassen auf dem Boden. Die drei Jungs bringen die Katze zurück zum Schießstand, woher sie stammt, und Peter kommt auf die Idee, sein Glück zu versuchen und das seltsame Maskottchen regulär zu gewinnen. Gesagt, getan – Peter räumt tatsächlich mit fünf Schuss alle Ziele ab und ist nun rechtmäßiger Besitzer der Plüschkatze.
Die Freude über den Gewinn währt jedoch nicht lang, denn irgendjemand hat den (eigentlich harmlosen) Jahrmarkts-Löwen aus seinem Käfig gelassen, und als Peter die Stellung hält, um den Löwen zu beruhigen, legt er die Katze unbeachtet zur Seite, während die anderen zusammen mit dem Jungen Andy Carson, dem Sohn des Zirkus-Veranstalters, Hilfe holen. Als die Situation dank des Löwenbändigers geklärt wird, ist die Katze verschwunden, und nicht nur das: Die drei Detektive finden dank Andy heraus, dass es seit Monaten immer wieder zu scheinbaren „Unfällen“ beim Wanderzirkus kam.
Außerdem taucht am nächsten Tag eine Zeitungsannonce im lokalen Blatt auf, in der irgendjemand vorgeblich für ein Kinderheim nach exakt jenen Katzen sucht, wie sie Andy an seinem Schießstand als Hauptpreis hat, zu einem Preis von 25 Dollar das Stück. Doch wer will schon eine augenscheinlich so hässliche schwarze, bucklige Stoffkatze mit krummen Beinen, abgenicktem Ohr, die ein Auge zukneift, für ein Kinderheim? Steckt etwa ein Mitarbeiter des Jahrmarkts dahinter, oder gar – wie Andy vermutet – seine Großmutter, die geschworen hat, den Zirkus zu ruinieren? Die drei ??? haben jedenfalls mal wieder einen Fall zu lösen.
_Eindrücke_
Nicht zu überhören ist der berühmte, unvergleichliche Horst Frank, der uns auch in dieser Folge wieder als Hauptkommissar Samuel Reynolds beglückt. Er und auch Urgestein Peter Pasetti (Erzähler / Alfred Hitchcock) weilen seit Mitte der 90er leider nicht mehr unter uns. Bedauerlicherweise ist die alte Musik in der Neuauflage dem modernen Soundtrack gewichen; Nostalgieanflüge werden dennoch geweckt, doch irgendwie ist das nicht dasselbe, aber man gewöhnt sich dran.
Das Drehbuch stammt von H. G. Francis, der das Originalbuch von William Arden aus dem Jahre 1970 (US) bzw. 1971 (D) für das Hörspiel aufbereitete. Bezeichnenderweise ist „Die schwarze Katze“ eigentlich Buch Nr. 13 (gleich zwei unglücksbringende Faktoren: eine schwarze Katze und die Zahl 13) und nicht wie bei den Hörspielen die Nummer vier, was daran liegt, dass man sich auf Seiten |EUROPA|s nicht an die amerikanische Reihenfolge gehalten hat. Ursprünglich sollte „Das Gespensterschloss“ den Auftakt zur Serie bilden, wurde aber aus Marketing-Gründen erst als Folge elf veröffentlicht. Regie führt auch in diesmal Heikedine Körting, die ab und zu in den Hörspielen auch als Sprecherin unter Pseudonym einspringt.
Gehen die Sprecher wieder vollkommen in Ordnung und sind über jeden Zweifel erhaben, so haben sich auf der anderen Seite doch kleinere Mängel eingeschlichen: Mal abgesehen davon, dass hier wieder mal der Mystery-Faktor nicht gegeben ist und sich die Handlung auf eine typische Junior-Detektivgeschichte mit (relativ gut getroffenem) Jahrmarktsflair beschränkt, ist „Die schwarze Katze“ eine der schwächeren Folgen und krankt daran, dass sie zu gekünstelt und konstruiert wirkt. Auch logische Fehler sind nicht ganz von der Hand zu weisen. Ohne jetzt zu viel von der Handlung zu verraten, sei hier dennoch ein Beispiel angeführt:
Als die Jungs mit einer gefälschten Stoffkatze vor dem Haus des mutmaßlichen Täters stehen (der diese ja für 25 Dollar aufkaufen will), diskutiert man darüber, wer hineingeht, Andy fällt natürlich aus, denn sollte der Dieb beim Zirkus arbeiten, würde er ihn natürlich erkennen und Verdacht schöpfen. So einigt man sich auf Peter und Bob, mit einer Erklärung von Justus, die nicht logisch nachvollziehbar ist, denn der Dieb hat ja Peters Katze bereits gestohlen und dürfte ihn zweifelsohne ebenfalls wiedererkennen. Zudem ist dem Täter auch die Katze vertraut und es ist unwahrscheinlich, dass er auf die Fälschung hereinfällt, zumal er ja ganz genau weiß, dass er Peter seine gewonnene Katze schon auf dem Jahrmarkt abgeluchst hat.
_Steif(f)tier – Das Fazit_
Eine recht schwache Folge, die mit allerhand Fehlern und zu vielen „Zufällen“ gespickt ist. Sie hat überdies schlichtweg zu wenig Pep, und es fehlt ihr die Spur von geforderter Kombinationsgabe, die sonst in fast allen ???-Hörspielen erforderlich ist. Gerade das Ende, als die Identität des Schurken bereits klar ist auch, und was er bezweckt, wird krampfhaft versucht, die Spannung noch einmal final in die Höhe zu treiben. Das hätte man lieber vorher tun sollen. So verkommt der Showdown leider zu einer mäßigen Brechstangen-Farce.
_Die Hörspieldaten auf einen Blick:_
Titel: „Die drei ??? und die schwarze Katze“ – Folge 4
Buch-Autor: William Arden
Drehbuch: H. G. Francis
Produktion & Regie: Heikedine Körting
Label: EUROPA Studio (jetzt BMG Ariola Miller)
Ersterscheinung: 12.10.1979
Musik: Conrad, Morgenstern, Zeiberts
Die Figuren und ihre Sprecher:
Erzähler (alias Alfred Hitchcock): Peter Pasetti
Erster Detektiv – Justus Jonas: Oliver Rohrbeck
Zweiter Detektiv – Peter Shaw: Jens Wawrczeck
Recherchen & Archiv – Bob Andrews: Andreas Fröhlich
Andy Carson: Stefan Schwade
Mr. Carson: Reiner Brönneke
Khan, „Der Kraftmensch“: René Genesis
Der einzigartige Gabbo: Iwan Raszinsky (Karl-Ulrich Meves)*
Iwan der Grosse: Borris Stepin
Hauptkommissar Reynolds: Horst Frank
Junge: Philip Baader
*) Pseudonym, Klarname in (Klammern)
http://www.natuerlichvoneuropa.de/area__ddf/index.php?sid=1
_Extrem brutal: der Flitterwochenmörder_
Ein eiskalter Mörder tötet Flitterwöchner noch in der ersten Hochzeitsnacht – um herauszufinden, was das Schlimmste ist, das jemand tun kann. Doch alle weibliche Opfer verbindet etwas, und das ist der Schlüssel zur ungewöhnlichen Aufklärung des Falls. Denn diesmal wird nicht ein Einzelner wie Dr. Alex Cross aktiv, sondern gleich ein ganzer Klub von couragierten Frauen: der Mordklub.
Dies ist der erste Roman in einer neuen Reihe, die einfach von eins aufwärts durchnummeriert ist. Der 1. Band heißt daher „1st to die“, der nächste „2nd Chance“, „3rd Degree“ und so weiter.
_Der Autor_
James Patterson, ehemaliger Besitzer einer Werbeagentur, ist der Autor zahlreicher Nummer-1-Bestseller. Allerdings sind es vor allem seine Alex-Cross-Thriller, die den Leser berühren. Folglich war Alex Cross bereits zweimal im Film zu sehen: „Im Netz der Spinne“ und „… denn zum Küssen sind sie da“ wurden beide erfolgreich mit Morgan Freeman in der Hauptrolle verfilmt. Für Einsteiger sei gesagt, dass Alex Cross ein sympathischer schwarzer Polizeipsychologe ist, der mit seiner Familie in Washington, D.C., lebt.
Patterson ist extrem fleißig. Sein letzter Solo-Roman vor „Blood“ in Deutschland hieß „Ave Maria“, ein Alex-Cross-Roman. Davor erschienen neue Alex-Cross-Romane mit den Titeln „The Big Bad Wolf“ und „London Bridges“. Im Original ist bereits „Double Cross“ erschienen. Seit 2005 sind weitere Patterson-Kooperationen veröffentlicht worden, darunter „Lifeguard“ sowie „Judge and Jury“; im Juli 2007 erschien die Zusammenarbeit „The Quickie“ (deutsch „Im Affekt“, 2008). Im Frühjahr 2003 (deutsch Mitte 2005) erschien auch eine Kollaboration mit dem Titel „Die Rache des Kreuzfahrers“ („The Jester“), deren Story im Mittelalter spielt.
Nähere Infos finden sich unter http://www.twbookmark.com und http://www.jamespatterson.com. Patterson lebt mit seiner Familie in Florida und Westchester, New York.
|The Women’s Murder Club| umfasst bislang folgende Bände:
1. Der 1. Mord
2. Die 2. Chance
3. Der 3. Grad (zusammen mit Andrew Gross)
4. Die 4. Frau (zusammen mit Maxine Paetro)
5. Die 5. Plage (zusammen mit Maxine Paetro)
6. Die 6. Geisel (zusammen mit Maxine Paetro)
7. 7th Heaven (zusammen mit Maxine Paetro)
8. 8th Confession
Mehr von James Patterson auf |Buchwurm.info|:
[„Das Pandora-Projekt“ 3905 (Maximum Ride 1)
[„Der Zerberus-Faktor“ 4026 (Maximum Ride 2)
[„Das Ikarus-Gen“ 2389
[„Blood“ 4835
[„Honeymoon“ 3919
[„Ave Maria“ 2398
[„Wer hat Angst vorm Schattenmann“ 1683
[„Mauer des Schweigens“ 1394
[„Stunde der Rache“ 1392
[„Wenn er fällt, dann stirbt er“ 1391
[„Wer sich umdreht oder lacht“ 1390
[„Die Rache des Kreuzfahrers“ 1149
[„Vor aller Augen“ 1087
[„Tagebuch für Nikolas“ 854
[„Sonne, Mord und Sterne“ 537
[„Rosenrot Mausetot“ 429
[„Die Wiege des Bösen“ 47
_Die Sprecherin_
Nicole Engeln arbeitet als Schauspielerin und Sprecherin. Neben ihren verschiedenen Theaterengagements spielt sie in vielen TV-Serien mit. Ihre Stimme kennt man aus zahlreichen Produktionen großer Fernsehsender. (Verlagsinfo) Sie liest eine von Stefan Hackenberg gekürzte Lesefassung.
Regie in den |Interface Recording Studios|, Köln, führte Stefan Hackenberg.
_Handlung_
Lindsay Boxer ist die einzige Inspektorin in der Mordkommission des San Francisco Police Department (SFPD). Da muss sie manchmal ganz schön hart im Nehmen sein. So wie jetzt, denn nichts hat sie auf den Horror der Flitterwochenmorde vorbereitet. Der erste passiert im gleichen Hotel, in der auch die Hochzeit stattfand. Der zweite passiert verwirrenderweise draußen auf dem Land, im berühmten Weinbaugebiet des Napa Valley. Beide Male wurden an den schönen und wohlhabenden Opfern, die kurz vor ihrem Honeymoon Trip standen, grausame sexuelle Handlungen vorgenommen. Sie wurden nicht nur getötet, sondern auch in jeder Weise entwürdigt.
San Francisco ist dementsprechend geschockt und will schnell Aufklärung der Untaten und die Ergreifung des Monsters. Das ist leichter gesagt als getan. Zum Glück gelingt es ihr, eine neugierige junge Journalistin auf ihre Seite zu ziehen und mit ihr und Claire, Lindsays bester Freundin, einer Gerichtsmedizinerin, einen Klub der Detektivinnen zu gründen. Später ziehen sie noch eine Staranwältin hinzu – wer hätte das gedacht? Schon bald zeitigt das Puzzlespiel der Frauen erste Erfolge.
Doch Lindsay hat auch ein ganz privates Problem, das sie unmittelbar bedroht: Ihr Arzt entdeckt bei ihr eine Blutkrankheit, eine zunehmende Knappheit an roten Blutkörperchen. Als Folge des resultierenden Sauerstoffmangels kippt sie ab und zu in Stresssituationen einfach um. Gut, dass sie einen neuen Freund hat: Chris Raleigh. Nachdem sie ihr Misstrauen überwunden hat, erweist sich der Nichtpolizist Raleigh an ihrer Seite als wahre Stütze. Doch wie kann man eine Beziehung aufbauen, wenn man die wichtigste Wahrheit nicht sagen kann, weil dadurch die Beziehung zum Scheitern verurteilt wäre?
In diesen Zweifrontenkrieg Lindsays platzt die Nachricht eines weiteren Honeymoon-Mordes wie eine Bombe: Der Mörder hat im fernen Cleveland zugeschlagen. Treibt er nun im gesamten Land sein Unwesen? Als die Videoaufnahmen das Gesicht des ungebetenen Hochzeitsgastes enthüllen, traut Lindsay ihren Augen kaum: Der Killer ist eine weltbekannte Persönlichkeit. Wie soll sie ihn zur Strecke bringen?
Wer wird als erster mit dem Sterben dran sein: das nächste Opfer, der Killer oder – Lindsay?
_Mein Eindruck_
„Roses are red / Rosenrot, mausetot“ hatte mich seinerzeit mit seinem hammerharten Schluss absolut umgehauen. Daher wagte ich nicht zu hoffen, dass Patterson ein weiteres Mal dieses Kunststück fertigbringen würde. Und dem ist auch so: „1st to die“ geht viel weiter in die Breite und drückt weitaus stärker auf die Tränendrüsen als „Roses are red“. Dieses Buch ist ergreifend. Dennoch bleibt das Buch spannend bis zur letzten Szene, weil es dem Autor gelingt, immer wieder ein neues Karnickel aus dem Hut zu zaubern, eine neue Wendung einzubauen, auf die der Leser nicht – und die Hauptfigur schon gar nicht – vorbereitet ist.
Was sich schon bei „Roses“ anbahnte, setzt sich hier verstärkt fort: Nicht mehr heroische Männer wie Alex Cross stehen im Mittelpunkt des Geschehens, sondern vielmehr starke Frauen. Doch auch diese sind aufeinander angewiesen, sowohl beruflich wie auch privat, wie Lindsays Krankheit zeigt, sonst würden sie scheitern. Die Anwältin beispielsweise wird benötigt, um sich überhaupt an den prominenten Killer heranzuwagen – und dennoch setzt sie ihre Karriere dafür aufs Spiel.
Was ich hier um den Erhalt der Spannung willen nicht sagen darf, aber mit das Wichtigste am Buch ist, ist natürlich der Mörder. Die ersten vier Morde begeht er sowohl skrupellos als auch in erniedrigender Absicht. Dennoch will er etwas herausfinden: Was ist das Schlimmste, was man tun kann? Beim dritten Doppelmord mischt sich eine persönliche Beteiligung in die Tat, eine Art Rachsucht. Natürlich überrascht uns der Autor: Im Handumdrehen haben wir es mit mehr als nur einem möglichem Täter zu tun, aber welcher ist der richtige? Menschen können sich verkleiden. Bis zum Schluss bleibt diese ungewisse Spannung erhalten, und man kann nur um die Unversehrtheit Lindsays bangen.
Patterson kennt seine Schauplätze aus dem Effeff, als ob er selbst dort gewesen sei. Man nimmt ihm die Akkuratheit seiner Beschreibungen ohne Weiteres ab. Und wo der Hintergrund als sicher gilt, kann bekanntlich im Vordergrund alles Mögliche passieren.
_Die Sprecherin_
Nicole Engeln legt sich ins Zeug, um die Emotionen der Figuren deutlich zum Ausdruck zu bringen. Das gelingt ihr naturgemäß besser bei den weiblichen als bei den männlichen Figuren. Die Frauen klingen durchweg freundlicher und zugänglicher als die Männer. Das heißt nicht, dass alle Frauen eine so hohe Stimme haben müssen wie Cindy Thomas. Bestes Gegenbeispiel ist Claire Thomas, die patente, mütterliche und schwarze Chefpathologin und beste Freundin Boxers: Sie hat eine tiefe Altstimme, mit der sie ganz schön viel Autorität ausstrahlt. Ihr genaues Gegenteil ist die gluckenhafte Mami der Braut Becky, welche ebenso verzückt wie völlig hirnlos klingt. Das kann Claire Thomas nie passieren.
Die Männer sind häufig relativ aggressiv, insbesondere in der Polizeitruppe. Schon Warren Jacobi drückt mit seiner tiefen Stimme großen Sarkasmus aus. Und als Cindy Thomas unerkannt zum ersten Tatort vordringt, wird sie aggressiv angefaucht, sie solle sich rausscheren. Dann gibt es noch mehrere Ärzte, die leicht blasiert klingen. Bei Dr. Medwed setzt die Sprecherin einen deutlich hörbaren slawischen Akzent ein, indem sie die Rs rollt und das Ch möglichst kehlig ausspricht.
Engelns einzige Schwäche ist ihre Unkenntnis darüber, wie man bestimmte englische Namen ausspricht. Den Nachnamen von Chris Raleigh spricht [rejli] statt [rå:li] aus. Und Napa Valley klingt bei ihr seltsam: Sie sagt [nejpa] statt [näpa]. Vielleicht sollte sie einfach mal hinfahren oder einen Experten fragen. Ihre Kollegin Julia Fischer ist da wesentlich kenntnisreicher.
|Sounds|
Die hier einegsetzten Sounds sind sowohl Geräusch als auch Musik. Es fällt mir schwer, sie als das eine oder andere zu bezeichnen. Wie auch immer: Diese „Klänge“ dienen dazu, dem Hörer eine zusätzliche Gänsehaut des Grauens zu verursachen, so klirrend schräg klingen sie. Weil sie nur in den Pausen zwischen den kurzen Kapiteln zu hören sind, sind sehr kurz, maximal 2-3 Sekunden, und es gibt nur zwei verschiedene Klänge. Aber solche schauderhaften musikalischen Motive würde man nie in einer TV-Krimi-Serie zu hören bekommen. Die weiblichen Zuschauer würden in Scharen davonlaufen.
_Unterm Strich_
Mit der Betonung der emotionalen und sozialen Dimension des Verbrechens begibt sich Patterson auf das Spielfeld eines anderen bekannten Spannungsautors, auf das von Dean Koontz. Koontz hat sich wegbewegt vom Übernatürlichen, Unerklärlichen hin zu höchst seltsamen Praktiken der Psychologie, dem Wahnsinn von Serienkillern. Bei Pattersons Killern hat dieser Wahnsinn noch Methode: dahinter steckt der Wunsch zu erkennen und zu schocken.
Glücklicherweise sind Pattersons Bücher noch wesentlich dünner und schneller zu lesen als die Ziegelsteine, die Koontz in den 90er Jahren produziert hat. Die superkurzen Kapitel, das Markenzeichen jedes Patterson-Romans, erlauben praktisch keine Atempause. Zudem schrieb Patterson diesen ersten Band noch völlig selbständig, die Folgebände ließ er schreiben.
|Das Hörbuch|
Alles in allem ist dies ein sehr lebhafter und abwechslungsreicher Vortrag. Engelns einzige Schwäche ist ihre Unkenntnis darüber, wie man bestimmte englische Namen ausspricht.
Da dieses Hörbuch keine Sonderausgabe des ADAC ist wie etwa „Die 5. Plage“ aus dem gleichen Hause, kostet die CD-Box auch entsprechend mehr, nämlich rund 20 €uronen. Das ist aber immer noch günstig, besonders für einen so erfolgreichen Autor wie Patterson, der durchaus hohe Honorare für seine Veröffentlichungsrechte verlangen kann.
|Originaltitel: 1st to die, 2001
Aus dem US-Englischen übersetzt von Edda Petri
390 Minuten auf 5 CDs
ISBN-13: 978-3-86804-495-9|
http://audiomedia.de/category/verlag/hoerbuch/target-mitten-ins-ohr/
http://www.jamespatterson.com