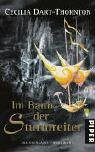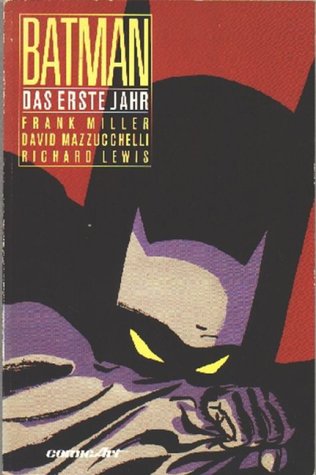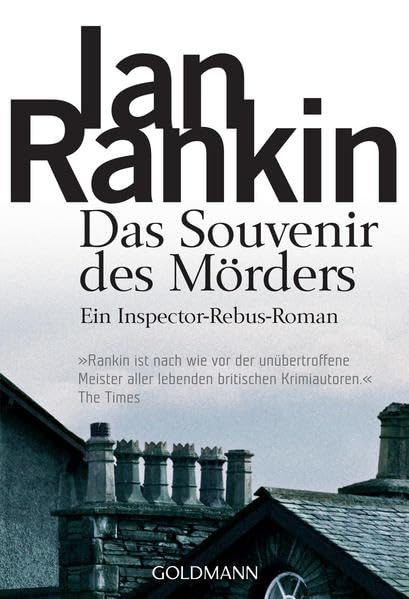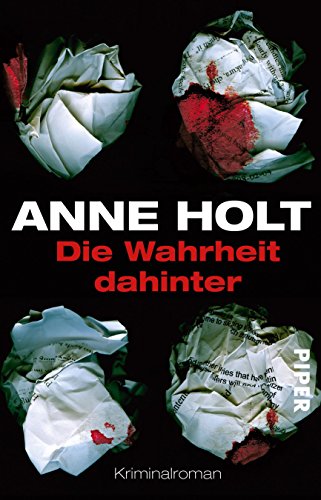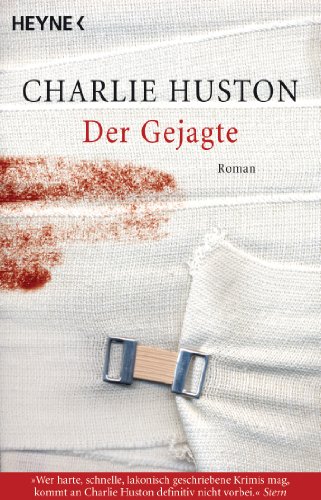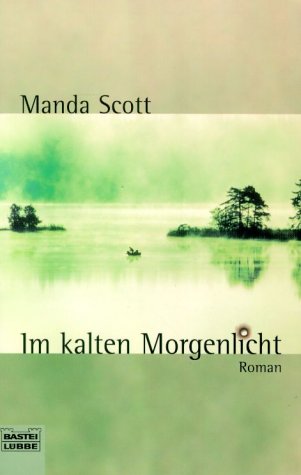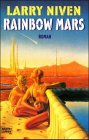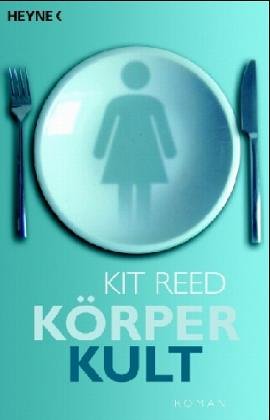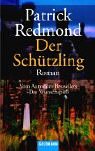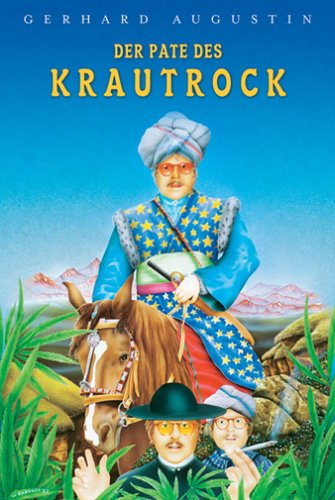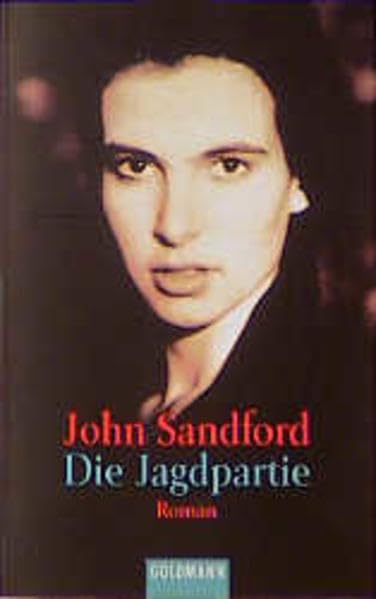„Im Bann der Sturmreiter“ erzählt die Geschichte von Imrhien. Wobei Imrhien eigentlich gar nicht so heißt, denn Imrhien ist ein Findelkind. Nicht eines, das als Säugling irgendwo vor eine Tür gelegt oder einfach ausgesetzt wurde, sondern eines, das schon auf dem Weg zum Erwachsenwerden ist, als man es findet. Sein Gesicht ist durch das Gift eines Efeus grausam entstellt, es kann nicht sprechen und sich an nichts erinnern. Eine alte Dienstmagd nimmt sich seiner an und päppelt es auf. Schon bald muss es bei der Arbeit helfen, schwerer Arbeit. Und es leidet unter dem Abscheu seiner Umgebung, der Gleichgültigkeit und Kälte, der Missachtung. Als sich eines Tages die Möglichkeit bietet, von der Festung Isse zu fliehen, nimmt es diese Möglichkeit wahr. Es will seine Identität wiederfinden! Als Piraten das Windschiff angreifen, auf dem es sich versteckt hat, kommt es vom Regen in die Traufe. Wieder wird es bedrängt und gequält, sodass es schließlich in seiner Verzweiflung einfach über Bord springt. Es landet in einem Wald voller Dunkelelfen …
Cecilia Dart-Thornton tastet sich nur langsam an dieses Kind heran. Im Prolog nennt sie es noch Geschöpf. Erst als es von der alten Dienstmagd Hemd und Hose erhält und von der Kleidung der anderen auf seine eigene schließt, nennt die Autorin es Junge. Als wäre er ein Neugeborenes, muss er sich erst langsam in diese fremde Welt hineintasten, in die er geraten ist. Da er keinerlei Erinnerungen mehr hat, ist er völlig entwurzelt, und durch die Ablehnung seiner Umgebung kann er keine neuen Wurzeln schlagen. Doch er ist nicht dumm und lernt eine Menge durch lauschen und beobachten.
Die eigentliche Zeit des Lernens beginnt jedoch, als er durch den Wald zieht. Hier hat er zum ersten Mal einen Begleiter, der ihn nicht von vornherein als Krüppel abtut, sondern ihn ernst nimmt. Dieser Abenteurer namens Sianadh bringt ihm die Zeichensprache bei, erzählt ihm von der Vergangenheit des Landes und von Licht- und Dunkelelfen. Von ihm erhält er auch seinen Namen Imrhien.
Als die beiden die Stadt erreichen, findet Imrhien auch neue Freunde in Sianadhs Familie. Dessen Schwester ist eine Heilerin, und wenn sie selbst auch nicht die Macht besitzt, Imrhiens Gesicht zu heilen, so weiß sie doch eine Frau, die diese Macht besitzen könnte: Maeve Einauge. Voller Hoffnung macht Imrhien sich auf den Weg zu dieser Frau! Denn das eigene Gesicht wiederzufinden, bedeutet vielleicht auch, den wahren Namen und die Erinnerungen wiederzufinden.
Imrhien besitzt eine rasche Auffassungsgabe und einen gesunden Menschenverstand, doch die Scham über seine Entstellung macht das Findelkind scheu und zurückhaltend, besonders als es sich verliebt. Die unzähligen Demütigungen haben keine Rachsucht, sondern Mitgefühl hervorgebracht, es weiß, wie ein Ausgestoßener sich fühlt, und handelt entsprechend. Seine Handlungsweise stößt aber durchaus nicht immer auf Verständnis oder gar Zustimmung. Vor allem gegen Sianadhs Sohn Diarmid, der es auf seiner Reise zu Maeve Einauge begleitet, kann es sich nur schwer durchsetzen, dazu fehlen ihm das Selbstbewusstsein und eine Stimme. Sprechende Hände sind nur aus der Nähe sichtbar und leicht zu ignorieren.
Sianadh ist leichter zu überzeugen, wenn er eine Torheit vorhat. Spätestens, nachdem ihm eine missachtete Warnung ein paar gebrochene Rippen eingebrockt hat, ist er bereit, auf Imrhien zu hören. Der gutmütige, leutselige Mann, der sich selbst gern als Bär bezeichnet, liebt gute Geschichten und gutes Essen. Letzteres ist im Wald nicht immer zu bekommen. Aber Sianadh hat Erfahrung mit der Wildnis. Mit der Stadt offenbar weniger, dort tappt er von einem Fettnäpfchen ins nächste.
Diarmid ähnelt seinem Onkel nur wenig. Er ist ein wenig steif und förmlich, seine Treue und Ergebenheit gehört ganz und gar dem König. Er färbt sich sogar die roten Haare, damit man ihm seine Abstammung von den Ertish nicht ansieht. Denn er ist von dem brennenden Ehrgeiz beseelt, bei den Dainnan, der Elitetruppe des Königs, aufgenommen zu werden. Als sie unterwegs einem dieser Dainnan begegnen, erhält sein Stolz einen ziemlichen Dämpfer. Doch er ist entschlossen zu lernen.
Sein Verhältnis zu Imrhien ist geprägt von Unsicherheit. Imrhien passt nicht ganz in das Schema seines Weltbildes, deswegen verhält er sich distanziert und kühl, lässt aber keinen Zweifel daran, dass er seine Aufgabe als Beschützer außerordentlich ernst nimmt. Für ihn bedeutet das auch, dass Ihmrhien sich unterzuordnen hat. Das ist nicht unbedingt immer zu beider Vorteil!
Dorn, der Dainnan, ist eine Mischung zwischen Krieger und Waldläufer, so eine Art Aragorn, nur nicht so ernst und grimmig. Dorn lächelt gern und schafft es sogar, in der Zeichensprache zu scherzen. Gleichzeitig haftet ihm ein Hauch von Melancholie an, deren Ursprung lediglich einmal kurz angedeutet wird. Ansonsten wird seine Vergangenheit kein einziges Mal erwähnt. Aber diese eine Andeutung genügt, um den Leser zu der Frage zu veranlassen, ob Dorn sich sein Haar wirklich nur aus modischen Gründen färbt.
Ebenso gekonnt wie die Hauptpersonen schildert die Autorin auch Charaktere, die nur ganz kurz vorkommen, wie Ustorix, der älteste Sohn der Herrscher von Isse, oder der Fechtmeister Mortier. Aufgrund dieser präzisen Darstellung würde der Leser erwarten, dass sie später noch einmal vorkommen, was aber nicht der Fall ist. Die Handlung konzentriert sich ganz auf Imrhien und weicht so gut wie nie von diesem Handlungsstrang ab. Im Grunde wäre es nicht nötig, an diesem einen Strang so festzukleben, denn die Geschichte wird nicht in der Ich-Form erzählt, trotzdem verschwinden alle Figuren, von denen Imrhien sich im Laufe der Geschichte entfernt, völlig in der Versenkung. Mag sein, dass Imrhien einfach nicht wichtig genug war, um nach seiner Flucht verfolgt zu werden. Andererseits fragt man sich, warum die Autorin sich die Mühe gemacht hat, Ustorix überhaupt zu erwähnen, wenn diese Szene nicht noch irgendwelche Auswirkungen auf das Geschehen hat. Das Ganze wirkt ein wenig irritierend, wie ein loser Faden, von dem man sich fragt, wozu er eigentlich aufgenommen wurde. Und davon gibt es noch mehr.
Nun ist „Im Bann der Sturmreiter“ ja „nur“ der erste Band eines Zyklus. Ich gehe deshalb davon aus, dass lose Fäden wie der von Ustorix und Mortier in den folgenden Bänden wieder aufgenommen werden. Abgesehen von diesen losen Fäden wirkt das Buch aber auch noch in anderer Hinsicht ein wenig unfertig. Die Abenteuer, die Imrhien unterwegs zu bestehen hat, sind einfach lose hintereinander aufgereiht, ohne einander zu bedingen oder sonst irgendwelche Auswirkungen auf die eigentliche Handlung zu haben. Sie bewirken keine Charakteränderung, sie dienen nicht zur Lösung irgendwelcher Rätsel und stellen keine neuen, die es zu lösen gälte. Das einzige Rätsel des Buches bleibt Imrhiens Herkunft und vielleicht noch Dorns Vergangenheit. Aber kaum etwas von dem, was Imrhien unterwegs zustößt, steht damit in irgendeinem Zusammenhang.
Es scheint, als dienten Imrhiens Reisen nur dazu, sämtlichen Gattungen, Arten und Unterarten von Licht- und Dunkelelfen einen Auftritt zu ermöglichen. Laut Quellenangabe war es das erklärte Ziel der Autorin, die Anderwelt so originalgetreu wiederzugeben wie möglich. Ihre Recherchen in den vielen schottischen und walisischen Quellen in Ehren, aber auf Dauer wirken die Massen an verschiedenen Nixen, Wichteln und sonstigen Geisterwesen eher ermüdend, es sei denn, man hegt dieselbe Begeisterung für derlei Geschichten wie die Autorin selbst. Für alle anderen wäre etwas weniger vielleicht mehr gewesen, denn wie gesagt, die vielen verschiedenen Begegnungen bleiben – bis auf eine – ohne Auswirkungen auf die Geschichte, und als Ausschmückung allein empfand ich ihre Auftritte zu massiv und erdrückend.
Ausschmückend ist auch die Sprache der Autorin. Hier kann man ihr tatsächlich einen hohen Grad an Virtuosität bescheinigen. Bilder und Stimmungen werden mit einer enormen Vielfalt an Ausdrücken bedacht, das gilt besonders für Kleidung, Lichtverhältnisse und Landschaftsbeschreibungen, aber auch die Geisterstürme und ihre Auswirkungen. In diese Welt einzutauchen, sie vor dem inneren Auge bildlich entstehen zu lassen, ist hier eine Kleinigkeit. Die Darstellung von Imrhiens Gefühlswelt bleibt dahinter ein gutes Stück zurück, obwohl der Leser durchaus immer wieder in seine Gedanken mit einbezogen wird.
An eigenen Ideen war in dem Buch – der vielen Anderweltbeschreibungen wegen – nicht mehr viel vorhanden. Die wenigen, die vorkamen, waren durchaus interessant und neu für mich, so zum Beispiel das Sildron, das besondere Gestein Dominit, das Geisterstürme abhalten kann, und natürlich die Sturmreiter und die Windschiffe. Gegen ein paar zusätzliche Einfälle dieser Art hätte ich gern einige von den Dunkelelfen eingetauscht.
Denn trotz aller Ausschmückung und trotz des massiven Einsatzes aller Arten von Geisterwesen kommt im Verlauf der Handlung nur wenig Spannung auf. Die ständig neuen Versuche der Dunkelelfen, die Protagonisten ins Verderben zu führen, werden irgendwann langweilig, vor allem, weil man jedes Mal vorher schon weiß, dass diese im letzten Moment entkommen werden. Die finstere Bedrohung, die während Imrhiens Aufenthalt in der Stadt nur ganz leise angedeutet wurde, ging bei der nächsten Reise wieder verloren, und über die Zusammenrottung im Norden und den drohenden Krieg erhält man zu wenig Hintergrundinformationen, um es als echte Bedrohung wahrzunehmen. Es tut sich nicht wirklich etwas, der Spannungsbogen hängt durch.
So war dieser Einstieg in den Zyklus doch etwas langatmig und gewissermaßen ereignislos. Bleibt zu hoffen, dass in den Folgebänden das Erzähltempo ein gutes Stück anzieht, sich die vielen sinnlosen Fäden zu einem sinnvollen Netz zusammenfinden und die hingehauchten Andeutungen etwas handfester werden. Denn als brillant und einen Genuss für Freunde von Tolkien und Sara Douglass, wie der Klappentext vollmundig anpreist, kann man diesen Einstieg noch nicht bezeichnen. Vor allem hinter der Vielschichtigkeit des |Weltenbaum|-Zyklus bleibt dieses Buch bisher noch weit zurück. Mit etwas mehr Schwung und Bewegung im Handlungsverlauf und einem engeren Zusammenhang der einzelnen Ereignisse untereinander, etwas mehr Konzentration auf die interessanten und gelungenen Hauptfiguren und weniger auf die Wesen der Anderwelt, könnte sich der Zyklus aber durchaus noch zu einem guten Buch entwickeln!
|Piper| hat wieder ein recht ordentliches Lektorat abgeliefert, nur würde mich interessieren, ob der Wald Tiriendor oder Tieriendor heißt. Das Cover ist vom optischen Eindruck her so elegant und gelungen, dass ein Einwand gegen die absolut untauglichen Segel des Windschiffs als prosaisch abgelehnt werden muss. Auch ohne Schutzumschlag ist dieser Band eine sehr schöne Ausgabe, dunkel gebunden und mit Leseband. Die Karte im Buchdeckel ist trotz Gold-auf-Schwarz-Druck gut lesbar, nur die Küstenlinien erfordern eventuell einen zweiten Blick.
Cecilia Dart-Thornton, selbst ein Findelkind, wuchs in der Nähe von Melbourne auf. „Im Bann der Sturmreiter“ gehört zu den |Feenland-Chroniken|, deren zweiter Teil „Das Geheimnis der schönen Fremden“ im Oktober erscheinen soll. Eine Herausgabe des dritten Bandes in deutscher Sprache ist momentan noch nicht Sicht, dürfte aber nicht allzu lang auf sich warten lassen. Die Autorin schreibt inzwischen an ihrem nächsten Zyklus, dessen erster Band „The Iron Tree“ im Februar erschienen ist. Neben dem Schreiben widmet sie sich außerdem der Musik und der Photographie.
http://www.dartthornton.com