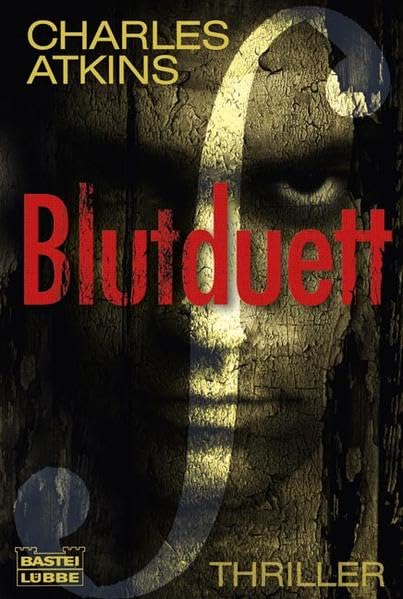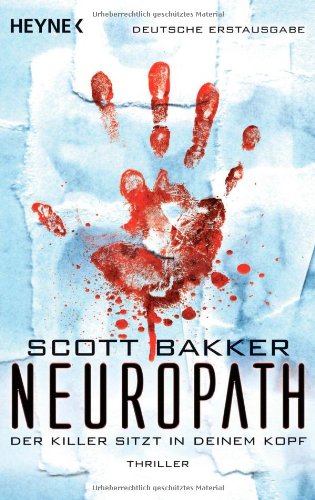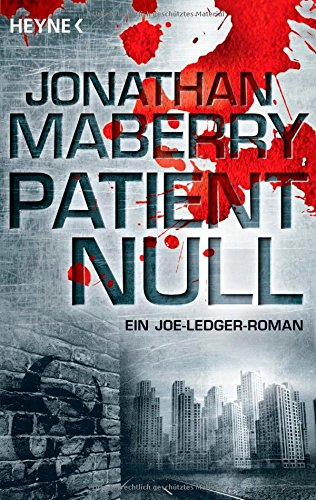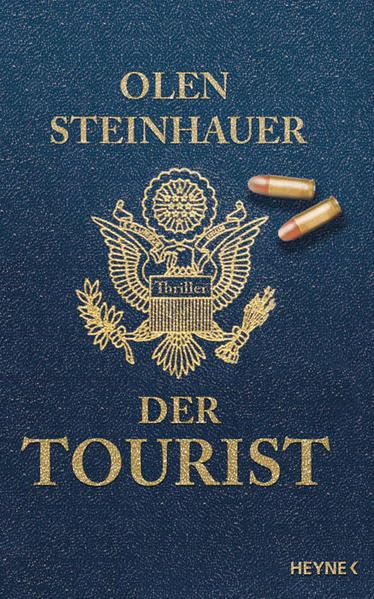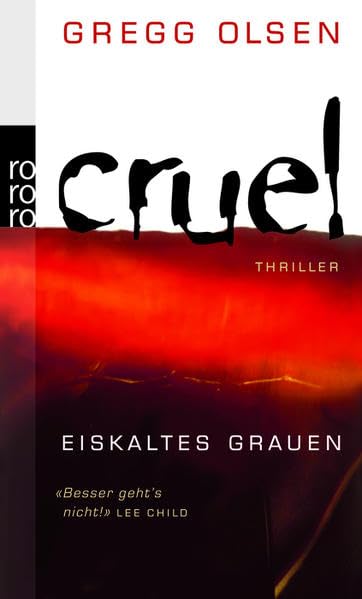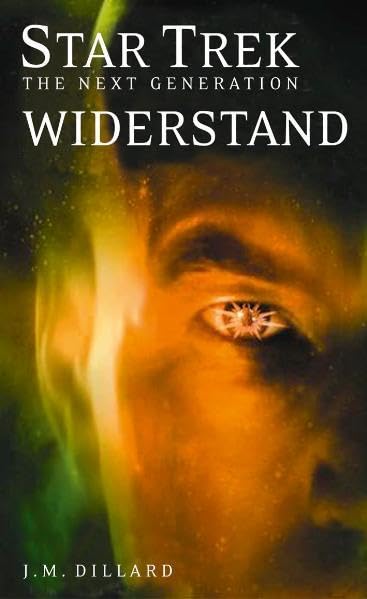Keith R. A. DeCandido – Quintessenz (Star Trek – The Next Generation) weiterlesen
Alle Beiträge von Michael Drewniok
E. C. R. Lorac – Der Tod auf dem Bankett
_Das geschieht:_
Acht Weltenbummler und Schriftsteller fühlen sich geschmeichelt, als sie in ihren Briefkästen eine Nachricht finden, die sie in das Feinschmecker-Lokal „Les Jardin des Olives“ in London einlädt. Der ebenso feine wie geheimnisvolle „Marco Polo Club“, dem nur berühmte Reisende, Wissenschaftler und Künstler angehören, hat sie einer Aufnahme für würdig befunden.
Vor Ort stellt sich allerdings heraus, dass sich jemand einen Scherz erlaubt hat. Nicht der „Marco Polo Club“, sondern offensichtlich der Sonderling Elias Trowne hat zu dem Treffen eingeladen. Empört verlässt Edmond Fitzpayne das „Les Jardin“, während die übrigen Gäste spontan die Gründung eines „Oktagon-Clubs“ beschließen, um auf diese Weise die peinliche Situation zu entschärfen.
Man hat viel Spaß an diesem Abend und muss von Henri Dubonnet, dem Eigentümer des Hauses, vor die Tür gesetzt werden. Als der müde Gastwirt seine letzte Runde dreht, findet er unter einem Tisch im Servierraum neben dem Speisesaal die Leiche von Elias Trowne. Ihm wurde der Schädel eingeschlagen, und das offenbar schon vor dem Bankett.
Chefinspektor MacDonald von Scotland Yard übernimmt den Fall. Schon früh kommt er zu dem Schluss, dass ein Mitglied des jungen „Oktagon-Clubs“ den Mord begangen hat. Im Rahmen seiner freundlichen aber intensiven Verhöre kann MacDonald jedoch keinen Verdächtigen finden. Dabei sind seine Gesprächs- und Verhörpartner außerordentlich kooperativ. Sie stellen sogar eigene Ermittlungen an, was den Mörder offensichtlich nervös macht, da bald einem zweiten Pechvogel der Schädel gespalten wird …
_Rätsel-Krimi vor realem Hintergrund_
Wieso kennt heute (zumindest in Deutschland) niemand mehr die Werke von E. C. R. Lorac? Gehört, würde unter dieser Frage ein Tonfall liegen, der an Fassungslosigkeit grenzt. „Der Tod auf dem Bankett“ liefert jedenfalls im Überfluss, was der Freund des klassischen Rätselkrimis so liebt: den Mord im augenscheinlich fest verschlossenen Raum, eine Gruppe absolut unschuldiger Verdächtiger, in deren Mitte sich dennoch der Täter verbirgt, sowie einen Ermittler, der geduldig und geschickt den kriminellen Knoten nicht zerschlägt, sondern Fädchen für Fädchen aufdröselt.
Dabei hinaus wahrt die Autorin streng aber unterhaltsam ehrwürdige „Whodunit“-Traditionen. Der Plot ist komplex-verworren und realitätsfern, doch die geschilderten Ereignisse könnten sich so abspielen. Lorac spielt fair; sie lässt Chefinspektor MacDonald mit offenen Karten ermitteln. Wenn wir aufmerksam lesen, werden wir den entscheidenden Hinweis auf den Täter finden. Leicht macht Lorac uns dies aber nicht. Genretypisch werden wir mit korrekten, falschen und missverstandenen Hinweisen förmlich bombardiert. Den Stein der Weisheit müssen wir mühsam aus dem Schutt klauben, unter dem er begraben wird.
Wobei dieser Vergleich nicht ohne Grund gewählt wurde: „Der Tod auf dem Bankett“ gehört zu den nicht gerade zahlreichen „Whodunits“, die trotz ihrer Verschrobenheit in der Realität wurzeln. Der Roman entstand 1948, und die Handlung spielt sich in dieser unmittelbaren Nachkriegszeit ab. Geschickt arbeitet Lorac die zeitgenössischen Umstände in die Geschichte ein. So ist der ominöse Bankett-Saal vor allem deshalb eine ideale Mordstätte, weil er kriegsbedingt unter die Erde verlegt, mit verstärkten Mauern versehen und mit bombenschallschluckendem Korkfußboden ausgelegt wurde.
|Seltsame Vögel mit giftigen Federn|
„Der Tod auf dem Bankett“ ist ein Roman, der kaum Handlung und keine exotische Handlungsorte zu bieten hat. Die Ereignisse spielen sich in einem überschaubaren Radius um den Ort des Verbrechens ab, und meist sitzen die Betroffenen beisammen und reden. Das mag langweilig klingen, ist es aber nicht, denn Lorac versteht sich darauf, ihre Geschichte im Verlauf dieser Unterhaltungen zu verdichten. Ein Sprichwort sagt, dass sich Leute um Kopf und Kragen reden können. Lorac beweist es uns. Nur eine unbedachte Bemerkung ist es schließlich, die den Mörder an den Galgen bringen wird. Bis es so weit ist, müssen viele Irrtümer und falsche Schlussfolgerungen überwunden werden. Der Leser nimmt es mit Vergnügen hin, denn er spürt, dass er an einem Haken hängt und von einer talentierten Autorin gedrillt wird.
Vom alten Spottbild des weltfremden Bücherwurms darf man sich dabei verabschieden. Lorac bricht eine Lanze für die Schwerarbeiter ihrer Zunft – jene Autoren, die nicht Kunst schaffen, sondern Handwerk produzieren, das dem Leser, der gleichzeitig zahlender Kunde ist, gefallen soll, um in möglichst großer Zahl gekauft zu werden. Der Alltag solcher Autoren im Jahre 1948 mag in der Rückschau pseudo-romantisch wie Carl Spitzwegs Bild vom „Armen Poeten“ wirken, doch Lorac zeigt nüchtern kreative und mit den Usancen ihres Geschäftes vertraute Männer und Frauen, die vor allem einem Job nachgehen.
|Unter dem Glanz der Gelehrsamkeit|
Das Verständnis dieser Realität ist wichtig, denn sie wird zum Schlüssel für die finale Auflösung. Die geistige Gewandtheit, die Chefinspektor MacDonald an seinen Verdächtigen bewundert, ist ein zweischneidiges Instrument. Voller Tatendrang, mit schnell erworbenem Fachwissen und vielen eigenen Ideen beteiligen sich die Angehörigen des „Oktagon-Clubs“ an der Jagd auf den Mörder. Freilich gehört der Mörder zu ihnen, und er (oder sie?) entwickelt ein ähnliches Geschick in dem Bemühen, falsche Spuren zu legen und von der eigenen Schuld abzulenken.
Dieses intellektuelle Rennen sorgt für eine Spannung, die sich zum Rätselspaß addiert. Welcher der freundlichen, hilfsbereiten, eifrigen Bücherwürmer ist tatsächlich ein kaltblütiger Mörder? Lorac hat kein Problem mit einem Verdächtigen-Feld, das acht Personen umfasst. Für jede ihrer Figuren entwirft die Verfasserin eine eigene Biografie und einen eigenen Charakter. Dieser ist jedoch oft Tarnung, denn den Mitgliedern des „Oktagon-Clubs“ ist der Schein wichtiger als das Sein. Das erschwert der Polizei die Arbeit, ist aber längst kein Hinweis auf Schuld – so einfach macht es uns Lorac nicht! Sie bringt Belege für die Unschuld ihrer Figuren bei, die im nächsten Kapitel negiert werden, bis dem Leser der Kopf schwirrt.
Was war das Motiv? Lorac spielt lange mit dem Element der Eitelkeit, denn auch (oder gerade) „Gebrauchs-Schriftsteller“ sind empfindliche, leicht beleidigte Menschen. Das eigentliche Motiv ist im Gegensatz zum Täter nicht durch Miträtseln zu erkennen. In diesem Punkt wahrt Lorac ihren Wissensvorsprung, der ihr eine Lösung ermöglicht, die ebenso abenteuerlich wie logisch ist und auch jene Leser bei der Stange hält, die mit der Identifizierung des Mörders richtig lagen.
|Der Detektiv im Hintergrund|
Hercule Poirot, Gideon Fell, Gervase Fen, natürlich Sherlock Holmes: Der Ermittler ist im „Whodunit“ normalerweise eine herausragende und hervorstehende Gestalt. Die eine Eigenschaft kennzeichnet seinen Intellekt, die andere seinen Charakter. Kriminologische Genialität geht mit Extravaganz im Auftreten einher. Nur wenige Angewohnheiten oder Manierismen genügen, um eine Figur ins Leserhirn zu prägen. Dort bilden sie einen Vorrat, von dem der Verfasser zehren kann, denn schwache Handlungs-Passagen lassen sich mit amüsanten Verschrobenheiten und deduktiven Spielchen überwinden, die sogar das besondere Interesse der Leserschaft erregen.
Auf dieses Pfund verzichtet Lorac völlig. Robert MacDonald ist eine Figur ohne besondere Eigenschaften. Er bezieht uns nicht in sein Privatleben ein, während im modernen Krimi jeder Seelenkummer und jede Magenverstimmung des Ermittlers seitenlang ausgewalzt wird. MacDonald interessiert uns nach dem Willen seiner Verfasserin nur als Polizist. Man akzeptiert dies mit Freude und Erleichterung, denn es garantiert einen auf den Fall zentrierten Krimi und erspart uns die Seifenoper.
Das bedeutet übrigens keineswegs, dass MacDonald langweilig ist. Sein wahres Wesen entfaltet sich in der Ermittlung. Langsam aber zielgerichtet und ohne Angst vor Rückschlägen arbeitet er sich durch Indizien und Aussagen. Im Wettkampf mit den Mitgliedern des „Oktagon-Clubs“ vermag er mitzuhalten. Hinter scheinbarer Bewunderung und Bescheidenheit verbirgt sich ein scharfer Geist, der seinen Gesprächspartnern stets mehr Informationen entlockt, als diese herausgeben wollten.
Leider weicht Lorac im letzten Teil von ihrer Linie ab. Die Initiative geht auf eine andere Figur über, die eher dilettantisch den Täter identifiziert, ihn stellt und dabei in eine Falle gerät, aus der sie in letzter Sekunde gerettet werden muss: eine Wendung, die allzu offenkundig für ein dramatisches Finale sorgen soll. Dabei hat dieser Roman derartige Tricks nicht nötig. Glücklicherweise kehrt Lorac zur bewährten Form zurück, wenn in einem langen Epilog zum Finale die offenen Fragen geklärt werden. Die Autorin ist dabei souverän genug, auf logische Lücken selbst hinzuweisen, für die sie keine geniale, aber eine funktionierende Erklärung findet. Wenn die Akte Trowne zusammen mit unserem Buch geschlossen wird, ist der Leser zufrieden. Er wurde ordentlich an der Nase herumgeführt aber nicht für dumm verkauft. Lässt sich ein erfolgreicher „Whodunit“ treffender definieren?
_Autorin:_
E. C. R. Lorac (1894-1958), geboren (bzw. verheiratet) als Edith Caroline Rivett- Carnac, muss man wohl zumindest hierzulande zu den vergessenen Autoren zählen. Dabei gehörte sie einst zwar nicht zu den immer wieder aufgelegten Königinnen (wie Agatha Christie oder Ngaio Marsh), aber doch zu den beliebten und gern gelesenen Prinzessinnen des Kriminalromans.
Spezialisiert hatte sich Lorac auf das damals wie heute beliebte Genre des (britischen) Landhaus-Thrillers, der Mord & Totschlag mit der traulichen Idylle einer versunkenen, scheinbar heilen Welt paart und daraus durchaus Funken schlägt, wenn Talent – nicht Ideen, denn beruhigende Eintönigkeit ist unabdingbar für einen gelungenen „Cozy“, wie diese Wattebausch-Krimis auch genannt werden – sich mit einem Sinn für verschrobene Charaktere paart.
|Taschenbuch: 184 Seiten
Originaltitel: Death Before Dinner (London : Collins 1948) bzw. A Screen for Murder (New York : Doubleday Crime Club 1948)
Übersetzung: Helene Mayer
Deutsche Erstausgabe: 1956 (Humanitas Verlag/Blau-Geld Kriminalromane 12), 212 Seiten, keine ISBN
Bisher letzte Ausgabe: 1964 (Signum Verlag/Signum TB 2135)
ASIN: B0000BMVUE|
Beverley Nichols – Eine kleine Mordmusik [Horatio Green 1]
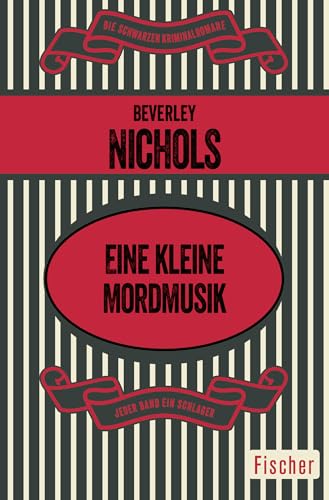
Beverley Nichols – Eine kleine Mordmusik [Horatio Green 1] weiterlesen
Montague Rhodes James – Der Schatz des Abtes Thomas
_Das geschieht:_
Böse Gespenster kommen über allzu neugierige Zeitgenossen. Auch Unschuld schützt vor solcher Heimsuchung nicht, sodass sich die geplagten Seelen allerlei einfallen lassen müssen, um – vielleicht – davonzukommen: Zehn klassische Geschichten definieren in der perfekten Balance von Gruselspannung und Humor das Genre „Ghost Story“:
|Der Schatz des Abtes Thomas| („The Treasure of Abbot Thomas“, 1905), S. 7-30: Wer sein Gold einst finde, den beneide er nicht, hinterließ der Abt eine Warnung; viele Jahre später erkennt ein Schatzsucher, was – und wen – Thomas meinte …
|Ein Herzensvetter| („Lost Hearts“, 1905), S. 31-43: Der freundliche Verwandte hegt böse Pläne, als er seinen verwaisten Vetter aufnimmt, doch zwei bereits früher hässlich geendete Hausgäste machen ihm einen Strich durch die Rechnung …
|Ibi cubavit Lamia| („An Episode of Cathedral History“, 1919), S. 44-65: Als die alte Kirche renoviert wird, stoßen die Bauarbeiter im Inneren auf ein Grab, das sie besser ungestört gelassen hätten …
|Das Puppenhaus| („The Haunted Doll’s House“, 1925), S. 66-81: Was einst Grässliches unter dem Dach des Vorbildes geschah, wiederholt sich nun im verfluchten Puppenhaus als mitternächtliches Miniatur-Drama …
|Das Vermächtnis des Kanonikus Alberic| („Canon Alberic’s Scrapbook“, 1905), S. 82-96: Wen der gar nicht fromme Kirchenmann einst aus der Hölle zitierte, haust noch heute in seiner Kirche, weshalb man wissen sollte, wie man ihm aus dem Weg geht …
|Eine Pfadfinder-Geschichte| („Wailing Well“, 1931), S. 97-111: Als er trotz eindringlicher Warnung ein verfluchtes Wäldchen betritt, erfährt der ungehorsame Knabe, dass Gespenster weniger nachsichtig als Erwachsene sind …
|Der Eschenbaum| („The Ashtree“, 1905), S. 112-129: „Es werden Gäste sein auf Castringham Hall“, kündigt die Hexe unter dem Galgen an, und die haben es auf den Richter und seine Nachfahren abgesehen …
|Drei Monate Frist| („Casting the Runes“, 1911), S. 130-156: Der reizbare Amateur-Historiker pflegt Kritiker mit einem tödlichen Fluch zu belegen, aber dieses Mal gedenkt sein Opfer, es ihm mit gleicher dämonischer Münze heimzuzahlen …
|Das Chorgestühl zu Barchester| („The Stalls of Barchester Cathedral“, 1911), S. 157-176: Als der alte Amtsvorgänger nicht sterben will, hilft der Nachfolger ungeduldig nach; zu seinem Pech ruft die böse Tat unheimliche Rächer auf den Plan …
|Liber nigrae peregrinationis| („Count Magnus“, 1905), S. 177-194: Auch im Tod sollte man Magnus fürchten, denn noch immer hasst er Störenfriede und hetzt ihnen hinterher, was ganz sicher nicht von dieser Erde ist …
_Wer zu tief schürft, trägt die Folgen!_
Eigentlich sind es harmlose Zeitgenossen, die zudem zufällig dorthin geraten, wo sie ganz sicher nie landen wollten: im Reich der Gespenster, zumal diese sich von ihrer besonders unerfreulichen Seite zeigen. Sie sind böse, heimtückisch und nachtragend. Ihnen zum Opfer fallen allzu forschungseifrig Bücherwürmer, Kirchenmänner und sogar Jugendliche, die nur altersbedingt gegen die Regeln von Zucht & Ordnung verstoßen: Die Gespenster des M. R. James kennen keine Gnade!
Eher zufällig trifft es den hinterhältigen Mr. Abney („Ein Herzensvetter“), den kritikerfeindlichen Mr. Carswell („Drei Monate Frist“), den selbstgefälligen Junker Fell („Der Eschenbaum“) oder den scheinheiligen Archidiakon Haynes („Das Chorgestühl zu Barchester“), die tatsächlich Verbrechen begehen. Aber selbst mit diesen Schurken hat der Leser Mitleid, denn die Strafe für ihr unchristliches Tun ist ausnahmslos schrecklich.
Mit einiger Sicherheit ist zu erwarten, dass nicht einmal der grausige Tod ein Ende dieser Strafe bringt. Im Fall des vorwitzigen Pfadfinders Stanley Judkins („Eine Pfadfinder-Geschichte“) wissen wir es sogar genau: Er muss sich denen zugesellen, die ihm das Leben nahmen, und ist in Zukunft ebenso gefährlich für zukünftig allzu Neugierige!
|Horror mit Humor|
Gerecht geht es bei M. R. James also nicht zwangsläufig zu, und seine Gruselgeschichten enden keineswegs automatisch mit einer lehrreichen Moral. Dazu nahm der Verfasser die Geisterwelt nicht ernst genug. Ob James dennoch an Geister glaubte, blieb sein Geheimnis. Seine Storys bleiben ambivalent, denn sie werden mit viel schwarzem Humor dargeboten. „Eine Pfadfinder-Geschichte“ ist ganz offen als Horror-Komödie gestaltet, die zusätzlich ihren Scherz mit dem eigentlich zu erwartenden Schlussappell – Haltet euch an die Regeln! – treibt.
Auch sonst ist James immer für einen Seitenhieb gut. Wenn sich ehrwürdig aufgeblasene Kirchenfürsten gegen den Umbau einer Kirche sträuben, weil man anschließend sehen könnte, dass sie der Messe im Tiefschlaf beiwohnen, klingt das in „Ibi cubavit Lamia“ trügerisch harmlos so: „Andere wiederum bemängelten, sie würden dem Anblick der Kirchenbesucher preisgegeben sein, was, wie sie sagten, besonders während der Predigten unangenehm sein werde, denen die Domherren gern in einer Haltung lauschten, die zu Missverständnissen Anlass geben könnte.“ (S. 51)
Auf der anderen geht die Begegnung mit dem Übernatürlichen regelmäßig grimmig aus. Die Kunstfertigkeit, mit der James sein Garn spinnt, verbirgt durchaus plakative Grausamkeiten. Da werden Herzen aus dem Leib („Ein Herzensvetter“) oder gar Gesichter vom Schädel gerissen („Liber nigrae peregrinationis“), und in „Das Puppenhaus“ frisst der zum Zombie mutierte Großvater die an seinem Schicksal unschuldigen Enkelkinder. Wie im Märchen gibt James seinem Publikum, was es verlangt.
|Wie der Horror überlebte|
Dass sich das Vergnügen an Horror und Humor den deutschen Lesern gleichermaßen mitteilt, verdanken sie der kongenialen Übersetzung von Friedrich Polakovics. Während er seinen Hang zum künstlich antiquierten Ausdruck in anderen Story-Sammlungen manchmal bis zur Unerträglichkeit übertreibt, findet er hier stets den korrekten Tonfall. M. R. James schreibt zwar „nur“ Gruselgeschichten, aber er ist ein akademisch hochgebildeter Autor, der daraus keinen Hehl macht.
So wird „Der Schatz des Abtes Thomas“ durch ein halbseitiges lateinisches Zitat eingeleitet. (Keine Sorge – es wird übersetzt.) Das sorgte vor 100 Jahren nicht für Entsetzen, sondern wurde als Entscheidung des Verfassers zur Kenntnis genommen. Der ebenfalls des Lateinischen mächtige Leser – solche soll es sogar noch heute geben – erfährt den doppelten Lektürelohn, wenn er verfolgt, wie präzise und doch der Story angemessen James Sprachduktus und Inhalt des Mittelalters nachahmt.
|James-Grusel in anderen Medien|
In England werden die Geistergeschichten von M. R. James seit Jahrzehnten nicht nur als Klassiker verehrt und gelesen, sondern auch verfilmt. 1957 setzte Jacques Tourneur (1904-1977), ein Meister des „Film Noir“, die Story „Drei Monate Frist“ unter ihrem Originaltitel „Casting the Runes“ (dt. „Der Fluch des Dämonen“) um. Zwar wurde er vom Studio gezwungen, jene heraufbeschworene Kreatur, die er wie James ursprünglich nur andeuten wollte, per Filmtrick zu zeigen, aber es gelang Tourneur dennoch ausgezeichnet, die bedrückende Atmosphäre einer dämonischen Bedrohung in Bilder voller trügerischer Schatten umzusetzen.
M. R. James fand natürlich auch Eingang in die TV-Serie „Mystery and Imagination“, die zwischen 1964 und 1968 als angelsächsische Variante der „Twilight Stories“ in England entstand; verfilmt wurden aus unserer Sammlung „Drei Monate Frist“ und „Ein Herzensvetter“. Eine stimmungsvolle und mit 45 Minuten Länge nicht über Gebühr gestreckte Version von „Das Chorgestühl zu Barchester“ stammt aus dem Jahre 1971. Von 1974 bzw. 1975 datieren ähnlich auf das Wesentliche konzentrierte Verfilmungen von „Der Schatz des Abtes Thomas“ bzw. „Der Eschenbaum“.
Auch heute bilden James-Storys einen Grundstock vor allem für TV-Filme. 2000 schlüpfte niemand Geringerer als Christopher Lee in die Rolle von M. R. James und erzählte vier „Ghost Stories for Christmas“. Die derzeit letzte Version von „Ein Herzensvetter“ entstand erst 2007.
_Autor:_
Montague Rhodes James wurde am 1. August 1862 in Goodnestone, einer Kleinstadt in der englischen Grafschaft Kent, geboren. Als „Monty“ drei Jahre alt war, zog seine Familie nach Great Livermere in Suffolk um, dessen Landschaft ihn stark prägte und deren Naturdenkmäler und Altertümer später immer wieder in seinen Geistergeschichten auftauchten.
Rhodes‘ zweiter Lebensschwerpunkt wurde die Universitätsstadt Cambridge. Nach einem Intermezzo in Eton studierte er hier am King’s College antike und mittelalterliche Geschichte und spezialisierte sich auf alte Schriften und Sprachen. Nachdem er seinen Abschluss gemacht hatte, bot ihm das King’s College eine Anstellung an. Rhodes bewährte sich als Dozent und Wissenschaftler. 1905 wurde er zum Direktor („provost“) ernannt. Diese Stelle hatte er 13 Jahre inne, bevor er in die entsprechende Position ans Eton College wechselte, wo er 1936 im Amt starb.
M. R. James‘ Einfluss auf die (britische) Phantastik kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Schon zu Lebzeiten schätzten ihn nicht nur seine Leser. Berühmte Kollegen äußerten sich lobend über sein Werk. Zu ihnen zählten der überaus kritische H. P. Lovecraft (1890-1937) oder Clark Ashton Smith (1893-1961).
Darüber hinaus wurde James zum Vorbild für andere Autoren, die „Ghost Stories“ in seinem Stil schrieben. Die erste Generation bildeten Mitglieder der „James-Gang“, die der Schriftsteller vor allem in seinen Eton-Jahren um sich scharte. Viele dieser Pastiches sind zu Recht vergessen, während andere dem Vorbild nicht nur nahe kommen, sondern es reizvoll neu interpretieren.
|Taschenbuch: 195 Seiten
Übersetzung: Friedrich Polakovics
Dt. Erstveröffentlichung (geb.): 1970 (Insel Verlag)
[keine ISBN]
Als Taschenbuch: 1979 (Suhrkamp Verlag/TB Nr. 540 = Phantastische Bibliothek Nr. 32)
ISBN-13: 978-3-518-37040-7|
[www.suhrkamp.de]http://www.suhrkamp.de
_Montague Rhodes James bei |Buchwurm.info|:_
[„Dreizehn Geistergeschichten“ 5690
Cottam, F. G. – Im Haus des Bösen
_Das geschieht:_
Vor zwölf Jahren war Paul Seaton aus London ein junger Journalist auf dem Weg nach oben. Auch privat hatte er sein Glück in Gestalt der Studentin Lucinda gefunden. Der Untergang kam, als Seaton sich entschloss, seiner Freundin bei einer schwierigen biografischen Recherche zu unterstützen. Lucinda schrieb an ihrer Abschlussarbeit über die hochtalentierte aber in Vergessenheit geratene Fotografin Pandora Gibson-Hoare, die ihrem kurzen Leben 1937 in der Themse ein Ende setzte. Wider Erwarten fand Seaton bisher unbekannte Aufzeichnungen, in denen Pandora von nie entdeckten und sorgfältig versteckten Fotografien schrieb, deren Auffinden eine Sensation bedeutet hätte.
Unklugerweise schenkte Seaton jenen Kapiteln von Pandoras Tagebuch, in denen sie schilderte, wie sie in einen Zirkel hochrangiger Satanisten geriet, nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Seaton glaubte nicht an Schwarze Magie und wagte sich deshalb in das berüchtigte Fischer House, das einst dem Anführer dieser Gruppe gehörte und seit vielen Jahren leerstand. Dort entkam er nur knapp einer mörderischen Kreatur und erregte die Aufmerksamkeit von Klaus Fischer und seinen bösen Genossen, die zwar tot aber keineswegs im Jenseits verschwunden waren. Lange saßen die Geister Seaton im Genick. Sie zerstörten sein berufliches und privates Leben, bis sie endlich das Interesse an ihm verloren. Seitdem lässt Seaton sich treiben.
Nun sucht ihn der Therapeut Malcolm Covey mit einer dringenden Bitte auf: Fünf Forscher haben das Fischer House aufgesucht und dessen Geister geweckt. Ein junges Mädchen ist bereits tot, die anderen „Gäste“ kämpfen mit dem Wahnsinn. Seaton, der dem Schrecken einst entrann, soll sich ihm neuerlich stellen, um die neuen Opfer zu retten. Dies abzulehnen ist unmöglich, denn Fischer hat von Seatons Mission erfahren und nimmt freudig die Herausforderung an …
_Klassischer Spuk – endlich wieder einmal!_
In einem Meer – vielleicht sollte man besser von einem bösen, saugenden Sumpf sprechen – nur unfreiwillig schrecklicher Vampir-Schmonzetten darf ein „richtiger“ Grusel-Roman heutzutage mit Vorschusslorbeeren rechnen. Zwar wird auch „Im Haus des Bösen“ geliebt, aber immerhin nicht geschmachtet. Noch wichtiger: Das Übernatürliche gerinnt nicht zur Wunschprojektion unerfüllter Träume, sondern ist ein rundum unerfreulicher Ort mit ebensolchen Bewohnern.
Diese dürfen sogar düstere Prominenz für sich beanspruchen: Zwar gab es in der historischen Realität keinen Klaus Fischer, doch zu seinen Gästen (und Jüngern) gehörten laut F. G. Cottam ebenso illustre wie berüchtigte Gestalten: der Okkultist und „Magicker“ Aleister Crowley (1875-1947), der Schriftsteller Dennis Wheatley (1897-1977), der britische Faschistenführer Oswald Mosley (1896-1980) und der Nazi-Bonze Hermann Göring (1893-1946). Ihnen dichtet Cottam einen geheimen und unentdeckt gebliebenen Pakt mit dem Teufel an, der ihnen im Tausch für ihre Seelen Macht und Reichtum garantierte.
Akkurat wie die Vergangenheit und ihre Protagonisten lässt Cottam die klassische Geistergeschichte der 1920er Jahre aufleben. Deshalb verzichtet er auf plakative Gräuel. Seltsames und Erschreckendes ereignet sich gern (aber nicht nur; keine Sorge!) an den Rändern des Blickfelds oder zwischen den Zeilen. Der Erzählton ist ernst und dem Geschehen angemessen, das ohne die heute so beliebte Ironie eine bitterernste und oft traurige Geschichte darstellt, die mehr als ein Dreivierteljahrhundert abdeckt.
|Ebenfalls klassisch: das Figurenpersonal|
Autor Cottam plant nicht, dem Genre einen Schrittmacher zu schaffen, um es in „die Gegenwart“ zu hieven, was Literaturkritiker immer wieder fordern, ohne dass ihnen selbst klar zu sein scheint, wie das realiter funktionieren könnte. „Im Haus des Bösen“ ist Retro-Horror der gediegenen Art. Die bekannten Elemente funktionieren heute so gut wie gestern, also bedient sich Cottam ihrer. Abgestaubt werden sie nicht, zumal die Handlung sich meist ohnehin in der Vergangenheit abspielt. (Wenn die Handlung in die 1980er Jahre springt, liest sich Cottams Wiederbelebung dieser Ära ebenfalls authentisch. Der Verfasser greift hier auf die eigene Biografie zurück; wie Paul Seaton startete Cottam nach 1980 in eine Journalistenlaufbahn.)
Also haben wir das große, dunkle, alte Haus, in dem sich Schreckliches ereignete, das sich in den Wänden buchstäblich eingenistet hat und auf jene wartet, die sich neugierig oder einfach nur dumm hineinwagen. Dazu passt ein überlebensgroßer Schurke, der zwar tot aber deshalb umso schauderhafter ist. Ihm zur Seite stehen diverse Untergeister, die sich mit eigenen Bosheiten der „menschlichen“ Hauptfigur in den Weg stellen, damit das finale Duell zwischen diesem und besagtem Bösewicht nicht gar zu früh stattfinden muss.
Besagter Held ist zwar in der Minderzahl, steht jedoch nicht allein. Das macht ihn umso verwundbarer und sorgt für dramatische Momente, wenn die Teufelsbrut einen der „guten“ Spieler vom Feld nimmt. Cottam wandelt dieses Klischee – nennen wir es ruhig so, denn nicht immer trägt dieser Ausdruck negative Züge – insofern ab, als er Lucinda nur als Katalysator für das eigentliche Grauen einsetzt und Seaton schon recht früh der mondänen Pandora verfallen lässt, die in der Tat die interessantere Person (und Persönlichkeit) ist. Der Autor beherzigt eine Grundtugend der klassischen Geistergeschichte: Die Leser müssen die Figuren kennen und sie mögen (oder fürchten), damit sie an ihren Schicksalen Anteil nehmen.
|Irgendwas ging dennoch schief|
Trotz allen vielversprechenden Inputs ist „Im Haus des Bösen“ kein Roman, der sich seinen Lesern einprägt. Stattdessen kommt schon früh ein Gefühl der Enttäuschung auf. Cottam holt weit aus, um seinem Fischer House eine eindrucksvolle Geschichte zu verschaffen. Er erfindet ihr Figuren mit klingenden Namen (s. o.) und bettet sie (trotz einer eher laxen Charakterisierung, die auf dem Niveau reinen „name droppings“ verharrt) geschickt in die historische Realität ein. Der Glaube an das Okkulte war in Jahren nach dem Ersten Weltkrieg in England auch und vor allem in den höheren Gesellschaftsschichten verbreitet (auch wenn der Teufel dort natürlich nur vereinzelt aktive Satanisten und Hexenmeister offiziell rekrutieren konnte, weil dies schlecht für den Ruf war).
Die Atmosphäre „stimmt“: Cottam weiß, was „unheimlich“ bedeutet, und er vermag es in entsprechende Worte zu fassen, kreiert eindrucksvolle Szenen, streut gut erfundene Anekdoten ein, deutet unaussprechliche Geheimnisse an, verliert sich in interessanten Details – und ehe man es sich versieht, sind zwei Drittel des Buches vorüber, ohne dass wirklich etwas geschehen ist!
Erst dann kommt Schwung in die Handlung, die jedoch den Versprechungen der gewichtigen Einleitung niemals gerecht werden kann. Vorher aufwendig eingeführte Figuren gehen sang- und klanglos über Bord. Die subtile Gemeinheit der Gespenster verwandelt sich in plumpes Kraft-Spuken. Jede Tür des Fischer-Hauses wird zum Portal in eine neue Visionen-Welt, in der aufwändig chiffriert wird, was sich nachträglich als ganz einfache Geschichte herausstellt.
Am Ende steht ein Sieg, der ebenso trivial erfochten wie unwahrscheinlich ist, wenn man sich noch einmal vor Augen führt, mit welchen Geschützen Fischer & Co. aufwarten konnten. Fast ein Jahrhundert haben sie Millionen an ihren Marionettenschnüren tanzen lassen, aber ausgerechnet Paul Seaton (im Bund mit einem geläuterten, schwer bewaffneten IRA-Terroristen) kann ihnen den Garaus machen? Das gibt die Figur einfach nicht her!
So ist „Im Haus des Bösen“ wieder einmal ein Buch, das in der Summe weniger gefällt als in seinen Einzelteilen. Cottam kennt das Genre, und er hat ein Gespür für bedrohliche und ambivalente Stimmungen. Was (noch) fehlt, ist die Komposition einer packenden Handlung. Weil sie fehlt, wollen die Elemente sich nicht zu einer stringenten Geschichte fügen.
_Autor:_
F. G. Cottam – 1957 als Francis Cottam in der englischen Grafschaft Lancashire geboren – studierte Geschichte an der University of Kent. Nach seinem Abschluss ging er nach London und wurde Journalist. Im Verlauf einer zwei Jahrzehnte währenden Karriere gab er u. a. das Herrenmagazin „FHM“, schuf das „Total Sport Magazine“ und betreute die britische Ausgabe des Magazins „Men’s Health“.
Ab 2001 wurde Cottam als Schriftsteller aktiv. In rascher Folge erschienen vier Historien-Thriller, in denen Ereignisse des II. Weltkriegs als Kulisse für abenteuerliche Unterhaltung dienten. Seit 2007 schreibt Cottam – nun als F. G. Cottam – Romane, die um übernatürliche Phänomene kreisen.
Mit seiner Familie lebt und arbeitet F. G. Cottam in Kingston upon Thames.
|Taschenbuch: 349 Seiten
Originaltitel: The House of Lost Souls (London : Hodder & Stoughton 2007)
Übersetzung: Rabanus Stern
Deutsche Erstausgabe: November 2009 (Deutscher Taschenbuch Verlag/Dtv 21178)
ISBN-13: 978-3-426-21178-9|
[www.dtv.de]http://www.dtv.de
Atkins, Charles – Blutduett
_Das geschieht:_
James Martin stand einst vor einer vielversprechenden Musiker-Karriere, als er in einen grausamen Doppelmord verwickelt wurde. Weil man ihm seine direkte Schuld nie nachweisen konnte und er außerdem in der Untersuchungshaft an Schizophrenie erkrankte, kam Martin nicht ins Gefängnis. Stattdessen steht er seit vielen Jahren in der feudalen Familienvilla, die er inzwischen allein bewohnt, unter Hausarrest. Er muss eine elektronische Fußfessel tragen, wird ständig von einem Psychologen untersucht und steht unter der Vormundschaft seiner Zwillingsschwester Ellen.
Ungeachtet der ihm auferlegten Beschränkungen hat sich Martin als Meister der Manipulation viele Freiheiten erobert. Ellen ist dem Bruder hörig, der Betreuer bestechlich. Gerade ist Dr. Kravitz, der ungeliebte Psychiater, (angeblich) einem Blutzuckerschock zum Opfer gefallen. Martin setzt alle Hebel in Bewegung, damit ihm Dr. Barrett Conyors als Ärztin zugewiesen wird, die er vor Jahren in Croton, einer Anstalt für kriminelle Geisteskranke, kennen und bis zur Besessenheit schätzen lernte, was er allerdings stets verbergen konnte.
Die hochbegabte und engagierte Conyors freut sich über das gute Honorar und die Ablenkung, denn just hat sie ihren Gatten beim Ehebruch erwischt. Auch beruflich ist die Ärztin angeschlagen, nachdem sich ein von ihr geheilter Patient nun doch vor Gericht verantworten musste und sich deshalb umbrachte. Nie wieder wird sie der Justiz auf diese Weise in die Hände arbeiten, schwor Conyors sich – für Martin ein idealer Ansatzpunkt für sein perfides Psycho-Spiel.
Zwar ahnt Conyors, dass ihr großzügiger Klient sie belügt, worin sie ein alter Freund, der misstrauische Detective Hobbs, bestärkt, doch sie überschätzt ihre beruflichen Fähigkeiten, wodurch sie Martin und die Intensität seines Wahns falsch einschätzt – ein Versäumnis, das Conyors Leben zur Auflösung bringt und im Rahmen eines dramatischen Finales sogar zu beenden droht …
_Thriller von der Stange_
Das Böse ist reich, (trügerisch) schön, hochtalentiert und skrupellos, das Gute (zunächst) schwach, weil gesetzestreu und moralisch, aber immerhin ebenfalls schön und klug: Willkommen in der Terminator-Zone, die in der Astronomie die Licht-Schatten-Grenze eines Planeten bezeichnet. Der Begriff taugt auch für die (Unterhaltungs-) Literatur. Hier ist der Terminator freilich breiter, denn er ist die Heimat jener (viel zu) vielen Romane, die weder richtig schlecht noch wirklich gut sind.
Im Dämmerschatten verschwimmen etwaige Charakterzüge. Handwerklich solide Arbeit ist in diesem Umfeld gefragt, und genau sie bietet „Blutduett“ als Schema-F-Thriller, der gerade an der Kante jenes Abgrundes balanciert, in dem einschlägige Klischees ihn endgültig verschlingen würden. Es gibt keine einzige originelle Idee in diesem Buch, was durch die künstlich aufgeregte aber eigentlich farblose Umsetzung noch betont wird. Charles Atkins folgt treu (oder stumpf) den Fußspuren anderer Autoren, die das Feld vom irren aber cleveren Super-Schurken bereits kreuz und quer beackert haben.
Zwar ist er bemüht, dies vergessen zu lassen, indem er aktuelles und durch persönliche Berufserfahrung gewonnenes Fachwissen in seine Geschichte einfließen lässt. Wie viele andere ehrgeizige Autoren ignoriert er jedoch die Frage, was seine Leser höher schätzen: eine spannende oder eine solide im fachlichen Kontext verankerte Geschichte? Er kennt die Antwort nicht, dass sich die Fiktion der Realität nur bedient, ohne ihr verpflichtet zu sein. Anders ausgedrückt: Eine Geschichte muss vor allem spannend sein und höchstens überzeugend klingen. Faktenwissen ist eine Zugabe, die der Leser von einem guten Autor erwartet und erwarten kann.
|Auch Klischees wollen beherrscht sein|
Charles Atkins hätte besser mehr Schwung in seine Geschichte gebracht, statt uns einmal mehr mit dem nur scheinbar und behauptet aufregenden Garn von der Schönen und dem Biest zu konfrontieren, ohne das Thema wenigstens zu variieren. Schon die Ausgangssituation erzeugt Stirnrunzeln. Atkins setzt auf die „Reiche dürfen alles“-Karte und konstruiert eine Mausefalle, die über unzählige heimliche Ausgänge verfügt und damit und ein „Looked Room“-Geheimnis einerseits schaffen will und andererseits mit Füßen tritt. Wie konnte ein psychisch nachhaltig gestörter, viele Jahre unter Medikamenteneinfluss in einem Sanatorium vegetierender Martin sein Elternhaus unbemerkt in eine High-Tech-Burg verwandeln, um deren Effizienz ihn jeder staatliche Geheimdienst beneiden würde? Gibt’s dafür Internet-Volkshochschulkurse? Atkins bemüht sich um „Erklärungen“, die jedoch fadenscheinig bleiben.
Zumindest der tatsächlich gefangene Hannibal Lecter war in „Das Schweigen der Lämmer“ faszinierend, weil er sein Gegenüber nur durch Worte manipulieren konnte. Will James Martin einen Widersacher aus dem Weg räumen, setzt er seine Fußfessel außer Betrieb, setzt sich in ein getarntes Taxi und fährt den Lästling über den Haufen. Notfalls manipuliert er Komplizen, die Atkins bei Bedarf aus dem Hut zieht. So vermag er seine Handlung wohl aus einer ihrer vielen Sackgasse manövrieren, aber ernst nehmen kann man dieses „Lösung“ beim besten Willen nicht. Muss angemerkt werden, dass Martins Todesfallen ähnlich plump geraten? Eine Ausnahme bildet das große, durch aufgesetzte Gruseldramatik und Zufälle geprägte Finale: Es ist peinlich und sabotiert die ohnehin schwache Auflösung.
|Kluges Reh im Scheinwerferlicht|
Atkins hegt die allzu zuversichtliche Überzeugung, ein wortgewandter Autor zu sein. Gern bemüht er beispielsweise theatralische Symbolismen als Stilmittel. Schon der Titel verweist auf einen Kampf der Geistesriesen: |prodigy| bedeutet „Wunderkind“, und der Verfasser findet den Einfall originell, dass nicht nur James Martin, sondern auch Barrett Conyors ein solches Wunderkind war. Weitere Parallelen werden konstruiert: unglückliche Kindheit, schwierige Eltern, Beziehungsprobleme; sie sollen ebenso wie das Cello-Spiel – nur Genies spielen klassische Musik, und das Böse ist noch hässlicher, wenn es die schönen Künste missbraucht – bedeutungsschwangere Tiefe suggerieren. Faktisch wird das Instrumentarium der Seifenoper aufgefahren, deren Getöse die Schlichtheit des Plots übertönen soll.
Zwischen Martin und Conyors findet ein Katz-und-Maus-Spiel statt. Es spiegelt sich im Verhältnis zwischen Martin und seiner (echten) Katze Fred und soll unheilvoll die Zukunft der ahnungslosen Psychologin Conyors andeuten. Die wird privat und im Job durch zahlreiche Widrigkeiten so arg gebeutelt, dass immerhin nachvollziehbar wird, dass ein lupenreiner Irrer wie James Martin sie über den Tisch ziehen kann. Conyors ist eine Fachidiotin, sie steckt voller Skrupel, was Sympathie für die Figur wecken soll. Stattdessen nervt Conyors in ihrem Gutmenschentum, das sie außerdem in jede noch so ungeschickt gestellte Falle stolpern lässt.
Ausgelaugte Geschmacklosigkeiten erzeugen unfreiwillig Heiterkeit: In Martin juniors Matschhirn röhrt der tote, böse Vater, der unbedingt einen Erben produziert sehen will; mit Fruchtbarkeitspillen gefüttert und heimlich künstlich geschwängert, droht Barrett, sich mit einem Plastikmesser die Gebärmutter zu entfernen, wenn man sie nicht ziehen lässt – eine Situation, die spannende Krisenstimmung nachhaltiger killt als jeder Serienkiller.
|Gelegenheit zur Publikumsbelehrung|
Zwischen den raren Spannungsmomenten bremst Atkins die Handlung gern ab, um seine Figuren lange Vorträge über die Rolle der Psychologie im modernen Justizwesen zu halten. In diesem Punkt kennt sich der Verfasser hauptberuflich aus, und es ist ihm wichtig, sein Wissen einem möglichst breiten Publikum näherzubringen. Ihm unterläuft in diesem Zusammenhang deshalb nicht nur der weiter oben angesprochene Fehler, darüber seine Geschichte zu vernachlässigen. Atkins beginnt darüber hinaus zu dozieren. Fakten sind jedoch nur Teile des Rezeptes für eine gute Geschichte. Sie müssen ihr in geeigneten Dosen untergehoben werden. Ein Kreuzzug ist in erster Linie demjenigen wichtig, der ihn ausruft.
Als Leser möchte man „Blutduett“ schütteln, bis Klischees und allzu Bekanntes wie faule Früchte und trockene Blätter aus dem Geäst eines Obstbaums gefallen sind, um zu sehen, was übrig bleibt. Von diesem Roman blieben wohl nur kahle Zweige, was letztlich das passende Bild für eine routinierte, allzu kalkulierte und vor allem: hölzerne Geschichte wäre.
_Autor:_
Der 1961 geborene Psychiater ist Mitglied der Medizinischen Fakultät der Universität Yale in New Haven (US-Staat Connecticut). Sein Spezialgebiet ist die Behandlung manisch-depressiver Verhaltensstörungen. Über seine Erfahrungen und Forschungen schreibt Atkins regelmäßig Artikel in Fachzeitschriften; er ist außerdem Autor viel gelesener Ratgeber über den Umgang mit psychisch erkrankten Personen.
Als Krimi-Autor debütierte Atkins 1998 mit „The Portrait“. Weitere Romane sowie zahlreiche Kurzgeschichten für Magazine und Anthologien folgten. 2007 begann der Autor eine Serie um die Psychiaterin Barrett Conyors. Hier kann Atkins sein Fachwissen in eine Krimi-Handlung einfließen lassen.
Charles Atkins lebt in Woodbury, Connecticut. Über seine medizinischen und schriftstellerischen Aktivitäten informiert er auf seiner Homepage [www.charlesatkins.com]http://www.charlesatkins.com.
|Taschenbuch: 413 Seiten
Originaltitel: The Prodigy (Woodbury/Minnesota : Midnight Ink 2007)
Übersetzung: Marcel Bülles
Deutsche Erstausgabe: Januar 2010 (Bastei-Lübbe-Verlag/Allgemeine Reihe Nr. 16370)
ISBN-13: 978-3-404-16370-0|
[www.luebbe.de]http://www.luebbe.de
_Charles Atkins bei |Buchwurm.info|:_
[„Gift“ 3966
[„Risiko“ 5024
Brian Keene – Totes Meer
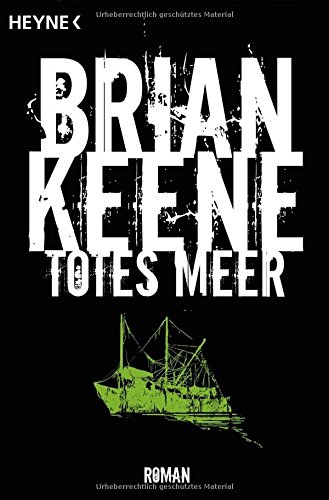
Brian Keene – Totes Meer weiterlesen
Bakker, Scott – Neuropath
_Das geschieht:_
Als Studenten der Psychologie waren sie nicht nur Kommilitonen und Zimmergenossen, sondern auch beste Freunde. Seit vielen Jahren halten Thomas Bible und Neil Cassidy den Kontakt aufrecht. Der eine doziert an der Columbia University in New York City, der andere arbeitet in einem Krankenhaus.
Allerdings hat Cassidy seinen Freund belogen. Er war sogar dazu verpflichtet, denn er hat sich von der Nationalen Sicherheitsbehörde (NSA) anwerben lassen. Seit dem Anschlag auf die Twin Towers 2001 und im Zuge des „Krieges gegen den Terrorismus“ wurden in den USA die gesetzlich garantierten Menschenrechte immer stärker aufgeweicht. Cassidy beschäftigte sich mit der Manipulation des Gehirns. Im Rahmen streng geheimer Operationen und Experimente sollten mutmaßliche Verschwörer nicht nur zum Reden gebracht werden. In einem nächsten Schritt wollte man sie geistig quasi ferngesteuert gegen die eigenen Leute einsetzen.
Irgendwann kam Cassidy zu dem Schluss, dass die Realität vom menschlichen Hirn nur verzerrt dargestellt wird. Er ging in den Untergrund und begann, Männer und Frauen zu kidnappen, um mit bizarren und grausamen Versuchen die ‚Fehlfunktionen‘ des Gehirns zu entlarven. Das FBI jagt Cassidy, den „Neuropathen“, für den Gesetze oder moralische Normen Fiktionen in einer Welt der Illusionen sind. Die Agenten holen Thomas Bible als Berater in ihr Team. Nur er kann wenigstens ansatzweise erfassen, wie Cassidy „tickt“. Trotzdem unterschätzt er den Wahn des Freundes. Für Cassidy wird er zum idealen Versuchsobjekt. Dieses „Experiment“ geht er anders an: Cassidy kidnappt Bibles vierjährigen Sohn und treibt den Vater, der zu Recht Entsetzliches befürchten muss, schier in den Wahnsinn …
_Auf der Suche nach neuen Schrecken_
Genialität und Größenwahn kennzeichnen in der Regel den charismatischen Serienkiller. Intelligent oder wenigstens schlau sollte er sein, um die Polizei und andere Verfolger einige hundert Buchseiten oder 90 bis 120 Filmminuten ins Leere laufen zu lassen bzw. in Atem halten zu können. Der Wahn ist wichtig, weil er ihn (oder sie) zu Übeltaten anstachelt, die den lesenden oder zuschauenden Zeitgenossen unterhaltsam erschauern lassen, der über den Spaß am profanen Kopfschuss längst hinausgewachsen ist.
Sich in dieser Hinsicht Neues einfallen zu lassen, ist nach einer wahren Schwemme irrwitziger Mörder zur echten Herausforderung geworden. Längst sind die Grenzen zum Horror weit überschritten, und der Realitätsbezug schmolz zur Behauptung zusammen. Möglichst bizarr muss gemetzelt werden, was freilich die Gefahr der Lächerlichkeit in sich birgt, da die blutreichen Gräuel oft einem monumentalen „Plan“ folgen, der ebenso kompliziert wie unsinnig ist. Wahnsinn bietet da keine Entschuldigung.
Scott Bakker überrascht zunächst mit gleich zwei mordlüsternen Killern. (Er scheint jedenfalls anzunehmen, er könne seinen Lesern weismachen, beide Mordserien hätten nichts miteinander zu tun. Dies offenzulegen werte ich nicht als Spoiler, da sich der Autor gar zu ungeschickt anstellt.) Da haben wir den „Chiropraktiker“, der seinen Opfern die Wirbelsäulen entfernt, die er anschließend beispielsweise in die Briefkästen ahnungsloser Mitbürger wirft.
Und es gibt Neil Cassidy, den selbsternannten, übergeschnappten Übermenschen, der mit seinem Treiben gleich mehrere Teilbereiche der Natur- und Geisteswissenschaften trivialisiert, an deren Spitze Psychologie und Philosophie stehen. Wie er Cassidy in beiden Feldern verwurzeln konnte, macht Bakker offensichtlich sehr stolz, denn er verwendet vor allem in der ersten Romanhälfte viele, viele Seiten darauf, uns die Ergebnisse entsprechender Recherchen nahezubringen.
|Ich denke, aber bin ich?|
Sind wir denn so begriffsstutzig? Wollen wir es so genau wissen? Auf sein FBI-Publikum – es vertritt die Leser – redet Professor Bible jedenfalls so intensiv ein, bis es nur noch Bahnhof versteht. Bakker nutzt dabei den Respekt (oder die Abscheu) des „normalen“ Lesers vor den Erkenntnissen der Philosophie. Deren Repräsentanten machen sich schwere Gedanken über das Wesen der Welt. Dabei kommen sie zu Ergebnissen, die manchmal kurios und vor allem schwierig nachvollziehbar sind.
Die Theorie, dass die Realität des Menschen nicht der Realität entspricht, sondern eine durch das Gehirn gefilterte Interpretation darstellt, ist in der Philosophie schon alt. Die moderne medizinische Forschung ergänzte dieses Denkmodell durch das Bild des Gehirns als biologische Maschine, die ausschließlich auf äußere Reize reagiert, während der Mensch für das Gros seiner Gedanken und Handlungen fälschlich einen „freien Willen“ reklamiert. Dies ist wie gesagt ein Bild, das aber leicht verständlich ist und sich – beispielsweise für einen Thriller – instrumentalisieren lässt. Aus einem Potpourri mehr oder weniger nihilistischer Weltmodelle und kombiniert mit in den Plot eingerührten medizinischen Einsichten konstruiert Bakker den „Neuropathen“: einen Soziopathen, der wahnhaft unfähig ist, seinen neurologischen „Erkenntnissen“ (keine) Taten folgen zu lassen.
|Eigentlich bleibt alles beim Alten|
Dieser Bösewicht stellt bei nüchterner Betrachtung nur den sprichwörtlichen Kaiser in neuen Kleidern dar. So verwirrend ist das Konzept der Neuropathie nicht. Originell ist es ebenfalls nicht. Bakker bemüht sich, es originell klingen zu lassen – als Autor mit dem Auftrag, seine Leser zu unterhalten, ist dies legitim -, es gelingt jedoch nur bedingt.
In der Neuropathen-Wundertüte geht es erstaunlich geordnet zu. Bakker entwirft einen Roman mit konventionellem Handlungsablauf und entsprechenden Figuren. Dies allein ist ihm nicht zum Vorwurf zu machen, denn das Prinzip – Gut & Böse verfolgen einander bis zur finalen Konfrontation – ist ein funktionsbewährter Klassiker. Der Verfasser mag sich indes nicht auf die „reine“ Form verlassen. Er verschneidet seinen Plot mit Seifenoper-Elementen. Folgerichtig gibt es eine Liebesgeschichte, ein guter Hund kommt zu Tode, und kleine Kinder geraten in Lebensgefahr.
Diese Aufzählung ist nur zum Teil ironisch. Bakker arbeitet oft mit Klischees, denen er nichts Neues abzuringen weiß. Solche Zwischenmenschlichkeiten werden der Handlung eingefügt, weil bestimmte Lesergruppen sie erwarten. Wen wunderts, dass diese Passagen jene Begeisterung vermissen lassen, mit der sich Bakker dem Neuropathen-Erzählstrang widmet, der ihn spürbar stärker interessiert hat?
|Yin und Yang des Bewusstseins|
In einem Nachwort erläutert Scott Bakker, dass er sich für seinen Roman realer wissenschaftlicher Erkenntnisse bediente, die er verfremdete und dramatisch übersteigerte, wo es den Plot beflügeln konnte: |“Was früher allein die abstrakten Befürchtungen von Philosophen gewesen sind, hat Fleisch und Knochen bekommen.“| (S. 447) Nachdem er dies deutlich gemacht hat (und obwohl er die Seifenoper weiterspielt), lotet Bakker die Möglichkeiten der Hirnmanipulation einerseits durchaus gruselig und konsequent aus.
Andererseits führt er mit dieser Konsequenz die Handlung direkt in eine Sackgasse. Die finale Erkenntnis des neuropathischen Denkens erfährt Bible nur, wenn er sich seinem Feind mit Haut & Haaren bzw. Hirn ausliefert. Dass es darauf hinauslaufen wird, wird dem Leser sehr früh klar. Bakker versucht kurz zuvor mit einer dramatischen Episode für Ablenkung zu sorgen, aber er fabriziert mit nur Stirnrunzeln mit dem plötzlich ins Geschehen eingeschobenen Subplot von den hirnmanipulierten Regierungsagenten, die moralbefreit Staatsfeinde jagen.
Als er mit Frankenstein Neils technischer Meisterschöpfung, der „Marionette“, verdrahtet und hilflos daliegt, bleibt Bible nur, mit seinem Peiniger die üblichen Debatten zu führen: Während Neil im Gotteswahn kryptisch faselt, klammert sich Bible an uramerikanische Moral- und Familienwerte. Da ihn Gerede nicht aus der Bredouille bringt, greift Bakker schließlich auf die schlechteste aller möglichen Lösungen zurück und lässt einen „deus ex machina“ die Rettung weniger bringen als übers Knie brechen.
Vom pseudofachlichen und modischen Beiwerk befreit kann „Neuropath“ als Thriller nur bedingt überzeugen, geschweige denn unterhalten. Zu viel Gerede, zu viele Klischees können auch durch Science-Fiction-Elemente und schlechte Action-Einlagen nicht ausgeglichen werden. „Neuropath“ bleibt im interessanten Ansatz stecken. Weniger verfasserlicher Ehrgeiz und mehr schriftstellerisches Handwerk hätten dem Leser möglicherweise eine befriedigendere Lektüre beschert.
_Autor:_
Richard Scott Bakker wurde am 2. Februar 1967 in Simcoe in der kanadischen Provinz Ontario geboren. Seit 1986 studierte er zunächst an der University of Western Ontario und später Philosophie an der Vanderbilt University, die er allerdings vor seinem Abschluss verließ. Bakker siedelte nach London, Ontario, über, wo er noch heute – inzwischen verheiratet – lebt und arbeitet.
Noch während seiner Universitätsjahre entwickelte Bakker eine Fantasy-Serie, der er den Obertitel „The Second Apocalypse“ gab. Ursprünglich als Trilogie geplant, entwickelte sich die Handlung schnell weiter, nachdem Bakker zu schreiben begann. 2003 erschien mit „The Darkness That Comes Before“ (dt. „Schattenfall“) der erste Band der inzwischen abgeschlossenen „Prince of Nothing“-Trilogie (dt. „Krieg der Schatten“), der sich ab 2009 die „Aspect-Emperor“-Trilogie anschloss.
Auf Anregung seiner Ehefrau schrieb Bakker 2008 den Thriller „Neuropath“, der einen typischen „mad scientist“ als Serienkiller schildert. 2010 folgte „Disciple of the Dog“.
|Taschenbuch: 447 Seiten
Originaltitel: Neuropath (London : Orion Books 2008)
Übersetzung: Jürgen Bürger
Deutsche Erstausgabe: April 2010 (Wilhelm Heyne Verlag/TB Nr. 52458)
ISBN-13: 978-3-453-52458-3|
[www.heyne-verlag.de]http://www.heyne-verlag.de
_Richard Scott Bakker bei |Buchwurm.info|:_
[„Schattenfall“ (Krieg der Propheten 1) 2972
Philip Jolowicz – Das Vermächtnis des Bösen
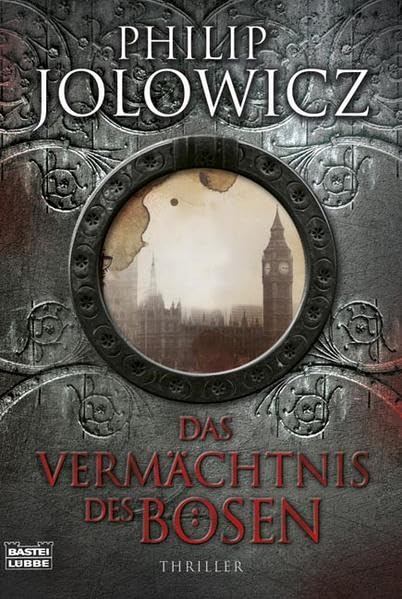
Philip Jolowicz – Das Vermächtnis des Bösen weiterlesen
Richard Stark – Das große Gold [Parker 21]
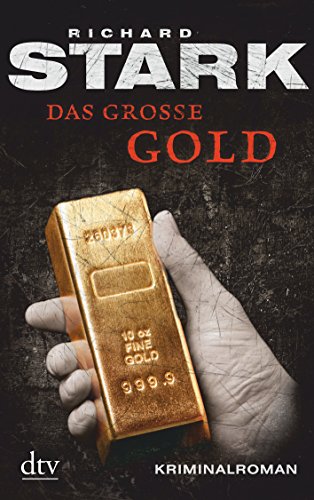
Algernon Blackwood – Die gefiederte Seele. Gespenstergeschichten
Mit zehn Kurzgeschichten und einer Novelle zielt der Autor nicht auf den Bauch-Grusel, sondern dringt – manchmal allzu behutsam aber eindrucksvoll und unsentimental – in die Schattenbereiche der menschlichen Seele vor:
– Das dreifache Band (The Threefold Cord, 1931), S. 7-20: Die schöne aber unheimliche Frau hat bereits den Großvater und den Vater in den Tod getrieben, und nun macht sie sich an den Sohn heran.
– Das Land des grünen Ingwer (The Land of Green Ginger, 1930), S. 21-29: Ein ebenso faszinierendes wie verstörendes Erlebnis lässt den späteren Schriftsteller seinen Lebensweg finden. Algernon Blackwood – Die gefiederte Seele. Gespenstergeschichten weiterlesen
Victor Gunn – Das Wirtshaus von Dartmoor

Victor Gunn – Das Wirtshaus von Dartmoor weiterlesen
(H. P. Lovecraft)/August Derleth – Die dunkle Brüderschaft. Unheimliche Geschichten

Inhalt:
– Der Nachkomme (The Survivor, 1954), S. 7-30: Nicht nur mit der Geduld des Krokodils ausgestattet, trotzt Dr. Charrieres seit Jahrhunderten dem Tod.
– Das Erbe der Peabodys (The Peabody Heritage, 1957), S. 31-55: Als Mr. Peabody pietätvoll das Gerippe seines Urgroßvaters im Sarg umdreht, wird uralter Hexenzauber neu belebt.
– Das Giebelfenster (The Gable Window, 1957), S. 56-74: Der Blick in fremde Welten fasziniert, bis deren unfreundliche Bewohner auf den heimlichen Beobachter aufmerksam werden.
– Der Vorfahr (The Ancestor, 1957), S. 75-90: Der Geist triumphiert über die Materie, aber reizt man diese dabei zu stark, schlägt sie irgendwann grausam zurück.
– Der Schatten aus dem All (The Shadow Out of Space, 1957), S. 91-112: Durch Raum und Zeit reist der entsetzte Erdenmann, als er sich unfreiwillig für einen uralten kosmischen Krieg rekrutiert sieht.
– Das vernagelte Zimmer (The Shuttered Room, 1959), S. 113-150: Was der Großvater gefangen hielt aber nicht vernichten konnte, wird vom ahnungslosen Enkel freigesetzt.
– Die Lampe des Alhazred (The Lamp of Alhazred, 1957), S. 151-161: Ihr Licht enthüllt Wunder und Schrecken, und einem Träumer weist sie den Weg in eine bessere Welt.
– Der Schatten in der Dachkammer (The Shadow in the Attic, 1964), S. 162-183: Was der böse Onkel dem Neffen als Erbe hinterließ, besucht ihn des Nachts in seinem Schlafzimmer.
– Die dunkle Brüderschaft (The Dark Brotherhood, 1966), S. 184-211: Sie sehen aus wie Edgar Allan Poe – und sie planen eine Invasion der besonders umständlichen Art.
– Das Grauen vom mittleren Brückenbogen (The Horror from the Middle Span, 1967), S. 212-233: Eine Flutwelle setzt frei, was bisher sorgfältig in seinem Mausoleum gefangen lag.
– Originaltitel & Copyright-Vermerke: S. 234
Unterhaltsam auf den Spuren des Meisters
Der deutsche Phantastik-Fan kennt August Derleth – falls ihm der Name überhaupt etwas sagt – höchstens als literarischen Nachlassverwalter des Grusel-Großmeisters H. P. Lovecraft (1890-1937). Derleth ist es zu verdanken, dass dieser schon lange jenen verdienten Ruhm erntet, der ihm zeitlebens verwehrt blieb. Doch Derleth war selbst ein fleißiger Autor. Seine Horrorgeschichten bilden einen vergleichsweise geringen Anteil an einem eindrucksvollen Gesamtwerk.
Weil Derleth sich hier jedoch stark an Lovecraft anlehnte und dessen Cthulhu-Zyklus durch eigene Beiträge vermehrte, wurde er primär durch seine Pastichés bekannt. Falsch aber folgerichtig erscheint die hier vorgestellte Sammlung unheimlicher Geschichten unter Erstnennung von Lovecrafts Namen. Sie entstammen jedoch allein der Feder Derleths, dessen Namen allerdings die Kundschaft längst nicht so lockt wie das Zauberwort „Lovecraft“.
Doch die in „Die dunkle Brüderschaft“ gesammelten Storys stellen mustergültig heraus, was die Phantastik Lovecraft verdankt, weil Derleth es zwar sehr gut kopieren aber nur ausnahmsweise nachschöpfen konnte. Vor allem Leser, die Lovecrafts Werk nicht kennen, sondern einfach für handfesten Grusel schwärmen, werden diese Einschränkung getrost ignorieren und ignorieren dürfen, denn eines sind Derleths Geschichten (bis auf eine Ausnahme: s. u.) garantiert: unterhaltsam!
Neugier bringt nicht nur die Katze um
Man sollte sie nach und nach lesen, denn auf diese Weise wird weniger offenbar, dass diese Storys recht einfallsarm einem bestimmten Muster folgen: Ein durchschnittlicher Zeitgenosse gerät durch Erbschaft, beruflich oder Zufall ahnungslos dorthin, wo düstere Mächte – oft in Gestalt zauberisch aktiver Vorfahren – kraftvoll ihr Unwesen trieben. Er (nie sie!) findet Spuren, die sein Interesse wecken und entsprechende Nachforschungen in Gang setzen. Das Resultat ist stets fatal: Längst vergangene Schrecken erweisen sich als höchst lebendig. Der unglückliche Forscher gerät in ihren Bann. Hat er Glück, kostet ihn die Erkenntnis, dass diese Welt keineswegs so funktioniert, wie es die ‚offizielle‘ Wissenschaft behauptet. ‚nur‘ seine geistige Gesundheit. Meist kommt es übler, wobei der Tod nicht einmal das schlimmste Schicksal darstellt.
Lovecraft postulierte eine von Derleth übernommene und ausgebaute (Universal-) Geschichte, die von der Existenz intelligenten Lebens weit vor der Entstehung des Menschen ausging. Kosmische Entitäten treiben ein Spiel, das der beschränkte menschliche Geist nur in Ansätzen begreifen kann: „Der Mensch ist schließlich nur eine kurzlebige Erscheinung auf dem Antlitz eines einzigen Planeten in einer der ungeheuren Welten, die das ganze All ausfüllen“ (aus: „Die dunkle Brüderschaft“, S. 108). Dieses rudimentäre Wissen wird immer wieder zur Quelle eines Entsetzens, das nicht nur auf offensive Attacken aus dem Jenseits, sondern auch auf ein Zuviel an Wissen zurückgeht, das der einzelne Mensch, der sich plötzlich buchstäblich mit einem ganzen Universum fremder und feindseliger Kreaturen konfrontiert sieht, nicht meistern kann.
Mit Jenseits ist hier übrigens nicht die Heimat der Toten gemeint. Derleth übernimmt Lovecrafts Prämisse eines Kosmos‘, dessen Raum und Zeit nicht stabil gefügt, sondern im Fluss sind. Die dem Menschen vertraute Realität bildet nur eine von unzähligen möglichen Welten, die zu allem Überfluss durch Dimensionsportale miteinander verbunden sein können. Obwohl diese Geschichten von Angst und Entsetzen erzählen, gründen sie nicht nur im Horror, sondern auch oder vor allem in der Science Fiction. Der Schrecken entsteht durch die absolute Fremdheit der kosmischen Wesen, deren Handeln womöglich nicht einmal böse im menschlichen Sinne, sondern primär unverständlich ist.
Schrecken aus zweiter Hand?
„Die dunkle Brüderschaft“ sammelt Geschichten, in denen August Derleth den Cthulhu-Mythos kommentierte und ergänzte. Er beschwört den Geist des Vorbilds und lässt ihn sogar mehrfach selbst auftreten (so als „Ward Phillips“ in „Die Lampe des Alhazred“ und als „Arthur Phillips“ in „Die dunkle Brüderschaft“). Derleth geht dabei Lovecrafts Imaginationskraft meist ab; er kopiert seinen Meister, den er freilich gut kennt. Der erfahrene Leser kann die Schnittstellen, d. h. die imitierten Vorlagen, leicht namhaft machen. „Der Schatten aus dem All“ ist beispielsweise eine Variation des Lovecraft-Kurzromans „Berge des Wahnsinns“.
Die älteren Geschichten lesen sich notabene besser als die Storys des ‚späten‘, schon nicht mehr gesunden und ausgelaugten Derleth. So ist die Titelstory „Die dunkle Brüderschaft“ ein missglücktes Werk, das zunächst stimmungsvoll an Lovecrafts Liebe zu den historischen Stätten Neuenglands erinnert, un plötzlich in eine Überfall-aus-dem-All-Plotte abzurutschen; Derleth kreiert dabei Invasoren, die es an Planungsdämlichkeit problemlos mit dem Bug-Eyed-Monster-Pärchen Kang & Kodos aus der TV-Serie „Die Simpsons“ aufnehmen. Auch was der finstere Onkel Uriah in „Der Schatten in der Dachkammer“ eigentlich plante, bleibt unklar; das abrupte Ende der Story legt nahe, dass der Verfasser es selbst nicht wusste.
Wagt es Derleth, sich wenigstens teilweise vom übermächtigen Lovecraft zu emanzipieren, gelingt ihm eigenständig Spannendes und Unheimliches. Mit „Das vernagelte Zimmer“ stellt er eine richtig gute Gruselgeschichte vor – ideenreich, effektvoll, sorgfältig getimt. Diesen August Derleth liest man gern; er weckt die Neugier auf Storys, die nicht dem Cthulhu-Mythos angehören. Diese fanden ihren Weg leider nur ausnahmsweise nach Deutschland, wo sie zudem über unzählige, längst vergessene Sammelbände verstreut und in der Regel nicht annähernd so nah am Original und so lesenswert übersetzt wurden wie die die Geschichten in „Die dunkle Brüderschaft“.
Autor
August William Derleth wurde am 24. Februar 1909 in Sauk City (US-Staat Wisconsin) geboren. Schon als Schüler begann er Genre-Geschichten zu verfassen; ein erster Verkauf gelang bereits 1925. Die zeitgenössischen „Pulp“-Magazine zahlten zwar schlecht, aber sie waren regelmäßige Abnehmer. 1926 nahm Derleth ein Studium der Englischen Literatur an der „University of Wisconsin“ auf. Nach dem Abschluss (1930) arbeitete in den nächsten Jahren u. a. im Schuldienst und als Lektor. 1941 wurde er Herausgeber einer Zeitung in Madison, Wisconsin. Diese Stelle hatte Derleth 19 Jahre inne, bevor er 1960 als Herausgeber ein poetisch ausgerichtetes (und wenig einträgliches) Journal übernahm.
Obwohl August Derleth ein ungemein fleißiger Autor war, basiert sein eigentlicher Nachruhm auf der Gründung von „Arkham House“ (1939), des ersten US-Verlags, der speziell phantastische Literatur in Buchform veröffentlichte. Der junge Derleth war in den 1930er Jahren ein enger Freund des Schriftstellers H. P. Lovecraft (1890-1937). Dass dieser heute als Großmeister des Genres gilt, verdankt er auch bzw. vor allem Derleth, der (zusammen mit Donald Wandrei, 1908-1987) das Werk des zu seinen Lebzeiten fast unbekannten Lovecraft sammelte und druckte.
Lovecraft hinterließ eine Reihe unvollständiger Manuskripte und Fragmente. Derleth nahm sich ihrer an, komplettierte sie in „postumer Zusammenarbeit“ und baute den „Cthulhu“-Kosmos der „alten Götter“ eigenständig aus. Die Literaturkritik steht diesem Kollaborationen heute skeptisch gegenüber. Als Autor konnte Derleth seinem Vorbild Lovecraft ohnehin nie das Wasser reichen. Er schrieb für Geld und erlegte sich ein gewaltiges Arbeitspensum auf, unter dem die Qualität zwangsläufig litt.
Solo war Derleth mit einer langen Serie mehr oder weniger geistvoller Kriminalgeschichten um den Privatdetektiv Solar Pons erfolgreich, der deutlich als Sherlock-Holmes-Parodie angelegt war. Insgesamt veröffentlichte Derleth etwa 100 Romane und Sachbücher sowie unzählige Kurzgeschichten, Essays, Kolumnen u. a. Texte; hinzu kommen über 3000 Gedichte.
Nach längerer Krankheit erlag August Derleth am 4. Juli 1971 im Alter von 62 Jahren einem Herzanfall. Zum zweiten Mal verheiratet, lebte er inzwischen wieder in Sauk City, wo er auf dem St. Aloysius-Friedhof bestattet wurde.
Taschenbuch: 234 Seiten
Originaltitel: The Watchers Out of Time (Sauk City : Arkham House 1974)
Übersetzung: Franz Rottensteiner
http://www.suhrkamp.de
Der Autor vergibt: 



Barr, Nevada – Wolfsspuren
_Das geschieht:_
Bevor Anna Pigeon ihre neue Stelle als oberste Polizistin im Rocky-Mountain-Nationalpark antritt, nimmt sie an einem besonderen Forschungsprojekt teil: Auf der Isle Royale, der größten Insel des Oberen Sees im Norden des US-Staates Minnesota und unmittelbar an der Grenze zu Kanada gelegen, wird seit fünf Jahrzehnten das Verhalten von Wölfen studiert. Sechs Wochen soll dieser Einsatz dauern, der Pigeon im eisigen Wintermonat Januar wider Erwarten in einen ganz und gar nicht der Wissenschaft gewidmeten Mikrokosmos verschlägt.
Die Politik hat die Forschung instrumentalisiert. Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 wird die Regierung von der Furcht geplagt, dass Terroristen sich durch die unbesiedelten Naturschutzgebiete in die USA einschleichen könnten. Wie dies auszuschließen ist, soll ein Team der Heimatschutzbehörde auch im Isle-Royal-Park überprüfen. Bob Menechinn, der Chef, hat wenig Verständnis für Ridley Murray, den Leiter des Forschungsteam, dem die Wölfe wichtiger sind als die überall lauernden Terroristen.
In der Winterwildnis weitgehend auf sich gestellt, bauen sich innerhalb der kleinen Gruppe schnell Spannungen auf. Menechinn erweist sich als lautstarker, aber ängstlicher Mann; vor Wölfen fürchtet er sich panisch, was fatal ist, weil sich gerade jetzt ein ungewöhnlich großes und bedenklich dreistes Exemplar auf der Isle Royale herumtreibt. Als Menechinns Assistentin nach einem Streit in die Nacht hinausstürmt, finden die Gefährten später ihre zerrissene Leiche. Doch hat wirklich ein Wolf die Frau gepackt, oder wurde hier ein Mord getarnt? Annas detektivischer Instinkt erwacht, was innerhalb des zerstrittenen Teams nicht unbemerkt bleibt und auch sie das Leben kosten könnte …
_Der Mensch ist des Menschen Wolf_
Kommen sie zusammen – der politisch korrekte, hier ökologische sowie (sacht) feministische Impetus und der unterhaltsame Kriminalroman? Die Antwort lautet wie so oft: mal weniger, mal mehr – in dieser Reihenfolge. Das klingt nicht günstig, und in der Tat hinterlässt „Wolfsspuren“, der 14. Roman der Anna-Pigeon-Serie, bei aller Freude, die Autorin und ihre Heldin wieder in deutscher Übersetzung erleben zu können, einen zwiespältigen Eindruck.
Zu den positiven Seiten gehören zweifellos die sorgfältigen Figurenzeichnungen sowie eindrucksvolle Beschreibungen einer gleichermaßen unwirtlichen wie faszinierenden Landschaft. Nevada Barr gelingt es, das polare Nordamerika im Winter wie einen fernen Planeten darzustellen. Geschickt konterkariert sie die Anwesenheit moderner Hightech wie Internet und Satellitentelefon mit der weiterhin realen Unmöglichkeit, einen Ort wie die Isle Royale tatsächlich zu erreichen. Im 21. Jahrhundert kann dich der Tod dort beim Googeln in Gestalt klirrender Kälte oder knurrender Wölfe erreichen.
Hinzu kommen die nicht nur im Krimi üblichen zwischenmenschlichen Verwicklungen. Barr nutzt zum Aufbau von Spannung geschickt die Situation einer isolierten Gruppe, die ihrer sozialen Dynamik quasi ausgeliefert ist. Hehre Forschung ist das Ziel, doch Konflikte bleiben dabei keineswegs außen vor. Die Gruppe zieht an zwei unterschiedlichen Strängen, und auch privat gibt es zahlreiche Reibungspunkte, die zur Entzündung gefährlicher Leidenschaften führen.
Den Menschen stellt Barr die Wölfe der Isle Royale gegenüber. Sie töten zwar unbarmherzig, aber dies nur mit dem Vorsatz, sich vor dem Hungertod zu bewahren. Heimtücke kennen sie nicht, sie folgen ihren Instinkten. Damit bilden sie einen integralen Bestandteil ihres Ökosystems, in dem der Mensch nur ungebetener und oft unfreundlicher Gast und zudem sein eigener Wolf ist, der sehr viel bösartiger umsetzt, was er dem echten Raubtier gern unterstellt.
_Die Globalisierung erreicht jeden Winkel_
Der Gipfel der Absurdität wird am zuverlässigsten noch immer im realen Leben erreicht. So hat sich der Gedanke, dass böse Terroristen sich unter einen Elchbauch binden, um so heimlich die Nordgrenze der USA zu passieren, tatsächlich in den Köpfen derer festgesetzt, die über die Macht verfügen, ihren paranoiden Gedanken Taten folgen zu lassen. Also treiben sich die Bob Menechinns dieser Welt dort herum, wo sie sich in sicherer Entfernung und außer Reichweite echter Terroristen wichtig machen können.
Hilflos müssen die in ihrer Forscherwelt gefangenen Wissenschaftler die Eindringlinge gewähren lassen. Bisher waren sie, denen in der Regel die Ellenbogen für den Karrierekampf fehlen, wenigstens an Orten wie der Isle Royale zeitweise in Sicherheit. Nun folgen ihnen die Pfennigfuchser und Erbsenzähler auch dorthin. Die Reaktion ist ebenso kindisch wie verständlich, die Folgen sind tragisch: Im Bemühen, die Störenfriede zu vertreiben, werden die Wissenschaftler selbst zu Schuldigen.
Während Barr die psychologischen Aspekte dieses Konfliktes gut herausarbeitet, wirkt ihr ‚Lösungsansatz‘ – der gleichzeitig integraler Bestandteil des Krimi-Plots ist – recht naiv. Vielleicht liegt es daran, dass Barr als Alter Ego von Anna Pigeon eindeutig Partei ergreift. Leider gehen sowohl Begeisterung als auch Empörung mit ihr durch. Die Natur ist schön, mysteriös und mächtig, und wer sich ihr nicht öffnen kann, ist entweder dumm oder böse oder beides. Damit gerät Barr in die ausgefahrene Spur jener Öko-Fanatiker, die man ob ihres Übereifers, ihrer epiphanischen Visionen und ihrer humorlosen Unduldsamkeit bespöttelt und unbeachtet lässt.
_Hat jetzt endlich jede/r begriffen?_
Selbstverständlich verschärft Barr um des Effektes willen die prägenden Charakterzüge ihrer Figuren. Dabei streift sie die Grenze zur Karikatur. Neben der allzu ätherischen Waldfrau Robin gerinnt ihr vor allem der schon mehrfach erwähnte Bob Menechinn, den Barr nicht nur als naturfernen Karrieristen, sondern auch als Chauvinisten-Schwein brandmarken will, im großen (und schier endlosen) Finale zum Schurken-Witzbold mit Werwolf-Touch, über dessen mörderische Possen man sich nicht entsetzen mag, sondern eher grinsen kann.
Ausgerechnet Anna Pigeon, die Hauptfigur, ist im Grunde eine langweilige Person. Sie leidet unter einem Helfersyndrom, das die Natur ebenso einschließt wie junge und hilflose Mitschwestern, denen Anna gegen die bösen, groben Kerle notfalls auch ungefragt zur Hilfe eilt. Überall und ständig wittert sie chauvinistische Umtriebe, gegen die auch eigentlich ganz anständige Mannsleute nie völlig gefeit sind. Sie gesellen sich zu den anderen Finsterlingen von Pigeons Welt: Politiker, Urlauber, die ihre Trampelfüße in Annas geheiligte Wälder setzen wollen, und die sture Parkverwaltung.
Bis die Fronten geklärt sind, müssen mehr als 250 eng bedruckte Buchseiten durchgehalten werden. Die bis dato erzählte Geschichte ist nicht langweilig, aber Barr bekommt die Kurve zum Krimi erst in letzter Sekunde und dann nur knapp. Das dem Plot zugrunde liegende Verbrechen erweist sich als Import aus der Zivilisation. Er verseucht die grundsätzlich unschuldige Forschergemeinschaft und kulminiert in einem Höhepunkt, der wie angeklebt wirkt, um der Geschichte abschließend ein wenig Dynamik förmlich einzuprügeln. In B-Film-Manier raufen Heldin und Schuft noch viele, viele Seiten, während die Auflösung längst erfolgt ist. Wahrscheinlich ist es besser so, denn was sich Barr einfallen ließ, um die Mysterien der Isle Royale zu erklären, ist dürftig und leidet als Mordintrige unter tiefen Logiklöchern.
Der 14. Anna-Pigeon-Roman bietet somit zumindest den Krimi-Freunden solide, d. h. mittelmäßige Lektürekost und gehört nicht zu den Höhepunkten der schon (zu?) lange laufenden Serie. Erfreulich ist dagegen die deutsche Ausgabe als altbacken gestaltetes, aber gut übersetztes und kostengünstiges Taschenbuch.
_Die Autorin_
Nevada Barr wurde zwar 1952 Yerington im US-Staat Nevada (dem sie ihren Vornamen verdankt) geboren. Aufgewachsen ist sie indes in Kalifornien, wo ihre Eltern einen kleinen Flugplatz leiteten. Nevada wurde Schauspielerin. Vor die Kamera trat sie in den 1960er und 70er Jahren allerdings vor allem in Werbespots. Ansonsten sah man sie im Theater oder hörte sie im Radio.
Keineswegs durch ihre Karriere überbeansprucht, begann Barr zu schreiben. Sie versuchte sich an Reiseberichten ebenso wie an Bühnenstücken und konnte 1984 einen ersten Roman veröffentlichen. „Bittersweet“ ist (noch) kein Krimi, sondern die tragische Liebesgeschichte zweier Frauen in der Kulisse des „Wilden Westens“.
Ihr Engagement in Sachen Umweltschutz gab Nevada Barr, die in ihrer Freizeit als Ranger im Dienst der „National Park Services“ tätig war, die Idee für einen Kriminalroman („Track of the Cat“, dt. „Die Spur der Katze“) ein, der aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen aufgriff, diese mit frauenspezifischen Aspekten verband und ökologische Themen einschnitt. Was zu einem politisch korrekten, aber unleserlichen Manifest hätte gerinnen können, wurde 1993 zum ebenso unterhaltsamen wie erfolgreichen Start einer bis heute fortgesetzten Serie um die Ranger-Frau Anna Pigeon.
In die Pigeon-Figur lässt Barr autobiografische Züge einfließen. Anna ist (inzwischen trockene) Alkoholikerin, depressiv, etwas einzelgängerisch und mit dem für einen Detektiv unumgänglichen Misstrauen gegenüber Autoritäten ausgestattet. Lange Jahre arbeitet sie im Mesa Verde Nationalpark in Colorado. Von dort verschlägt es sie dienstlich in andere grüne Winkel des nordamerikanischen Kontinents, was für Abwechslung in den Handlungskulissen sorgt. Privat lebt Anna lange allein und ‚unterhält‘ ihre Leser/innen mit entsprechenden Seelenqualen. Neuerdings ist sie nicht nur neu verheiratet, sondern hat auch Mesa Verde verlassen, was wie geplant frischen Wind in die Anna-Pigeon-Serie gebracht hat.
Dies zu beurteilen, fällt den deutschen Lesern nicht leicht: Nevada Barr gehört zu den Autoren, die von ihrem hiesigen Verleger als nicht rentabel genug ‚abgeschossen‘ wurden. Die Bände 6 bis 13 sind nie erschienen, aber 2009 ging es mit Nr. 14 in einem neuen Verlag weiter; da Barr vor allem die persönliche Pigeon-Chronik kontinuierlich fortspinnt, werfen viele Entwicklungen und Andeutungen hierzulande Fragen auf; ein Schwebezustand, den das deutsche Krimi-Publikum allerdings zur Genüge kennt …
_Impressum_
Originaltitel: Winter Study (New York : G. B. Putnam’s Sons 2008)
Deutsche Erstausgabe: Dezember 2009 (Weltbild Buchverlag/Weltbild Taschenbuch – Originalausgaben)
Übersetzung: Karin Dufner
432 Seiten
EUR 5,95
ISBN-13: 978-3-86800-274-4
http://www.weltbild.de
Maberry, Jonathan – Patient Null
_Das geschieht:_
Joe Ledger ist ein hartgesottener Ordnungshüter, der als Mitglied einer Sondereinheit der Polizei von Baltimore die Augen offen und die Waffe entsichert hält, um aufmerksam nach Terroristen und anderen Strolchen auszuschauen, die seit dem 11. September 2001 in Scharen die USA zu infiltrieren versuchen. Gerade erst hat er einen neuerlichen Vorstoß solchen Gesindels aufgedeckt und persönlich beim Versuch, die Lumpenzelle auszuheben, nicht nur namenloses Fußvolk, sondern auch den prominenten Mordstrolch Javad Mustafa mit Blei vollgepumpt.
Vier Tage später wird das FBI bei Ledger vorstellig. Man konfrontiert ihn mit einem zwar mausetoten, aber putzmunteren Mustafa, der sich erstens als Zombie und zweitens als biologische Waffe muslimischer Gotteskrieger entpuppt. Solche Untoten sollen in die USA geschleust werden und dort brave Bürger beißen, die sich daraufhin ebenfalls in lebende Leichen verwandeln! Dahinter steckt El Mudschahid, selbst ernannter Zorn Gottes. Um ihm Einhalt zu gebieten, wollen Geheimdienst und FBI eine Taskforce zusammenstellen und den Zombiemachern aus dem Nahen Osten ordentlich einheizen. Als guter Amerikaner kann und will Ledger trotz seiner Probleme mit Autoritäten dabei nicht tatenlos zusehen.
Hinter dem charismatischen, aber manipulierbaren El Mudschahid zieht der skrupellose Machtmensch Sebastian Gault die Fäden. Zusammen mit der wunderschönen und superschlauen Amirah hat er die Zombies buchstäblich entwickeln lassen, um den für seine unzähligen Firmen sehr lukrativen Terrorkrieg auf eine neue Ebene zu hieven. In dieses Geschäft will er sich nicht von US-Saubermännern pfuschen lassen und aktiviert seine Schergen, die gemeinsam mit den Zombies Ledgers Ledernacken einen unfreundlichen und bissigen Empfang bereiten …
_Die Welt im schwarz-weißen Schattenriss_
Man kann Jonathan Maberry nicht vorwerfen, aus seiner Weltsicht ein Geheimnis zu machen. Als Widmung stellt er seinem seitenstarken Zombie-Thriller folgende Zeilen voran: „Dieses Buch ist all jenen oft nicht beachteten und unbesungenen Helden gewidmet, die für die Geheimdienste bei verdeckten Operationen ganz einfach ihren Job machen.“ Er schweigt sich darüber aus, ob er dabei auch jene einschließt, die sich z. B. in Abu Ghuraib für die US-Sache ins Zeug gelegt haben, doch der Kontext lässt wenig Gutes ahnen. Zurückhaltung oder die Einhaltung von Gesetzen sind für Maberry jedenfalls keine Rezepte, um die Schurken dieser Welt Mores zu lehren, denn die sind unbelehrbar böse, heimtückisch und rücksichtslos, während Politiker wankelmütig oder korrupt vor allem am eigenen Posten kleben. Zumindest mit dem gedruckten Wort kann Maberry zeigen, wie’s eigentlich zugehen sollte!
„Patient Null“ drückt natürlich nur sekundär eine politische Haltung aus. Primär will Maberry (so bleibt zu hoffen) unterhalten. Eine grobe Differenzierung der Realität in schwarz = böse = Naher Osten (oder Nordkorea, Kuba bzw. Nicht-USA) und weiß = gut = USA hat dabei selten geschadet, wie unter anderem Hollywood immer wieder unter Beweis stellt. Für die Arena, in die der Kampfsportler Maberry die Welt als Handlungsort verwandelt hat, klingt dieses Konzept einfach und einleuchtend, weshalb er es für sein literarisches Schaffen übernommen hat.
_Ist doch alles nur Spaß …!_
Aktion erzeugt Reaktion. Auf dieses simple Schema hat Maberry die Dramaturgie des Geschehens reduziert. Diese Struktur hat Vorteile; so lassen sich vom Verfasser in Serie geschilderte Kampfszenen modulartig aneinander klinken, bis die mit dem Verlag vereinbarte Seitenzahl in Sichtweite gerät und es Zeit für das große Finale wird.
Politisch korrekt denkenden Lesern – auch diese sind mögliche Buchkäufer – sperrt Maberry ein Hintertürchen auf: Zwar gibt es mit El Mudschahid einen Burnus-Banditen, der mit Lust und Liebe Mordpläne gegen die USA inszeniert und den Koran als Steinbruch für farbenfrohe Metzeleien ausbeutet, doch hinter ihm steht ein Schlips-Schurke aus dem Abendland, den nicht Idealismus, sondern blanke Macht- und Geldgier antreiben.
El Mudschahid, Amirah und Sebastian Gault sind Bilderbuch-Böslinge, die für ein Rumpelpumpel-Abenteuer wie „Patient Null“ passend grob geschnitzt wurden. Sie tücken und schurken mit schmierenkomödiantischer Wonne, und es bleibt ihnen immer Zeit genug, dies durch kaltschnäuzige Phrasen zu unterstreichen. Damit komplettiert sich das Bild überlebensgroßer Übeltäter, die man keine Sekunde ernst nehmen kann.
Immerhin verschont der Autor auch seine Helden nicht. Über Joe Ledger muss man grinsen, wenn er sich als Peter Pan der „Terminator“-Ära gibt. Mit den Jahren ist er nicht schlauer geworden, sondern markiert nur den taffen Möchtegern-Rebellen. Weil Maberry Ledgers Kampf gegen verkrustete Konventionen sich nüchtern betrachtet als Kette kindisch-bockiger Regelverstöße darstellt, bleibt diese Figur nur ein Schwätzer, der sich letztlich doch wieder dem System eingliedert und unterwirft. Wenn Ledger dabei zum Anführer einer Elite-Einsatzgruppe aufsteigt, werden wir selbstverständlich ausgiebig mit pubertären Macho-Spielchen zwischen taffen Kämpfern im Wettstreit um die dickste Hose unterhalten, die durch bewährten Landser-Humor – einer der beinharten Kerls heißt „Bunny“: urkomisch! – ergänzt werden.
_Lesen, ohne denken zu müssen: ein ehrliches Angebot_
Bücher wie dieses soll und darf man nicht ernst nehmen. Das schützt sie zwar keineswegs vor Kritik. Angesichts der von Verfasser Maberry gar nicht verhohlenen Grobschlächtigkeit seines Romans kann diese höchstens ironisch gefärbt werden, bleibt aber letztlich hilflos: Verbrauchslektüre ist relativ rezensionsresistent, denn gelesen wird sie auf jeden Fall, wenn sie ein geneigtes Publikum findet. Davon darf unser Verfasser ausgehen, denn es gibt schlechtere „prose mechanics“ als ihn, zumal Profi Maberry den Fuß ständig auf dem Gaspedal ruhen lässt: „Patient Null“ ist Pageturner-Action der schnell vergessenen, aber zuvor noch schneller voraneilenden Art.
Für Irritation sorgt die Übersetzung. Allerdings ist davon auszugehen, dass es Maberry selbst war, der meinte, seine Geschichte durch eine saloppe, dem Ohr der (nicht mehr allzu intensiv) lesenden Jugend angenehme Umgangssprache zusätzlich aufpeppen zu müssen. Vor allem wenn Ledgar das Wort ergreift, meint der Leser vor dem inneren Ohr Dieter Bohlen zu hören, was zumindest dem Gegner derartigen Pidgin-Sprechs echte Qualen bereitet, die der Lektüre arg abträglich sind.
_Autor_
Jonathan Maberry wurde am 18. Mai 1958 in Kensington (US-Staat Kentucky) geboren. Nach Schule und Studium wurde er als Kampfsportler aktiv. Maberry war und ist nicht nur ein Jujitsu- und Schwertkämpfer von Rang und Namen, sondern gilt auch als Fachmann, der über Kampfsport und Selbstverteidigung zahlreiche Bücher und unzählige Fachartikel schrieb.
Im 21. Jahrhundert machte Maberry seine zweite Leidenschaft zum Beruf: Er wurde Schriftsteller, wobei er als Genre den (harten) Horror wählte. Schon mit seinen ersten drei Werken, der „Pine-Deep“-Trilogie, gelang dem Verfasser der Durchbruch. 2009 begann Maberry 2009 eine neue Serie um den Geheimagenten Joe Ledger, der überall auf der Welt mit Terroristen rauft, die Zombies, Ungeheuer und andere Plagegeister gen USA schicken. 2010 startete Maberry mit „Rot & Ruin“ eine Horror-Serie für jugendliche Leser, die in einem von Zombies verheerten Nordamerika spielt.
Darüber hinaus liefert Maberry Textvorlagen für den Comic-Verlag |Marvel| (u. a. für die Serien „Wolferine“ und „Black Panther“). Außerdem widmet er sich in Artikel und Sachbüchern den Mythen und Realitäten des modernen Horrors. Selbstverständlich ist Maberry auch im Internet ungemein aktiv. [„Jonathan Maberry’s Big, Scary Blog“]http://jonathanmaberry.com ist keineswegs die übliche Mischung aus Eigenwerbung und Buchankündigung, sondern bietet lebendig und kundig Informationen „About Books, Writing, Publishing and Everything in Between“.
Jonathan Maberry lebt in Warrington im US-Staat Kentucky.
Die Joe-Ledger-Serie:
(2009) Patient Null („Patient Zero“)
(2010) „The Dragon Factory“ (noch kein dt. Titel)
(2011) „The King of Plagues“ (noch kein dt. Titel)
_Impressum_
Originaltitel: Patient Zero (New York : St. Martin’s Griffin 2009)
Übersetzung: Wally Anker
Deutsche Erstausgabe: Januar 2010 (Wilhelm Heyne Verlag/TB Nr. 52604)
576 Seiten
EUR 8,95
ISBN-13: 978-3-453-52604-4
http://www.heyne-verlag.de
Steinhauer, Olen – Tourist, Der
_Das geschieht:_
Noch vor sechs Jahren galt Milo Weaver als einer der besten „Touristen“ im Dienst des US-Geheimdienstes CIA: ein Troubleshooter, der um die ganze Welt reiste und Terroristen, Verräter und andere Feinde des „Imperiums“ (wie patriotische Spitzel die USA gern nennen) entlarvte und eliminierte. Ausgebrannt und bei einem fehlgeschlagenen Einsatz schwer verletzt, gab Weaver die Arbeit an der Agentenfront auf, übernahm einen Schreibtischposten, heiratete und wurde der mit in die Ehe gebrachten Tochter ein guter Vater. Nur noch selten wird Weaver von seinem Chef Tom Grainger eine heikle Mission anvertraut.
Das ändert sich, als ein alter Feind den Kontakt zu Weaver sucht. Der „Tiger“ ist ein international aktiver Killer, mit dem der CIA-Agent mehrfach die Klingen kreuzte. Erwischen konnte Weaver ihn nie, weshalb er darauf brennt, den „Tiger“ zu verhören, als der endlich gefasst wird. Er findet einen todkranken Mann vor, der vor seinem Tod ein monströses Komplott zwischen Terroristen aus dem Nahen Osten und chinesischen Regierungsmitgliedern skizziert.
Bevor er dem nachgehen kann, übernimmt Weaver einen Freundschaftsdienst. In Paris wird Angela Yates, eine ihm gut bekannte Agentin, des Verrats verdächtigt. Weaver glaubt nicht an diese Anschuldigung. Zu seiner Überraschung erfährt er von Yates, dass auch sie gegen den „Tiger“ und seine Hintermänner ermittelt. Kurz darauf ist sie tot – und Weaver muss erkennen, dass sich nicht Burnus-Träger und Diktatoren-Knechte, sondern hochrangige CIA-Angehörige und US-Politiker verschworen haben. Als offenbar wird, dass Weaver im Bilde ist, beginnt eine weltweite Jagd auf den allzu informierten Agenten, der im Kampf um sein Leben noch einmal zur Höchstform aufläuft …
_Das Spiel wird höchstens schmutziger_
Einige Zeit sah es so aus, als habe der Agententhriller sich mit dem Ende der Sowjetunion überlebt. Zu fest schien die Ordnung dieser Welt – hier die USA und ihre Verbündeten, dort die Sowjets und ihre Trabanten – zementiert zu sein, auf deren Fundament auch die Geheimdienste der beiden Supermächte beschäftigungssicher ruhten.
Natürlich war dies ein Trugschluss. Die Welt des 21. Jahrhunderts bietet dem Agententhriller sogar eine noch weit bessere Basis. Als die alten Strukturen in den 1990er Jahren zerfielen, hinterließen sie ein Vakuum, in das neue Kräfte vorstießen. Dahin war damit jegliche Stabilität. Machtverhältnisse wechseln heute oft rasant, weniger denn je wissen die weiterhin aktiven Geheimdienste, wer Freund und wer Feind ist, zumal auch diese Rollen problemlos wechseln können.
Eines blieb ohnehin unverändert: der Wille besagter Geheimdienste, wie bisher hinter den Kulissen zu schalten, wie sie es für notwendig halten. Zwischen der ‚offiziellen‘ Politik – hier ist vor allem die eigene Regierung gemeint – und dem Geheimdienst herrscht traditionell keine Liebe. Gesetze und Regeln sind dem Agentengeschäft hinderlich und werden deshalb ignoriert. Leider wollen nicht alle Politiker, die Justiz und die Medien einsehen, dass hässliche Handlungen notwendig sind, um dem Gegner voran zu bleiben. Deshalb agieren Geheimdienste am liebsten isoliert.
Für die CIA erwies sich der Terroranschlag vom 11. September 2001 als Glücksfall. Bis zu diesem Zeitpunkt sah es düster für den Geheimdienst aus, der vor allem durch Unfähigkeit auffiel und sich harter Kritik und ständigen Budgetkürzungen ausgesetzt sah. Mit dem „patriot act“ entfiel die Notwendigkeit, sich an Gesetze und moralische Regeln zu halten: Die Feinde des „Imperiums“ mussten in Schach gehalten werden!
_Geheimdienst modern: Niemand ist sicher_
Die Phase der Neuorientierung unter Besinnung auf alte Untugenden bildet die Kulisse für die Abenteuer eines sehr modernen Geheimagenten. Milo Weaver, der sich als leicht in die Jahre gekommener und am Schreibtisch etablierter Beamter betrachtet, gerät in den Sog eines Gewerbes, dessen Führungskräfte sich einerseits politisch nach allen Seiten absichern, während sie andererseits ihre Mitarbeiter wie Büromaterial verbrauchen: Neue Kräfte lassen sich problemlos rekrutieren, und die Nackenschläge einer globalisierten Gegenwart treffen nur jene, die sich nicht dagegen wehren können.
Patriotismus ist zu einem gern benutzten aber fadenscheinigen Feigenblatt geworden. Die Tom Graingers, die ihre Agenten zum Wohle der USA opferten, wurden ersetzt durch eine CIA-Generation, die vor allem ihre Pfründen und Privilegien sichert. Sie können sich auf ähnlich moralfreie Politiker und Wirtschaftsmagnaten verlassen, denen die Interessen des eigenen Landes sekundär sind. Jenseits einer Welt mit grenzfixierten Staaten haben längst vage konstruierte, sehr flexibel reaktionsfähige Interessenkonglomerate das Sagen. In einem nächsten Schritt gehen deren Angehörige selbst in die Politik, wobei sie ganz selbstverständlich die kriminellen Methoden zum Einsatz bringen, derer sie sich immer bedienten. Loyalität, Verrat, Zusammenarbeit, Beruf und Privatleben: Die Grenzen haben sich aufgelöst. Jeder belügt und bespitzelt jeden.
_Vom Auge des Sturms direkt in dessen Wirbel_
Das ist die Lektion, die Milo Weaver in diesem ersten Band einer neuen Thriller-Serie im Schnelldurchlauf lernen muss. In der ‚alten‘ CIA hat er seinen Job gelernt, dabei fast sein Leben gelassen und sich den Zeitläuften angepasst – so meinte er, denn tatsächlich ist ihm die Brutalisierung der Agency so lange nicht bewusst geworfen, wie er von ihren Folgen unbehelligt blieb. Stattdessen erfreute er sich der zur Selbstverständlichkeit gewordenen Vorteile. Der Glamour der James-Bond-Filme ist zwar fern, aber Agenten verfügen im Einsatz ein beachtliches Spesenkonto. Sie reisen um die Welt und steigen in feinen Hotels ab. Anders ausgedrückt: Sie sind den Beschränkungen des normalen Arbeitnehmers enthoben. Dieser Aspekt ist es, auf den Weaver nicht verzichten möchte.
Dennoch hat er sich seine als allein agierenden „Tourist“ erworbene Unabhängigkeit bewahrt. Weaver ist kein Soldat, der sich verheizen ließe. Als er es notwendig findet, bietet er dem Apparat die Stirn. Das ist sicherlich kein innovatives Spannungskonzept, aber es funktioniert, weil Olen Steinhauer die Grundprinzipien beachtet: Auf der einen Seite steht der übermächtige Gegner, der als solcher geschickt aufgebaut wurde, auf der anderen das einsame, verloren scheinende Individuum, das dennoch den Kampf aufnimmt. Selten bestimmt offene Gewalt das Geschehen, sondern ein Spiel der Tricks und Täuschungen. Weaver ist schlau – so schlau, dass er sich schließlich in die Höhle des Löwen wagt und darin umzukommen scheint.
Welches Spiel treibt Weaver? Steinhauer lässt uns im Dunkeln tappen. Milo ist Opfer und Täter; die Rolle wechselt rasend schnell und mehrfach. Vor allem in der zweiten Hälfte löst sich Steinhauer zeitweise von seiner Figur, deren Beweggründe dadurch verschwommen bleiben. Die daraus resultierende Unsicherheit schürt die Spannung, zumal der Autor das Heft fest in der Hand hält und seine Leser geschickt an den Nasen herumführt. Dass der Faktor Zufall zusätzlich mitspielt, lässt die Ratlosigkeit noch wachsen.
_Startschuss ohne Schalldämpfer_
Im Finale von „Der Tourist“ hat Weaver gleichzeitig gewonnen und alles verloren. Damit wird er zur idealen Figur für eine Serie, die ihn in weitere Agenten-Intrigen verwickeln wird. (Hoffentlich) wohldosierte Einschübe eines desolaten Privatlebens werden ihr jene Tiefe verleihen, die Literaturkritiker und seifenopergestählte Leser/innen neben temporeicher Action gleichermaßen verlangen. Im Verlauf dieses Debüt-Abenteurers hat sich Steinhauer trotz der rasanten Handlung die Zeit genommen, entsprechende Bolzen einzuschlagen, an denen sich solche Verwicklungen verankern lassen. Weavers Gattin ist kein Anhängsel, das von Zeit zu Zeit gerettet werden muss, sondern recht selbstbewusst. Darüber hinaus deutet Steinhauer an, dass die gute Tina nicht zufällig dort war, wo Milo sie unter turbulenten Umständen kennenlernte. Die Erwartungen sind hoch, wenn es mit „The Nearest Exit“ weitergeht!
_Der Autor_
Olen Steinhauer (geb. am 21. Juli 1970) wuchs im US-Staat Virginia auf. Er studierte Englisch an der University of Texas in Austin sowie am Emerson College in Boston. Im Rahmen eines Fulbright Forschungsstipendium konnte er 1999 für ein Jahr nach Rumänien reisen.
Die in dieser Zeit recherchierten Fakten und die im Ausland gemachten Erfahrungen flossen in Steinhauers schriftstellerische Arbeit ein. „The Bridge of Sighs“ wurde der Auftakt einer Serie von Thrillern, die vor der Kulisse eines fiktiven (und namenlos bleibenden) osteuropäischen Landes die Geschichte des Kalten Krieges in den Jahren 1948 bis 1989 rekonstruiert. Die fünf zwischen 2003 und 2007 erscheinenden Bände dieser Serie wurden für zahlreiche Preise nominiert und mehrfach ausgezeichnet.
2009 veröffentlichte Steinhauer den ersten Band einer Trilogie von Spionage-Thrillern, in deren Mittelpunkt der von den Zeitläuften gebeutelte Geheimdienst-Agent Milo Weaver steht. „Der Tourist“ wurde nicht nur im US-amerikanischen Sprachraum ein Bestseller, sondern markierte auch Steinhauers internationalen Durchbruch; der Roman erschien in 20 Sprachen. Auch Hollywood wurde aufmerksam; das Studio Warner Brothers erwarb die Filmrechte an „Der Tourist“, und für die Titelrolle wurde George Clooney engagiert.
Mit seiner Familie lebt Olen Steinhauer in Budapest. Er ist nicht nur als Schriftsteller tätig; so übernahm er für das Wintersemester 2009/10 eine Gastprofessur für Literatur am Institut für Amerikanistik der Universität Leipzig.
Über seine Arbeit informiert Olen Steinhauer auf seiner Website: http://www.olensteinhauer.com.
_Impressum_
Originaltitel: The Tourist (New York : St. Martin’s Minotaur 2009)
Deutsche Erstausgabe (geb.): Januar 2010 (Wilhelm Heyne Verlag)
Übersetzung: Friedrich Mader
543 Seiten
EUR 19,95
ISBN-13: 978-3-453-26610-0
http://www.heyne.de
Olsen, Gregg – Cruel – Eiskaltes Grauen
_Das geschieht:_
Seit zwanzig Jahren versucht Hannah Griffin das grausame Ende ihrer Kindheit zu vergessen. Auf einer Farm im US-Staat Oregon wuchsen sie und ihre Zwillingsbrüder bei einer psychopathischen Mutter auf, die schließlich in einer kalten Winternacht ihren Kindern das Dach über dem Kopf anzündete. Während die Brüder sowie ihre Mutter im Feuer umkamen, konnte Hannah entkommen. Bei einer Besichtigung der Brandstätte stieß die Polizei auf ein Grab. Es blieb nicht das einzige, und immer lag die Leiche eines in Uniform gekleideten, älteren Mannes darin: Claire Logan hatte als Massenmörderin genaue Vorstellungen von ihrem Opfer.
Schon damals waren sowohl Hannah als auch Jeff Bauer, der als FBI-Beamter den Fall bearbeitete, davon überzeugt, dass die in der Ruine des Farmhauses gefundene Frauenleiche nicht die von Claire Logan war. Sie ist entkommen und verfolgt als vage Schreckgestalt ihre Tochter, die sich nie von den halb verdrängten Erinnerungen an Gräueltaten lösen konnte, deren Zeugin sie als Kind wurde.
Inzwischen ist Hannah verheiratet und selbst Mutter einer achtjährigen Tochter. Sie arbeitet als Ermittlerin für das Bezirksgericht des Santa Louisa County nahe Los Angeles in Kalifornien. Der zwanzigste Jahrestag des Brandes naht, als Hannah anonym ein Paket mit den angesengten Kinderschuhen ihrer Brüder zugeschickt wird. Töchterlein Amber berichtet von einer unbekannten Frau, die Grüße von der Großmutter ausgerichtet hat.
Ist Claire zurückgekehrt, will sie vollenden, was ihr einst nicht gelang? Zusammen mit Agent Bauer kehrt Hannah nach Oregon zurück. Die Odyssee führt zu einem drastisch veränderten Bild der damaligen Ereignisse, und das beschwört Gefahren herauf, mit denen weder Hannah noch Bauer rechnen konnten …
_Viele Leichen, wenig Gewalt_
Sogar der Unterhaltungs-Thriller der B-Kategorie hält sich mit Frauen in der Serienkiller-Rolle zurück; diese unschöne Variante des Kapitalverbrechens scheint auch im Zeitalter der Emanzipation buchstäblich in männlichen Händen zu liegen. Andererseits gibt es mordende Frauen. Gregg Olsen, Autor zahlreicher „True Crime“-Bücher, hat sogar mit einigen gesprochen, denn die Dynamik zwischen Müttern und Töchtern, die entweder kriminell oder das Opfer krimineller Aktivitäten wurden, ist so etwas wie seine Spezialität. (Mit der Figur der Autorin Marcella Hoffman hat Olsen – Kritikern lieber selbst den Wind aus den Segeln nehmend – seiner Zunft ein selbstironisches Denkmal gesetzt, das sämtliche Unarten des „True Crime“-Genres verkörpert.)
Auch sonst versteht er sichtlich etwas von der Materie. Sein Hintergrundwissen ist breit gefächert und deckt nicht nur die polizeiliche Ermittlungsarbeit ab, sondern widmet sich ebenso intensiv dem menschlichen Drama, das ein Verbrechen des hier beschriebenen Kalibers auslöst, von dem nicht nur die Mordopfer, sondern auch deren Familien und Freunde sowie – das wird oft vergessen – die Angehörigen des Täters betroffen werden.
Die Gewaltorgien der Mörder-Lady breitet Olsen nicht so liebevoll vor seinen Lesern aus, wie es im Killer-Thriller 2.0 viel zu üblich geworden ist. Er ‚beschränkt‘ sich auf die Schilderung der Folgen, die sich aus den Untaten ergeben. Dieses Verb steht hier in Anführungsstrichen, weil sich Olsen zumindest in dieser Hinsicht keine Zügel anlegt. Die Exhumierung einer seit Jahren unter der Erde gelegenen Säuglingsleiche ist auch ohne Blut und Schreie reichlich starker Tobak (sowie für das eigentliche Geschehen völlig unerheblich).
_Viel Dramatik, wenig Spannung_
Was Olsen nicht gelingt, ist die Verknüpfung von Information und Handlung. Schon die Erzählstruktur wirkt unnötig sperrig: Die Geschichte startet, dann springt sie weit in die Vergangenheit zurück und unterbricht den ersten Spannungsbogen, der mühsam neu aufgerichtet werden muss, während wir uns dem Ausgangspunkt – der Gegenwart – allmählich wieder nähern. Auch sonst verwechselt Olsen beim Spannungsaufbau oft Cliffhanger und Abrisskante oder zerdehnt und verkompliziert Abläufe, die von den eigentlichen Ereignissen wegführen.
Das Schüren von Spannung wird durch Handlungsroutinen erschwert, die jeder halbwegs eifrige Genre-Leser im Geiste abhaken kann: Zwischen dem FBI, der örtlichen Polizei und der Justiz gibt es Kompetenzrangeleien, die Presse hechelt rücksichtsfrei allen Betroffenen hinterher, und natürlich haben die Hauptfiguren auch ein Privatleben, das ausführlich vor den Lesern ausgebreitet wird, ob diese das wünschen oder nicht.
Eher nicht, wenn sich der Autor mit der Reihung von Klischees begnügt. Vor allem Hannah ist eine Art Schwarzes Loch, das Pech und Kummer erbarmungslos in seinen Ereignishorizont reißt. Ihre Jugend als Tochter einer psychopathischen Mutter äußert sich in ständigen Albträumen und Visionen, die Fetzen der verkorksten und im Wachzustand verdrängten Vergangenheit hochkommen lassen – kein Konzept, das Überraschungen bietet.
Um die Schrecken des Gestern möglichst drastisch mit dem Heute kontrastieren zu lassen, stellt Olsen der trotz aller Schicksalsschläge beruflich idealistisch und privat herzensgut gebliebenen (und selbstverständlich bildhübschen) Hannah eine Bilderbuch-Familie mit frauenverstehendem Gatten und offensiv niedlichen Töchterchen zur Seite, das Olsen freilich – es spricht für ihn – nicht als Spannungsreserve für das Finale dient.
_Wie im richtigen Leben_
Ohnehin nimmt das Geschehen im letzten Drittel einen völlig unerwarteten Verlauf. Was zunächst positiv klingt, relativiert angesichts der Tatsache, dass Olsen diesen Umschwung quasi aus dem Nichts heraufbeschwört. Die bis zu diesem Zeitpunkt eingefädelten Rätsel werden zwar sämtlich aufgelöst, doch wenn dies geschieht, haben sie sich längst selbst erledigt. (Was wohl auch besser ist, da sich Logik und Originalität dabei nur am fernen Horizont zeigen.)
Der abrupte Bruch erfolgt zeitgleich mit einem gewaltigen geografischen Sprung: Plötzlich finden wir sämtliche Hauptfiguren auf der pazifischen Kodiak-Insel vor der Südküste von Alaska. Was sie dorthin verschlägt, ist ein recht dreister Winkelzug des Verfassers, denn wiederum hat der Leser keine Chance, diesen Wechsel nachzuvollziehen. Die Erkenntnis, dass sich die böse Claire in Polarnähe versteckt, reizt das Prinzip Zufall nicht nur, sondern beult seine Grenzen bedenklich aus.
Schade eigentlich, denn Olsen, der das „true crime“ wie gesagt kennt, konstruiert kein Bilderbuch-Happyend mit dramatischem Todeskampf zwischen Tochter und Mutter, während die Familie hilflos, weil von Oma bzw. Schwiegermutter gefesselt, zuschauen und abwarten muss und der FBI-Held anderweitig beschäftigt ist. Nicht jeder Übeltäter wird erwischt. Diese Entscheidung gefällt und versöhnt – es sei denn, sie bereitet eine Fortsetzung vor …
Den dummen Schlusspunkt setzt abermals die deutsche Ausgabe, die dem Werk den denglischen Nullsinn-Titel „Cruel“ zwischen die Hörner nagelt.
_Der Autor_
Gregg Olsen wurde am 5. März 1959 in Seattle, US-Staat Washington, geboren. Bevor er 2007 mit „A Wicked Snow“ (dt. „Cruel – Eiskaltes Grauen“) sein Thriller-Debüt gab, hatte er sich bereits einen Namen als Autor von sieben „True Crime“-Büchern gemacht, in denen sich genretypisch sachliche Aufklärung und behutsam die Fakten ‚bearbeitende‘ Dramatisierung mischten – eine Struktur, die auch Olsens Kriminalromanen zugrunde liegt.
Als ‚Fachmann‘ für Kapitalverbrechen ist Olsen ein gern und oft gesehener Gast in TV- und Radiosendungen. Darüber hinaus schreibt er Artikel für Zeitungen und Zeitschriften. Während er über seine Aktivitäten als Autor sehr ausführlich und werbewirksam Auskunft gibt, gibt Olsen auf seiner [Website]http://www.greggolsen.com über sein Privatleben nur noch bekannt, dass er mit seiner Familie in Olalla (US-Staat Washington) lebt.
_Impressum_
Originaltitel: A Wicked Snow (New York : Pinnacle/Kensington Publishing Corporation 2007)
Übersetzung: Anja Schünemann
Deutsche Erstausgabe: November 2007 (Rowohlt Verlag/RoRoRo Nr. 24614)
316 Seiten
EUR 8,95
ISBN-13: 978-3499246142
http://www.rowohlt.de
Bergman, Andrew – LeVine & Humphrey Bogart
_Das geschieht:_
Der II. Weltkrieg ist vorüber, aber die Geschäfte gehen für Jack LeVine, Privatdetektiv in New York, 1947 schlechter denn je. Da trifft es sich gut, dass ein alter Freund und Studienkollege ihn anheuern möchte. Walter Adrian lebt und arbeitet eigentlich in Hollywood, wo er es als Drehbuchautor zu Ruhm und Geld gebracht hat. Aber etwas Unheimliches geht seit einiger Zeit hinter den Kulissen der großen Studios vor. Adrian wird geschnitten, seine Karriere ist beschädigt. Gründe werden nicht genannt, aber der Autor ahnt etwas: Er hat sich stets öffentlich gegen Armut und Korruption sowie für mehr Gleichheit ausgesprochen und sogar mit dem Sozialismus geliebäugelt.
Das taten nicht nur in Hollywood viele Männer und Frauen. Die USA und die Sowjetunion waren im Krieg Verbündete. Aber seit Stalin als ernsthafter Konkurrent in der Weltpolitik auftritt, gilt die UdSSR als Reich des Bösen. Nun planen rechte Kreise den großen Schlag und wollen unter dem Vorwand des Kampfes gegen die ‚roten‘ Elemente ihres Heimatlandes auch unliebsame Konkurrenten im Kampf um Macht und Geld kaltstellen. In dem jungen, krankhaft ehrgeizigen und skrupellosen Kongressmann Richard M. Nixon finden sie den idealen Inquisitor für ihren verbrecherischen Plan.
Ein „Komitee gegen unamerikanische Umtriebe“ wird geplant und Walter Adrian steht auf dessen Liste. LeVine kommt zu spät nach Hollywood: In der Westernstadt der Warner-Studios findet er den Freund an einem Wildwest-Galgen baumelnd. Selbstmord, verkündet die Polizei, die als Instrument des „Komitees“ agiert. Mord, weiß LeVine, der Gerechtigkeit fordert, wie es seine Art ist. Das bringt ihn in Lebensgefahr, denn dieses Mal legt er sich mit Gegnern an, die das Gesetz auf ihrer Seite haben und sich nicht scheuen, es zwecks Einschüchterung und Mord zu beugen. Aber es gibt auch Verbündete, sodass sich LeVine während einer rasanten Verfolgungsjagd an der Seite des Filmstars Humphrey Bogart findet …
_Ein ganz düsteres Kapitel_
Politische Brisanz, realistische Gesellschaftskritik & Unterhaltung mit Köpfchen, dargeboten als stimmige, spannende, nachdenklich machende Mischung: Wir lesen offenkundig einen US-amerikanischen Kriminalroman aus den 1970er Jahren, als diese Elemente einander nicht ausschlossen, sondern fast vollendet harmonierten. „New Hollywood“ nannte man dieses Phänomen in der Filmstadt, die in einer kaum zehn Jahre währenden Glanzphase Meisterwerke wie „Bonnie & Clyde“ (1967), „French Connection“ (1971), „Chinatown“ (1974) oder „Taxi Driver“ (1976) zustande brachte.
„LeVine & Humphrey Bogart“ ist ein Werk, das sich romanhaft mit einem düsteren Kapitel der modernen US-amerikanischen Geschichte beschäftigt: den Hexenjagden des Senators McCarthy und seines „House Committee on Unamerican Activities“ (HUAC), vor das in den 1950er Jahren gezielt prominente Schauspieler, Autoren, Sänger und andere Künstler geladen wurden, wo sie sich zu möglicherweise ungesetzlichen Aktivitäten äußern mussten. Befand sie dieses Tribunal – das selbstverständlich selbst definierte, was „unamerikanisch“ bedeutete – ‚kommunistischer Umtriebe‘ für schuldig, wurden sie bestraft und fanden sich vor allem auf einer Schwarzen Liste. Das bedeutete praktisch Berufsverbot, denn die großen Filmstudios in Hollywood, aber auch Radiostationen, Theater und sogar Nachtclubs im ganzen Land schlugen sich, um ihre Pfründen bangend, auf die Seite der Hexenjäger.
Unschuldige Männer und Frauen standen vor dem Nichts, gerieten in Not, begingen verzweifelt Selbstmord. ‚Verräter‘, die vor dem HUAC-Druck kapitulierten und ‚Genossen‘ denunzierten, entgingen dem Ruin, aber sie wurden von Kollegen und Freunden geächtet. Wer sich dem Terror widersetzte oder ihn anprangerte, geriet sofort selbst in die HUAC-Mühlen: Das ist die totalitäre Welt, deren Entstehung LeVine in erster Reihe miterleben darf.
_Spannung und Brisanz_
Andrew Bergmann nennt die Dinge beim Namen. Das ist längst nicht so selbstverständlich, wie es uns heute vorkommt, denn 1975 waren prominente Befürworter der Hexenjagd noch am Leben oder nahmen sogar bedeutende Ämter ein. Bisher hatten sie sich ihrer historischen Verantwortung entziehen können. „LeVine & Humphrey Bogart“ markiert den Zeitpunkt, an dem sich dies änderte.
Dieser Roman demonstriert weiterhin, dass sich Anspruch und Unterhaltung in der Tat keineswegs ausschließen müssen. War „The Big Kiss-off of 1944“ (1974, dt. „LeVine“), die erste LeVine-Geschichte, bei aller ebenfalls geäußerten Kritik an Korruption und Hurrapatriotismus vor allem eine glänzende Rekonstruktion der unmittelbaren Nachkriegszeit als Detektivstory, ist Bergman mit „LeVine & Humphrey Bogart“ eindeutig ehrgeiziger.
Düster wird der Weg in den McCarthy-Terror geschildert. Für Bergman ist bereits seine Entstehung ein Verbrechen, das vor allem deshalb inszeniert wurde, um die politischen Gegner der amerikanischen Rechten aus dem Weg zu räumen. Folglich treten deren Repräsentanten wie Gangster heimlich, bedrohlich, verschwörerisch in abbruchreifen Häusern und an anderen wenig Vertrauen erweckenden Orten auf, wird ihr Wirken als Komplott gegen Gesetz und Moral identifiziert.
Den Fall wird LeVine vielleicht lösen, aber der Gerechtigkeit wird er nicht zum Sieg verhelfen können. Beklemmend zeigt uns Bergman die Mechanismen, die dem HUAC seinen Weg ebnen. Es gibt für jene, die sich ihm in den Weg stellen, keine Warnung, keinen Schutz. So verbietet sich das obligatorische Happyend; die Drahtzieher werden ihr übles Spiel fortsetzen, und LeVine weiß dies auch.
_Detektiv am Scheideweg_
Jack LeVine ist immer noch ganz genretypisch der desillusionierte, aber insgeheim idealistische und grundehrliche Privatdetektiv alter Schule. Seine aktuellen Erlebnisse sind die ideale Voraussetzung dafür zum Zyniker zu werden, denn diese Dimension des legalisierten Verbrechens sind ihm bisher nicht bekannt gewesen.
Zudem bewegt sich LeVine abseits seines Territoriums. New York kennt er, Los Angeles nicht. Das scheinbar so auf sich selbst konzentrierte, um das Filmbusiness kreisende, die Medienpräsenz beschwörende Universum von Hollywood ist tatsächlich vielschichtiger als gedacht. Auch im oberflächlichen Tinseltown leben Menschen mit politischem Idealismus – oder Ambitionen.
Machtkämpfe ganz eigener Art toben hier, in die sich LeVine vorsichtig aber unverdrossen stürzt. Normalerweise würde er gut damit fahren: Das Verbrechen ruht quasi überall auf der Welt auf gewissen Grundkonstanten, die ein erfahrener Kriminalist zu deuten weiß. Doch hier stößt LeVine an seine Grenzen. Seine unsichtbaren, schwer oder gar nicht fassbaren Gegner werden personifiziert durch den Kongressmann Richard Nixon. Das ist keine fiktive Gestalt, wie wir (hoffentlich) wissen, sondern ein historischer Prominenter ganz besonderen Kalibers: ein Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der von seinen Bürgern aus dem Amt gejagt wurde, weil er seine Gegner bespitzeln (und sich erwischen) ließ – und das war nur eines von zahlreichen Vergehen.
_Realer Schurke im Krimi-Einsatz_
Als Bergman „LeVine und Humphrey Bogart“ 1975 schrieb, war Watergate noch eine sehr aktuelle Affäre. Nixon hatte gewiss andere Sorgen, als gegen sein Porträt als skrupelloser Aufsteiger, der um jeden Preis nach oben will, zu protestieren. Zu diesem Zeitpunkt symbolisierte er den moralischen Bankrott der politischen Rechten. Wieso dies so ist, so kommen musste, versucht Bergman auf seine Weise zu illustrieren. Der junge Nixon ist bei ihm kein simpler Nachwuchsstrolch, sondern wirkt eher schizophren als ehrgeiziger Eiferer, der selbst an die hohlen Phrasen zu glauben scheint, die er in endlosen Serien hervorstößt. Bergman gelingt ein erschreckend überzeugendes Bildnis.
Ebenso eindringlich ist seine Darstellung der Opfer. Nicht Solidarität bestimmt die Situation. Statt sich zusammenzutun, versuchen die ins Visier der Inquisitoren geratenen Filmleute vor allem, die eigene Haut zu retten – und sei es auf Kosten der Leidensgenossen. Das macht es ihren Gegnern doppelt leicht. Indem sie die eingeschüchterten Männer und Frau gegeneinander ausspielen, können sie im Hintergrund bleiben und die besorgten Moralisten mimen. Indem sie sich wie Vieh treiben lassen, fügen sich die Verfolgten selbst einander die schlimmsten Wunden zu: Sie verraten einander und werden das niemals vergessen oder vergeben.
Dies alles breitet Andrew Bergman auf nur 220 Seiten und dadurch ebenso dicht wie intensiv aus. Hier ist kein Raum für jenes ablenkende Geschwätz, das heute zu viele Kriminalromane in ziegelsteindicke Seifenopern verwandelt. Bergman bleibt gnadenlos auf dem Punkt und nimmt seine Leser auf eine nur allzu reale Höllenfahrt in die Vergangenheit mit.
_Der Autor_
Andrew Bergman wurde 1945 in New York City geboren. Eine Berufslaufbahn in den Medien wurde ihm quasi in die Wiege gelegt; sein Vater arbeitete als Redakteur für die |New York Daily News|. Bergman absolvierte das Harper College und studierte an der University of Wisconsin-Madison.
1971 trat Bergman mit „We’re in the Money“ hervor, einer historisch-soziologischen Studie über den von der Wirtschaftskrise und New Deal geprägten US-Film der 1930er Jahre. Kurz darauf verfasste er in rascher Folge die beiden Kriminalromane „The Big Kiss-off of 1944“ (1974) und „Hollywood & LeVine“ (1975) um den Privatschnüffler Jack LeVine.
Dann ging Bergman selbst nach Hollywood. Mehr als ein Vierteljahrhundert arbeitete er als Drehbuchautor und Regisseur. Geschrieben und/oder inszeniert wurden von ihm Filme wie „Soapdish“ (1991; dt. „Lieblingsfeinde – eine Seifenoper“), „The Freshman“ (1990), „Fletch“ (1984; dt. „Fletch – Der Troublemaker“), „Striptease“ (1996) oder „Honeymoon in Vegas“ (1992).
2001 kehrte Bergman zur Überraschung von Publikum und Kritik zur Figur des LeVine zurück und schrieb ihm mit „Tender Is LeVine“ ein neues Abenteuer auf den Leib: Das „Striptease“-Filmdesaster von 1996 hatte ihm einen Karriereknick und viel Freizeit beschert. Erst 2003 kehrte Bergman mit „The In-Laws“ (dt. „Ein ungleiches Paar“ – nur Drehbuch) nach Hollywood zurück.
Die LeVine-Romane von Andrew Bergman:
(1974) LeVine („The Big Kiss-off of 1944“)
(1975) LeVine & Humphrey Bogart („Hollywood & LeVine“) – Ullstein Krimi Nr. 10334
(2001) „Tender Is LeVine“ (2001; kein dt. Titel)
_Impressum_
Originaltitel: Hollywood & LeVine (New York : Holt, Rinehart & Winston 1975)
Deutsche Erstausgabe: 1985 (Ullstein Verlag/Ullstein Krimi Nr. 10334)
Übersetzung: Jürgen Bürger
221 Seiten
ISBN-13: 978-3-548-10334-1
http://www.ullstein-buchverlage.de
Charles Finch – September Society. Der Club der tödlichen Gentlemen
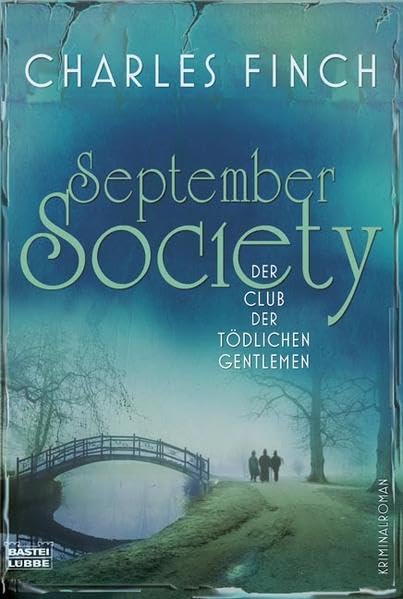
Charles Finch – September Society. Der Club der tödlichen Gentlemen weiterlesen
Dillard, J. M. – Star Trek – Next Generation: Widerstand
_Das geschieht:_
Endlich ist die |Enterprise|, das Flaggschiff der Föderation, nach langwieriger Reparatur der Schäden, die es im Kampf gegen den Usurpatoren Shinzon davongetragen hat, wieder startbereit. Auch die neue Besatzung ist vollständig. Die erste Reise ist eine Friedensmission und gilt als Routine-Unternehmen.
Captain Jean-Luc Picard kämpft mit dem Fortgang der meisten Senior-Offiziere, die gleichzeitig seine Freunde waren. Data ist tot, und gerade hat sich ein offenkundig seelisch angeschlagener Worf geweigert, die Position des 1. Offiziers zu übernehmen, die Picard ihm angetragen hatte. Gern würde der enttäuschte Captain den verschlossenen Klingonen vom Counselor aushorchen lassen, doch auch Deanna Troy hat die |Enterprise| verlassen. Die Vulkanierin T’Lana soll sie ersetzen – und sie lehnt Worf mit unvulkanischer Deutlichkeit ab.
Sein größtes Problem hält Picard sorgfältig geheim: Seit einiger Zeit plagen ihn Albträume oder Visionen, in denen die Borg ihn, der einst als „Locutus“ in ihr Kollektiv assimiliert war, zu kontaktieren versuchen. Spätestens seit ihnen Captain (jetzt Admiral) Janeway im Delta-Quadranten eine vernichtende Niederlage bereiten und ihre Königin töten konnte, gelten die Borg als zerstreut und gefahrlos. Offensichtlich konnten sie sich neu konsolidieren, und nun richtet sich ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Alpha-Quadranten.
Mit seinem Verdacht steht Picard allein. Trotzdem bricht er die Friedensmission eigenmächtig ab und fliegt dorthin, wo tatsächlich die Borg nicht nur an einem gewaltigen Kubus arbeiten, sondern auch eine neue Königin heranzüchten, um anschließend rachedurstig über die Erde herzufallen …
_“Next Generation“ 3.0_
Schon wieder die Borg und ihre auf Captain Picard zwangsfixierte S/M-Queen? Was nach dem Willen des „Star Trek“-Franchises für Freude, Spannung und gesteigerte Kauflust bei den Trekkies sorgen soll, lässt den nicht am Nasenring vom „ST“-Marketing geführten Leser die Stirn runzeln. Leider nicht zu Unrecht. Aus dem großen „Nemesis“-Knall, der es 2002 implodieren und beinahe enden ließ, hat das Franchise offenbar nicht wirklich seine Lehren gezogen. Im Film gelang inzwischen der Neustart, aber dort wurde ein radikaler Schnitt gewagt, der auf dem Buchmarkt ausblieb. Hier sollen diejenigen Trekkies aufgefangen werden, denen J. J. Abrams mit dem „Star Trek“-Spielfilm von 2009 zu weit ging.
Dabei wurde der Relaunch der „Next Generation“ generalstabsmäßig geplant. Dem gescheiterten „Nemesis“-Film folgte keine eigenständigen und separaten Abenteuer. Stattdessen erhielt die „NG“ eine achte Serienstaffel. Das hatte mit „Deep Space Nine“ gut funktioniert und wurde deshalb wiederholt. Ab 2005 entstand eine Folge von „NG“-Romanen, die sich zwar unabhängig voneinander lesen lassen, aber inhaltlich einem roten Faden folgen.
_Gemächlich statt abenteuerlich_
Das Konzept wirkt narrensicher: Anders als in Kino oder Fernsehen können Romanautoren problemlos auf Figuren zurückgreifen, deren Auftritte als Schauspieler viel zu teuer kämen. Da die Trekkies ihre bekannten Figuren lieben, wimmelt die neue „NG“-‚Serie‘ förmlich von ihnen. Die Autoren mussten sich nicht auf das „NG“-Universum beschränken. Crossover mit den anderen „ST“-Serien sind deshalb an der Tagesordnung. In „Widerstand“ bleibt es noch beim Namedropping – Data-Surrogat B-4 hat einen Gastauftritt, Admiral Janeway meldet sich über Funk und kündigt Seven of Nine an, selbst Katze Spot schleicht durch die Gänge -, aber das wird sich mit dem Fortschreiten der übergreifenden Handlung ändern.
Kühl kalkuliert strich das Franchise diverse „NG“-Hauptfiguren, um mit ihnen weitere Buchserien zu bevölkern; das Verfahren ähnelt der Anlage einer Pflanzung durch Ableger. So durchstreifen William Riker und Deanna Troy das All nunmehr an Bord der |Titan|; entsprechende Romane lassen sich käuflich erwerben.
Die Lücken werden mit neuen Figuren gefüllt. Sie sind jünger und müssen das aufwendige Procedere des Einlebens an Bord hinter sich bringen. Wieder einmal soll eine vulkanische Schönheit in allerlei emotionalen Verwicklungen keimfreie „ST“-Erotik generieren – geschenkt! Für weitere Seifenoper-Elemente sorgen private Traumata, die der Handlung in möglichst hohen Dosen beigemischt werden. Das drosselt das Tempo und zieht das Geschehen in die Länge. Außerdem liebt es ein nicht geringer Teil des „ST“-Publikums, wenn seine Lieblinge im Netz zwischenmenschlicher Probleme zappeln; das gibt der Zukunft angeblich ein ‚menschliches‘ Gesicht und schafft Freiräume, in die emotional eher auf den Traum als auf die Tat setzende Leser/innen eigene Sehnsüchte & Sorgen projizieren können.
_Die Furcht vor dem Neuen_
Sind schon diese schaumigen Einlagen viel zu bekannt, kann auch der eigentliche Plot nicht begeistern. Richtig gute Bösewichte glänzen im „ST“-Universum schon lange durch Abwesenheit. Deshalb werden die alten Schurken wieder und wieder hervorgekramt. Die Borg waren einst ein guter Einfall. In einem Nachwort erzählt Julian Wangler ihre „ST“-Geschichte. Schon dabei wird freilich deutlich, wie das Franchise seit jeher von der Angst vor der eigenen Courage gebremst wird: Ursprünglich war das Borg-Konzept deutlich radikaler. Es wurde durch die Schöpfung der Borg-Queen verwässert. Aus gleichgeschalteten, geschlechtsneutralen, emotionsfreien und erschreckend fremdartigen Geschöpfen wurden die Drohnen einer diktatorischen, macht- und menschenmännergeilen Königin.
Auf diese Weise sollten die Borg dem Massengeschmack angeglichen werden. Tatsächlich verloren sie ihre eiskalte Bedrohlichkeit. Mit „Widerstand“ geht J. M. Dillard im Auftrag des Franchises einen Schritt weiter: Die von Picard und Janeway zweifach gekillte Borg-Queen reinkarniert und wirft sämtliche Assimilierungs-Gewohnheiten über den Haufen. Stattdessen steht Rache auf dem Programm: Die Borg tanzen nach der Pfeife einer Königin, die nur noch Menschen morden und vernichten will. Was der Bedrohung auf eine neue Ebene hieven soll, gibt den Borg den Rest: Sie degenerieren zu Allerwelts-Finsterlingen.
Dazu passt eine ebenfalls wiedergekäute |Enterprise|-Handlung. Picard wird wieder Locutus, seine Gefährten ringen geschockt die Hände, die Queen benimmt sich wie eine betrogene Geliebte. Das kennen wir, und der Aufguss ist keineswegs stärker. Klischee reiht sich an Klischee. Nur Dillards intime Kenntnis der „NG“-Historie rettet die lahme Geschichte über die volle Distanz: Nein, auch im zweiten Band ihrer neuen Abenteuer nimmt die „NG“-|Enterprise| nicht wirklich Fahrt auf! Darüber trösten auch die gute Übersetzung der deutschen Ausgabe und die ungewöhnliche Cover-Gestaltung nicht hinweg.
_Die Autorin_
J. M. Dillard ist das Pseudonym der Schriftstellerin Jeanne Kalogridis, die am 17. Dezember 1954 im US-Staat Florida geboren wurde. An der University of South Florida studierte sie Mikrobiologie und Russische Literatur. Ab 1976 arbeitete sie zwei Jahre als Sekretärin, bevor sie für ein Studium der Sprachwissenschaft an die Universität zurückkehrte. Anschließend ging Kalegridis nach Washington und lehrte acht Jahre Englisch an der American University.
Sie gab ihre Stellung auf, nachdem ihre parallel verfolgte Laufbahn als Schriftstellerin so gut Fahrt aufgenommen hatte, dass Kalegridis freie Autorin werden konnte. Zunächst verdingte sie sich als „J. M. Dillard“ in den Minen der „tie-in“-Industrie und produzierte Romane zu Filmen und Fernseh-Serien. Dabei spezialisierte sie sich auf das „Star Trek“-Universum. Für das Franchise schrieb sie nicht nur für sämtliche Serien, sondern verfasste auch die Romane zu den Kinofilmen „Star Trek“ V bis X. Ihre Beiträge beschränken sich nicht auf die genaue Kenntnis der „Star Trek“-‚Fakten‘ und schriftstellerische Routine. Deshalb gehören Dillard-Romane zu den lesenswerteren Franchise-Buchprodukten.
Unter ihrem Geburtsnamen veröffentlichte Kalogridis zwischen 1994 und 1996 eine Chronik der Familie Dracul, die lose auf Bram Stokers Horror-Klassiker „Dracula“ basiert. Ebenfalls unter ihrem richtigen Namen schrieb Kalegridis ab 2001 Historienromane. Sie verbinden Fakten mit Schmalz und sind sehr umfangreich, sodass sie eine große, vorwiegend weibliche Leserschaft finden.
_Impressum_
Originaltitel: Resistance (New York : Pocket Books 2007)
Dt. Erstausgabe: November 2009 (Cross-Cult Verlag/Star Trek – The Next Generation 2)
Übersetzung: Bernd Perplies
Cover: Tom Hallman
277 Seiten
EUR 12,80
ISBN-13: 978-3-941248-62-5
http://www.cross-cult.de
_Mehr |Star Trek| auf |Buchwurm.info|:_
[„40 Jahre STAR TREK – Dies sind die Abenteuer …“ 3025
[„Jenseits von Star Trek“ 1643
[„Star Trek – Next Generation: Tod im Winter“ 6051
[„Star Trek – Titan 1: Eine neue Ära“ 5483
[„Star Trek – Vanguard 1: Der Vorbote“ 4867
[„Star Trek Voyager: Endspiel“ 4441
[„Star Trek Deep Space Nine: Neuer Ärger mit den Tribbles“ 4171
[„Star Trek V – Am Rande des Universums“ 1169
[„Star Trek Voyager – Das offizielle Logbuch“ 826
[„Sternendämmerung“ 673
[„Sternennacht“ 688
http://www.startrekromane.de