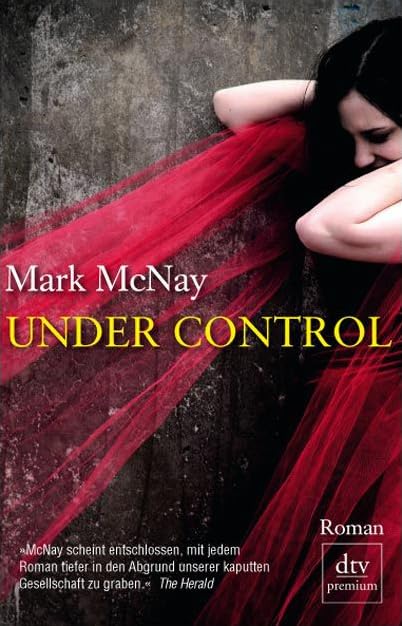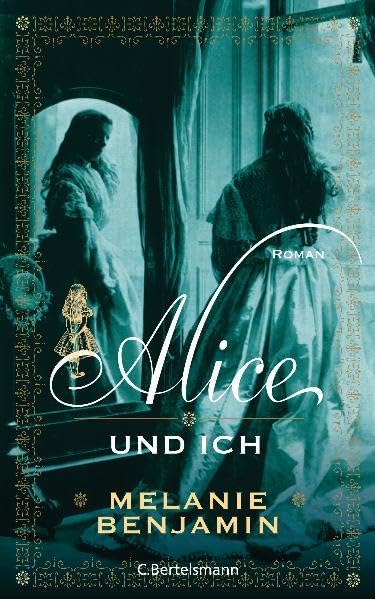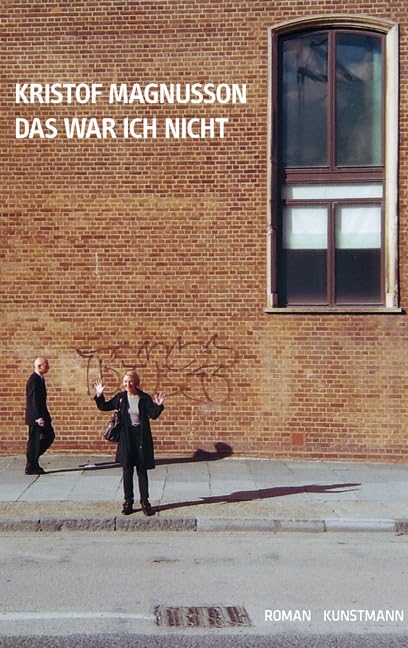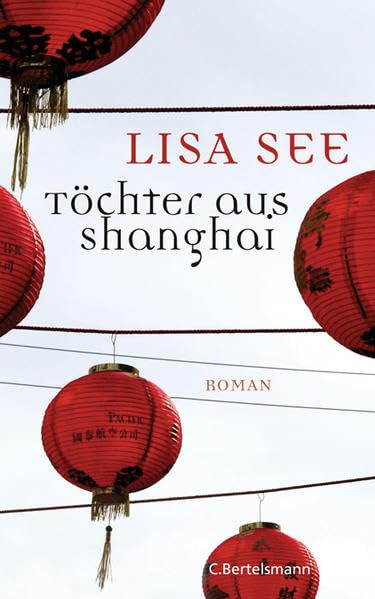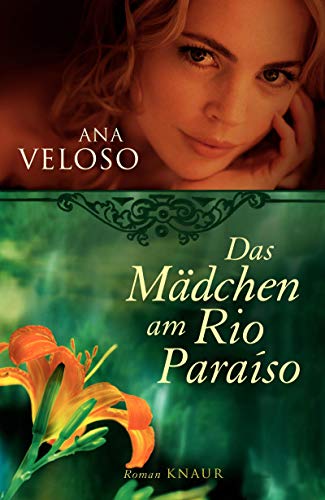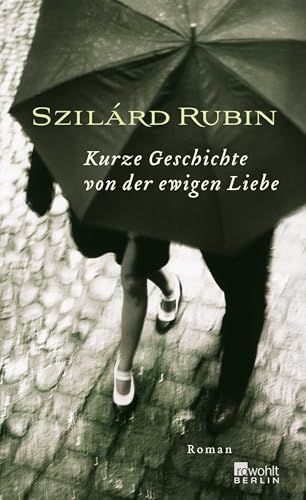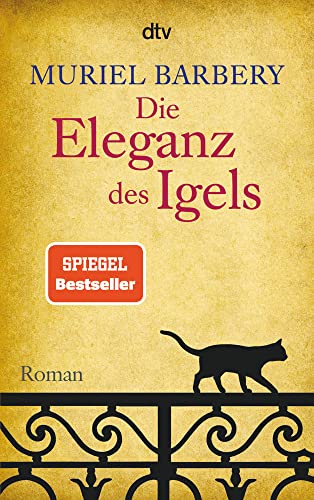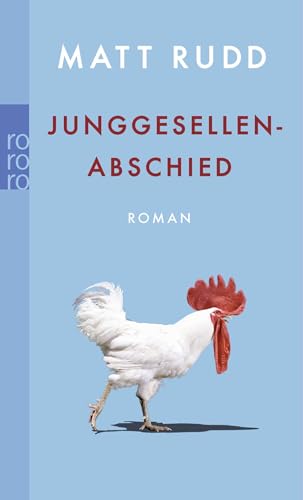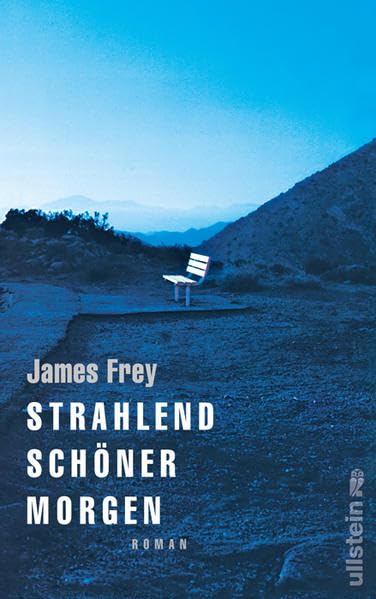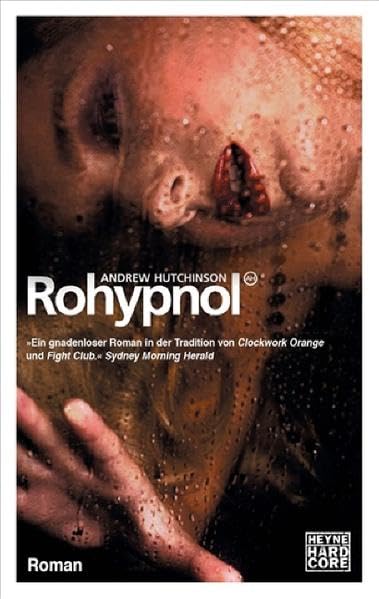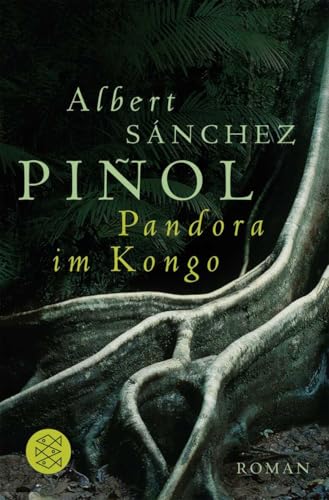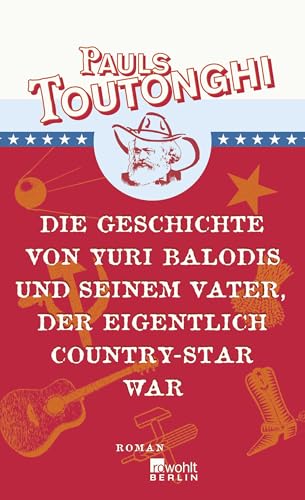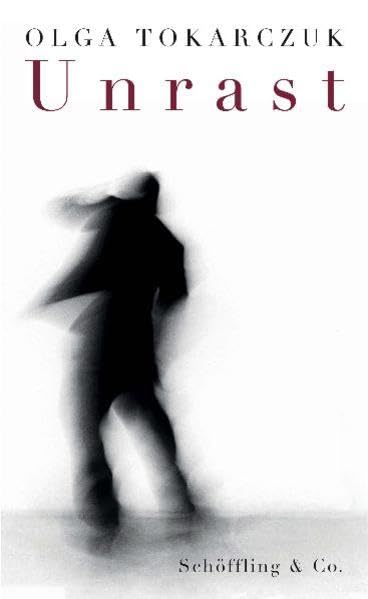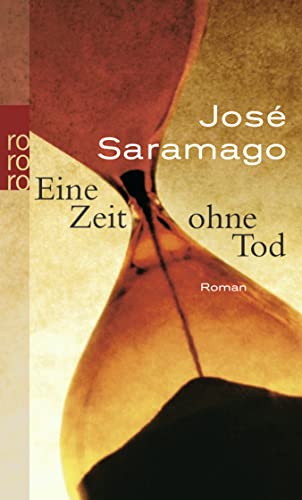Ein gewalttätiger Ex-Fremdenlegionär mit merkwürdigen, sadistischen Gewaltfantasien, eine drogenabhängige Prostituierte und ihr weichherziger Sozialarbeiter beginnen eine Art Dreiecksbeziehung. Kann das gut gehen? Und wer kommt überhaupt auf solche Ideen? Der schottische Autor Mark McNay, dessen Debütroman „Frisch“ mit Preisen ausgezeichnet wurde und den man in einem Atemzug mit Irvine Welsh nennt, beschreibt in „Under Control“, wie eine Sozialarbeiter-Klienten-Beziehung nicht ablaufen sollte.
_Gary leidet an_ einer psychischen Krankheit, aufgrund der er Aggressionen und merkwürdige Wahnvorstellungen hat. Er bekommt Medikamente und wird von dem Sozialarbeiter Nigel betreut, zusammen mit zwei anderen. Ralph ist ein ehemaliger Drogenabhängiger, der rückfällig geworden ist, und Chris leidet an Depressionen und geht nicht gerne unter Menschen. Und dann ist da auch noch Charlie, Garys Freundin. Sie ist ebenfalls drogenabhängig und arbeitet als Prostituierte auf der Straße.
Nigel ist ein weichherziger Kerl, der gerne hilft, aber ein bisschen naiv ist. Als er Charlie trifft und sich in sie verliebt, glaubt er, sie von den Drogen weg bekommen zu können. Das sieht nicht nur Nigels Frau Sarah nicht besonders gerne. Als er Charlie bittet, den Kontakt zu Gary abzubrechen, um die Therapie nicht zu gefährden, hat das für ihn ungeahnte Konsequenzen. Denn der Zustand von Gary hat sich in letzter Zeit verschlechtert …
_Mark McNay siedelt_ sein Buch im Milieu psychisch Erkrankter, Drogenabhängiger und Sozialarbeiter an. Das ist ein interessanter Blickwinkel, den der Autor gut bedient mit seinen Beschreibungen, Charakterdarstellungen und den saloppen Dialogen. Die Mut- und scheinbare Ausweglosigkeit, die den Charakteren anhaftet, wird sehr gut dargestellt. Allerdings darf man trotz allem keine besondere Spannungsdramaturgie erwarten. Es wird hauptsächlich das Alltagsleben der Protagonisten beschrieben, die wenigen konkreten Ereignisse werden in die Geschichte eingestreut, ohne dass sie einer Spannungskurve folgen. Das interessiert sicherlich nicht Jeden. Wer weniger Wert auf Darstellung, aber dafür mehr auf Action legt, ist mit diesem Buch also nicht besonders gut beraten.
Es sei denn, er kann sich für einen interessanten Schreibstil erwärmen, denn Schreiben kann McNay. Seine lässige Erzählweise ohne schwierige Begriffe und einfache Satzstrukturen liest sich flüssig. Überdies besticht er durch den Humor. Auf geradezu ungewollte Art und Weise webt McNay immer wieder witzige Bemerkungen, die eigentlich gar nicht witzig sein wollen und sehr überraschend auftreten, in den Text. Außerdem begeistert der Schriftsteller durch Bildlichkeit. Immer wieder schreibt er über Vorstellungen oder Fantasien der Leute, die er wie selbstverständlich in den Fließtext integriert.
Die Figuren selbst sind ebenfalls lesenswert. Gary wirkt zwar ab und zu wie das Klischee eines Geisteskranken, ist ansonsten aber amüsant und authentisch umgesetzt. Nigel hingegen repräsentiert die Mittelschicht und seine Einfältigkeit gehört zu den größten Pluspunkten des Romans. Zum Einen wird dem Leser aus der gleichen sozialen Schicht dadurch ein Spiegel vor gehalten. Nigel sagt an einer Stelle im Buch, dass er nur deshalb Sozialarbeiter geworden ist, weil seine Eltern ihn dazu erzogen haben, anderen zu helfen. Dass ihm aber echte Einblicke in das Leben seiner Klienten fehlen, wird auf der anderen Seite sehr authentisch gezeigt. Es kommt dabei immer wieder zu Missverständnissen zwischen beiden Gruppen, die aber keiner so recht zu bemerken scheint außer der Leser, was ab und an für prompte Lacher sorgt.
_In der Summe_ ist „Under Control“ amüsante, aber dennoch auf lässige Art und Weise tiefgründige Literatur, die gut geschrieben, aber nicht immer spannend ist.
|Aus dem Englischen von Eike Schönfeld
318 Seiten, Taschenbuch
ISBN-13: 978-3423247481|
http://www.dtv.de