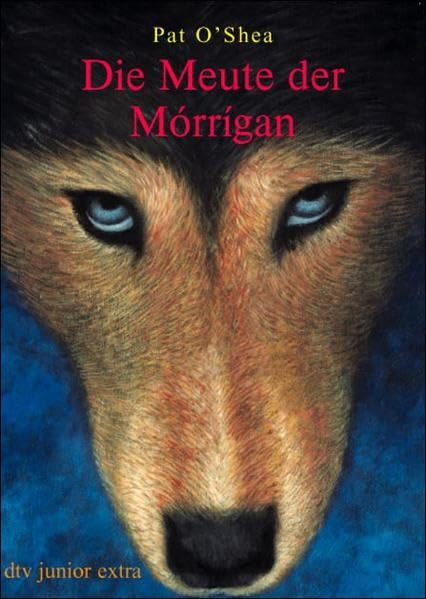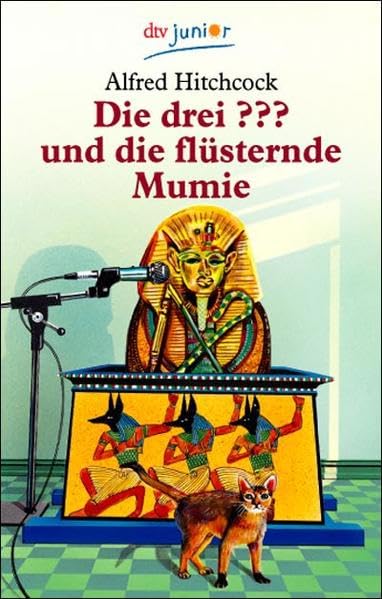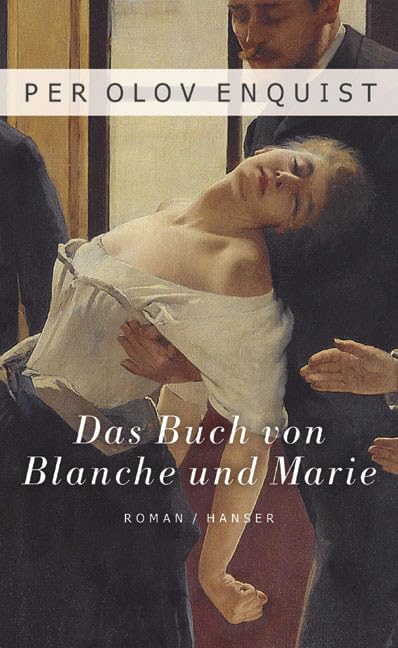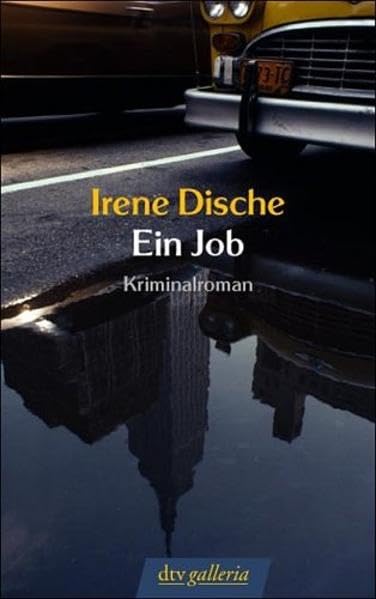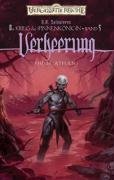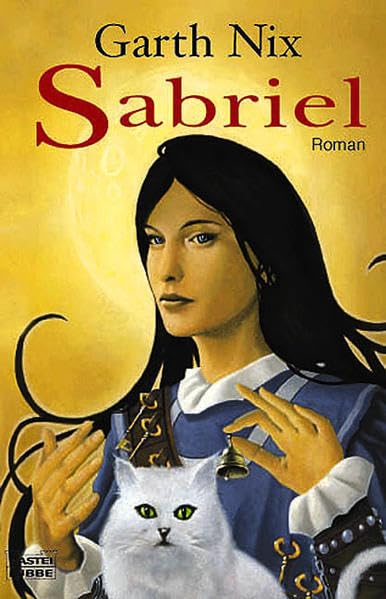Andrea Rennschmid (Hg.) – Alamo. John Waynes Freiheitsepos weiterlesen
Mario R. Dederichs – Heydrich. Das Gesicht des Bösen
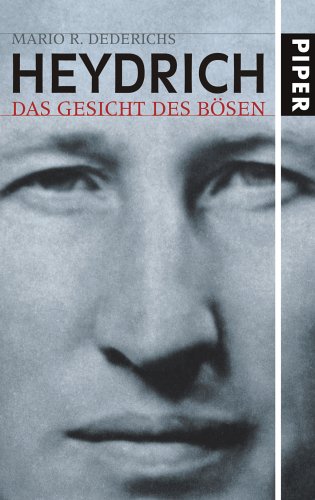
Mario R. Dederichs – Heydrich. Das Gesicht des Bösen weiterlesen
Robert Arthur – Die drei ??? und das Gespensterschloss (Band 1)

Robert Arthur – Die drei ??? und das Gespensterschloss (Band 1) weiterlesen
O’Shea, Pat – Meute der Mórrígan, Die
Pat O’Shea, Jahrgang 1931, hat 13 Jahre an diesem Roman gearbeitet, und es hat sich gelohnt. 1985 erschien dieses wundervolle, heitere Buch für Kinder und Erwachsene bei |Oxford University Press|, 1995 erschien eine gebundene Fassung beim |Verlag Freies Geistesleben|, 2001 präsentierte es der |Deutsche Taschenbuch Verlag| auch denjenigen hiesigen Lesern, die Englisch nicht (so gut) beherrschen oder Originallektüre scheuen. Die lange Verzögerung hat das Werk nicht verdient, aber besser spät als nie. Freunde guter Kinderbücher werden es mögen, Freunde irisch-keltischer Mythologie ebenso.
Worum geht es? Eines Tages findet der zehnjährige Pidge in einem Antiquariat ein paar alte Blätter, eins davon zeigt ein kompliziertes Muster, das sich beim näheren Hinsehen als eine Schlange offenbart – die böse Schlange Olc-Glas. Es ist mit einem zweiten Blatt zusammengeklebt, auf dem ein Bannspruch des Heiligen Patrick höchstselbst geschrieben steht; aber nun lösen sich beide Blätter voneinander, und allerlei merkwürdige Ereignisse nehmen ihren Anfang. Seltsame dünne Leute mit spitzen Zähnen interessieren sich sehr für Pidge und seine fünfjährige Schwester Brigit, in ein benachbartes Glashaus ziehen die zwei merkwürdigen Damen Melody Mondlicht und Breda Ekelschön ein, und die neue Stute, die Pidges Vater just an diesem Tag gekauft hat, beherbergt eine unheimliche Präsenz. Schnell begreifen die Geschwister, dass sie das Schlangen-Blatt vor Feinden verbergen müssen. Eine fast unlösbare Aufgabe, denn Melody, Breda und das Wesen in der Stute (das diese zum Glück bald verlässt) sind Macha, Bodbh und die Mórrígan, drei Schlachtendämoninnen oder auch Kriegsgöttinnen, die eins sind. Sie bieten all ihre Kraft auf – nicht nur, um das Blatt zu bekommen, sondern auch, um Pidge und Brigit daran zu hindern, einen Stein mit dem Blut der Mórrígan zu finden. Oder besser: Sie wollen diesen Stein an sich bringen. Kann die Mórrígan ihn in die Hände kriegen, kann sie ihr schwach gewordenes Blut mit diesem Tropfen wieder stark machen, Olc-Glas töten und sich seine Bosheit einverleiben; die gesamte Schöpfung wäre dann von ihr bedroht. Gelingt es den Geschwistern, den Stein zu behalten, können sie mit dem Blut Olc-Glas vernichten und die Welt retten. Zum Glück helfen ihnen die guten Götter: der Dagda, Angus Óg, der Gott der Liebe, und Brigit, die Göttin des Herdfeuers; es helfen auch der mythische Held Cúchulain, viele Tiere und andere Geschöpfe.
Pat O’Shea schreibt mit einer geradezu übersprudelnden Fülle von Einfällen und mit ständig präsentem, feinsinnigem Humor, den Übersetzerin Bettine Braun gekonnt ins Deutsche übertragen hat. Die Diktion und der Reigen skurriler, liebenswerter Figuren erinnern stark an Lewis Carroll; wer Bücher wie „Alice im Wunderland“, „Der Zauberer der Smaragdenstadt“ oder „Der kleine Prinz“ mag, wird dieses Buch ebenfalls liebgewinnen. Es ist für Kinder zum Lesen oder Vorlesen geeignet, auch für kleinere, denn es bietet eine einfache und dennoch kunstvolle Sprache, hält mit den Geschwistern zwei starke Identifikationsfiguren bereit und beinhaltet – ohne zu moralisieren – sehr viel Lebensweisheit, auf fast beiläufige, aber einprägsame Art vorgetragen. Ein sehr schönes Beispiel ist die Unterhaltung mit dem Fuchs Curu, dem vielleicht besten Freund der Kinder, der sich bitter über die Fuchsjagd beklagt und beweist, dass Füchse nicht Schädlinge, sondern sehr nützlich sind, auch wenn sie einmal ein Huhn stehlen. (Wer danach noch immer ein Fan dieses Mordsports ist, dem kann nicht mehr geholfen werden.)
Spannung und auch gruselige Momente kommen natürlich nicht zu kurz, jedoch zerstören diese Szenen, bei allem Ernst, nicht den heiteren Zauber des Buches. Man erkennt die Sicht der Autorin: Zum Leben gehört auch das Gefährliche und Dunkle, ohne dass die Schönheit des Ganzen darunter leidet. Pidge und Brigit müssen viele Abenteuer und Gefahren bestehen, und manchmal wird sich beim Vorlesen ein kleines Kind vielleicht auch unter die Decke verkriechen, aber doch immer mit der festen Gewissheit, dass am Ende alles gut ausgeht. Und noch öfter wird geschmunzelt werden; zwar entbehrt dieser Roman jeder hemdsärmligen Comedy, doch der feine Humor ist überall präsent, bis in die liebevolle Zeichnung der Nebenfiguren hinein (einer davon, dem Wachtmeister, der am Ende geläutert wird, gehört sogar der Epilog). Selbst die Vertreterinnen des Bösen, zumindest Melody und Breda, haben lustige Szenen und wirken bisweilen eher skurril als finster. Es ist überhaupt erstaunlich, wie Pat O’Shea die Götter- und Heldengestalten Irlands zum Leben erweckt und dem Leser nahe bringt. Gleiches gelingt ihr mit der Landschaft der Grünen Insel, die auch die Landschaft der Anderswelt Tír-na-nÓg ist, in der die Geschwister den größten Teil ihrer Abenteuer bestehen müssen und die eine liebevoll gezeichnete Kulisse für die Handlung bildet, nicht in langen Schilderungen ausgewalzt, aber ständig präsent und einprägsam in den Details.
Kurzum: ein großartiges Buch!
|Orginaltitel: The Hounds of the Mórrígan
übersetzt von Bettine Braun|
_Peter Schünemann_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [buchrezicenter.de]http://www.buchrezicenter.de veröffentlicht.|
Arthur, Robert / Hitchcock, Alfred – Die drei ??? und die flüsternde Mumie
Während die flüsternde Mumie bei den EUROPA-Hörspielen die Nummer 10 verpasst bekam, ist die Romanvorlage eigentlich der zweite Fall der drei Jung-Detektive aus dem fiktiven Rocky Beach, die sich selbst „Die drei Fragezeichen“ nennen. Die drei Detektive sind die amerikanischen Schuljungen Justus Jonas, Peter Shaw und Robert „Bob“ Andrews, die immer wieder knifflige und mysteriöse Fälle lösen. Dafür stehen auch die Fragezeichen – als Symbol für das Unbekannte und ungelöste Rätsel. Nicht etwa für Selbstzweifel, wie Erwachsene nicht müde werden zu fragen. Für Selbstzweifel gibt es auch gar keinen Grund, denn das Trio ermittelt nunmehr seit über 40 Jahren erfolgreich durch die Jugendliteratur. Ihr Erfinder Robert Arthur schuf einen Evergreen, als er mit dem zugkräftigen Namen Alfred Hitchcock im Titel die Serie 1964 ins Leben rief. Zu uns schwappte die Welle Anfang der Siebziger und sie ebbt bislang nicht ab. Auch wenn hierzulande eher die Hörspiele bekannter (und beliebter) sind als die Romane.
_Zur Story_
Der Brief ihres Mentors Alfred Hitchcock versetzt die drei Detektive in Verzückung. Na ja, bis auf Hasenfuß Peter vielleicht. Ein höchst mysteriöser Fall wird ihnen dort in Aussicht gestellt. Professor Yarborough – ein Freund Hitchcocks – ist Ägyptologe und hat kürzlich die von ihm entdeckte Mumie des Ra-Orkon für sein Privatmuseum erhalten. Doch der olle Lappenträger scheint trotz seines augenscheinlich toten Zustands sehr mitteilungsbedürftig zu sein. Jedoch nur dann, wenn Professor Yarborough alleine im Raum mit dem Sarkophag ist, flüstert der 3000 Jahre alte Knabe unverständliches Zeug in einem alt-arabischen Dialekt. Sobald etwa der abergläubische Butler Wilkins mit im Zimmer ist, herrscht Funkstille. Aus nachvollziehbaren Gründen wendet sich der Professor weder an die Polizei noch an seine Wissenschaftskollegen – beide würden ihn für verrückt erklären. Justus und Bob bieten ihm ihre Dienste an. Peter kümmert sich derweil lieber um eine verschwundene Katze, ihm sind flüsternde Mumien definitiv zu gruselig.
Sie erhalten den Auftrag aber erst nachdem Justus dem Professor glaubhaft versichert hat, dass er an den Fluch des Pharaos und ähnlichen übersinnlichen Humbug nicht glaubt, welcher der Mumie angedichtet wird. Butler Wilkins sieht das ganz anders, wofür er gern und ständig vom Professor gerüffelt wird. Schon bei der ersten Begutachtung des Raumes scheint der dünnhäutige Wilkins aber Recht zu bekommen. Ohne ersichtlichen Grund stürzt eine schwere Anubis-Statue beinahe auf Justus und einige der Masken an der Wand rauschen kurz darauf zu Boden. Ra-Orkon hingegen tut aber, was Tote nun mal so tun: er schweigt beharrlich. In seinem Sarkophag und am Leichnam selbst sind keinerlei technische Einrichtungen zu erkennen, welche darüber Aufschluss geben könnten, dass jemand den Professor zu verulken oder gar zu ängstigen gedenkt. Justus greift zu einem Trick, um Ra-Orkon zum Flüstern, und Licht in die Sache, zu bringen.
Verkleidet als Professor Yarborough betritt er den Raum alleine, bewaffnet mit einem Tonbandgerät. Siehe da. Die Mumie beginnt leise zu flüstern. Lässt sich der Pharao so einfach veräppeln? So scheint es, denn als Justus sich unfreiwillig demaskiert verstummt der alte Ägypter sofort – ein kleines Malheur, jedoch hat Justus das schwache Flüstern immerhin auf Band. Nun können er, Bob und der Professor zu dessen Nachbarn gehen und sich Ra-Orkons Gebrabbel übersetzen lassen. Professor Freeman ist nämlich Experte für Arabisch und zudem ein langjähriger Freund von Yarborough. Er und dessen Vater haben seinerzeit das Grab des Ra-Orkon gemeinsam entdeckt – Freeman senior kam kurz darauf um, was allgemeinhin dem Fluch angelastet wird. Doch während Butler Wilkins alleine das Haus hütet, taucht plötzlich Schakalgott Anubis höchstpersönlich auf und entwendet die Mumie. Der grade eingetroffene Peter, der von alledem nichts ahnt, hat derweil eine unheimliche Begegnung der dritten Art: mit Ra-Orkons vermeintlichem Lieblingskater und erzürnten Nachfahren des Pharaos.
_Meinung_
Man merkt, dass dieser Fall der direkte Anschluss an das Debüt „… und das Gespensterschloss“ ist, und man gewinnt den Eindruck, beide Romane wurden in einem Rutsch von Robert Arthur verfasst. Die flüsternde Mumie stammt aber aus dem Jahr 1965. Wie wir im Auftaktroman erfahren, hat Bob ein Gipsbein, welches ihn auch noch im vorliegenden Buch leicht behindert. Bei genauerer, chronologischer Betrachtung können zwischen den beiden Geschichten keine 30 Tage liegen, denn die drei Schnüffler haben immer noch (beschränkten) Zugriff auf den Rolls-Royce, samt Chauffeur Morton. Dessen Benutzung hat Justus bei einem Preisausschreiben einer Autovermietung für exakt diesen Zeitraum gewonnen. Erst später, als sie einem jungen Mann mit Namen August August aus der Patsche helfen, sorgt dieser dafür, dass das Trio ohne zeitliche Begrenzung auf den Rolls zurückgreifen kann, wann immer er benötigt wird. Das passiert aber erst bei „… und der Fluch des Rubins“ und soll hier nur dazu dienen, die Handlung zeitlich ungefähr einordnen zu können.
Zudem wird zwischendrin immer wieder nur das Gespensterschloss als Referenz angegeben. Vor allem, was den Bezug der drei Fragezeichen zu Altmeister Hitchcock betrifft. Freilich hat dieser mit der Serie nur insofern zu tun, als dass er vom Autor für seine Reihe verwurstet wird. Mit dessen Einverständnis (und gegen Lizenzgebühr) natürlich. Eine Lizenz, die nun am Anfang 2005 endgültig auslief und nicht erneuert wurde. Für altgediente Fans etwas bedauerlich, aber sicher kein Weltuntergang. Mit Voranschreiten der Serie verschwanden Vorwort und Zwischenkommentare des angeblichen Mentors sowieso mehr und mehr aus den Büchern. Irgendwo um Band 50 herum taucht diese Besonderheit der alten Geschichten gar nicht mehr auf. Keine augenzwinkernden Tipps mehr für unaufmerksame Leser. Hier gibt’s sie selbstverständlich noch und liefern den einen oder anderen humorvollen Fingerzeig in Richtung Auflösung.
Die Flüsternde Mumie ist auch anderweitig eine wichtige Wegmarke. Erstmals finden hier die inzwischen berühmt gewordenen Ausrüstungsgegenstände, wie die Walkie-Talkies und das als Ofenrohr getarnte Periskop in der Zentrale auf dem Schrottplatz, Erwähnung und Verwendung. Das heißt, es wird nicht nur beschrieben, wie Justus die genannten Teile zusammenbastelt, sie erweisen sich als wichtige Elemente in dieser Geschichte und sind auch im weiteren Verlauf der Reihe immer wieder gern verwendete Utensilien der drei Fragezeichen. Die Story ist der erste Versuch Arthurs, einen two-in-one-Fall zu etablieren. Einerseits Peter auf der Suche nach einer verschwundenen Katze, andererseits Just und Bob beim „Hauptfall“. Man kann sich bereits denken, dass beide Stränge irgendwann zusammenlaufen – das geschieht tatsächlich sogar sehr schnell.
Flott geschriebene und leicht zu lesende 142 bzw. 176 (dtv) Seiten mit relativ großem Schriftbild machen die flüsternde Mumie zu einem recht kurzen Vergnügen. Zu kurz und hastig für meinen Geschmack, man hätte den Leser ruhig noch etwas mehr zappeln lassen können. Aus dem Mystery-Element der Mumie – samt dem sie umwabernden Fluch – und Peters Parallelaktionen wäre noch mehr heraus zu holen gewesen, stattdessen geriert der Plot alsbald als wilde Hatz nach der gemopsten Leiche und ihrem Sarkophag quer durch Los Angeles. Trotz der gelegentlichen Fingerzeige „Hitchcocks“ kommt man auf die endgültige Lösung wohl kaum selbst, dazu enthält Robert Arthur der Leserschaft zu viele wichtige Informationen vor. Die letzten Puzzlesteinchen des Warum fallen erst beim obligatorischen Finale an ihren Platz – hauptsächlich durch ein (zu) rasches, umfassendes Geständnis und weniger durch detektivische Kombinationsgabe.
_Fazit_
War das Erzähltempo durchweg von einer gewissen Hektik geprägt, kommt der Schluss ziemlich abrupt. Logisch nachvollziehbar ist die Story aber, wenn auch der Grund für das Flüstern etwas arg konstruiert wirkt. Der sonst so schätzenswerte, subtile Pädagogik-Faktor innerhalb der Serie kommt hier ebenfalls ungewöhnlich kurz. Verschenktes Potenzial zugunsten von mehr Action. Dabei hätte die interessante Thematik bestimmt mehr hergegeben als verzweifelte Verfolgungsjagden, was ihr einen Touch Unausgewogenheit verleiht. Somit zählt die flüsternde Mumie unterm Strich, trotz ihres sicher nicht gänzlich unverdienten Klassiker-Status, nicht unbedingt zu meinen persönlichen Top-Favoriten. Weder als Roman, noch als Hörspiel. Nichtsdestoweniger ist die solide Geschichte auch kein Totalausfall, sondern reiht sich im durchaus akzeptablen Mittelfeld ein. Wie alle „alten“ Fälle eignet sich auch dieses Buch uneingeschränkt für (Quer-)Einsteiger.
_Die Buchdaten auf einen Blick:_
Originaltitel: „Alfred Hitchcock and the Three Investigators in the Mystery of the Whispering Mummy“
Erzählt von Robert Arthur
Erstveröffentlichung: 1965 / Random House, NY
Deutsche Ausgabe: 1970 / Franckh-Kosmos, Stuttgart
Übersetzung: Leonore Puschert
Seiten: 142 / 176
Von verschiedenen Verlagen in unterschiedlichen Bindungen erhältlich
ISBN: 3-423-07022-6 (dtv-TB)
ISBN: 3-440-05207-9 (Originalausgabe)
Enquist, Per Olov – Buch von Blanche und Marie, Das
|“Die Liebe kann man nicht erklären. Aber wer wären wir, wenn wir es nicht versuchten?“|
Marie Curie ist bis heute die vielleicht berühmteste Physikerin überhaupt. Sie war nicht nur die erste Frau, die mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet wurde, sondern sie ist bis heute die einzige Frau, der zweimal ein Nobelpreis verliehen wurde; auch ist Curie neben Linus Pauling die einzige, die in zwei unterschiedlichen Fachgebieten den Nobelpreis erhalten hat. Nach dem Unfalltod ihres Mannes Pierre Curie sorgte ihre Beziehung zum verheirateten Kollegen Paul Langevin für einen öffentlichen Skandal. Im Jahre 1934 starb die polnische Physikerin Marie Curie an Leukämie, eine Krankheit, die sie sich höchstwahrscheinlich durch den ständigen Umgang mit radioaktiven Substanzen zugezogen hatte.
Per Olov Enquist hat sich für seinen aktuellen Roman einige bekannte historische Persönlichkeiten herausgepickt, um eine fiktive Geschichte um sie herum zu spinnen. Im Zentrum der Erzählung stehen zwei bekannte Frauen, nämlich eben jene Marie Curie und Blanche Wittman, die als Medium des Nervenarztes Jean Martin Charcot in die Geschichte einging. Darüber hinaus begegnen dem Leser Figuren wie Paul Langevin, der in Physikerkreisen ebenfalls recht bekannt ist, aber auch Sigmund Freud findet sich in diesem Roman wieder.
_Wahrheit oder Fiktion?_
Ein Erzähler präsentiert dem Leser die Geschichte von Blanche und Marie, wobei ein Teil des Romans aus dem sogenannten „Fragebuch“ von Blanche stammt, das sie in Art eines Tagebuches verfasst hat. Der Rest ist aus der Sicht des Erzählers geschrieben und überbrückt meist die Zeit zwischen den Fragebuchpassagen, indem Einschübe über die Geschichte der Radioaktivität und über die gesicherten historischen Daten der bekannten Figuren berichten.
In zwei verschiedenen Handlungssträngen erfährt der Leser mehr über das Leben und Lieben von Marie Curie und Blanche Wittman. Blanche fungiert dabei als Bindeglied zwischen beiden Biographien, da sie zumindest in Enquists Geschichte einige Jahre nach ihrer Entlassung aus der Salpetrière Laborassistentin bei Curie wird. Der Autor beginnt bei bekannten historischen Fakten, erzählt also von Curies physikalischer Karriere und von der Geschichte der Radioaktivität, wir erfahren mehr über die Experimente mit Pechblende und auch über die Ehe zwischen Marie und Pierre Curie. Später beginnt Marie eine Affäre mit dem verheirateten Paul Langevin, die tatsächlich damals zu einem öffentlichen Skandal wurde. Enquist bedient sich also dieses Wissens und schmückt die Fakten mit eigenen Ideen aus.
Seine Phantasie kann etwas weiter gehen in der Zeichnung der Figur von Blanche Wittman, da sie zwar bekanntlich das berühmte Medium von Professor Charcot gewesen ist und als Königin der Hysterikerinnen bezeichnet wurde, doch dichtet Enquist eine kurze Liebesaffäre zwischen Arzt und Patientin hinzu, die alles andere als historisch gesichert ist. Darüber hinaus kann man dem Autor allerdings nicht viel Phantasie zugestehen, da er wenig über bekannte biographische Daten der auftauchenden Figuren hinausgeht.
_Amputierte Figuren_
Schon zu Beginn des Buches wird Blanche Wittman als ein Torso vorgestellt, da ihr im Laufe der Jahre beide Beine und ein Arm amputiert werden müssen. Später verbringt Blanche daher die meiste Zeit des Tages in einer Holzkiste, in der sie mit ihrem einen verbleibenden Arm ihr Fragebuch füllt. Obwohl etliche Passagen des Romans aus Blanches Sicht geschrieben sind, bleibt sie doch recht undurchsichtig. Recht früh wird ihre möglicherweise aktive Beteiligung an Prof. Charcots Tod angedeutet, doch später schildert sie diese Episode ganz anders. Auch über ihre Krankheiten wird der Leser im Dunkeln gelassen, nur andeutungsweise werden die Patientenexperimente und öffentlichen Vorführungen an der Salpetrière geschildert und etwas über die mögliche Krankengeschichte der dortigen Patienten erzählt, doch bleibt alles undurchsichtig und zweifelhaft. Auch kann der Leser nur vermuten, dass Blanches Amputationen von den Experimenten mit radioaktiven Substanzen herrühren.
Selbst ihre Gefühle werden nur zart angedeutet, obwohl sie doch ein Buch über die Liebe schreiben und diese erklären möchte. Ihre gesamte Beziehung zu Charcot und ihr Wesen zeichneten sich für mich nicht klar ab, sodass mir ihre Figur einfach nur absurd erschien. Darüber hinaus legt Enquist meiner Meinung nach zu viel Wert darauf, Blanche als verkrüppelten Torso hinzustellen, sodass es schwierig wird, sich diese Frau als ein liebendes Wesen zu denken, zu deutlich führt uns der Autor ihre Krankheiten vor Augen.
Marie Curie erhält dagegen den ihr zustehenden Raum im Buch, ihre Biographie ist hinlänglich bekannt und gesichert, sodass sich Enquist auf diese Fakten stützen kann, nur ihre Verbindung zu Blanche Wittman stammt aus Enquists Feder. Doch auch Curies Zeichnung gelingt nur mäßig, da wir zwar viele biographische Daten kennen lernen, aber zu wenig über ihre menschliche Seite erfahren.
Erst zum Ende hin lässt Enquist seine beiden Hauptfiguren in den Vordergrund treten, erst dann geht es wirklich um die Liebe, nämlich um die verzweifelte Liebe zwischen Marie Curie und Paul Langevin, die für einen Skandal sorgte und fast das Ende von Curies Karriere gewesen wäre, und um die kurze aber heftige Liebe zwischen Blanche Wittman und ihrem Arzt. Zu viel Zeit vergeudet Enquist damit, zwei Biographien zu entwickeln und zu wenig Raum gibt er der eigentlich interessanten Geschichte, an der seine eigene Phantasie einsetzen kann. So erfährt der kundige Leser wenig Neues über das Leben von Marie Curie, lediglich die Passagen über Blanche Wittman und die Geschichte der Salpetrière offenbarten mir unbekannte Fakten.
_Orientierungslos_
Da Per Olov Enquist gleich zwei sagenumwobene Frauengestalten in den Mittelpunkt seines schlanken Buches stellt und beide Lebensgeschichten zu entwickeln versucht, verheddert er sich leider zu häufig in den einzelnen Episoden. Es gibt zu viele Gedankensprünge im Buch, zu oft wechselt der Erzähler von Blanche zu Marie, zu häufig tauchen Zeitsprünge auf, sodass der Leser ratlos die Seiten umblättert und den Gedankengängen des Autors nur sehr schwierig folgen kann. Ein roter Faden, der uns durch das Buch leitet, wäre sehr wünschenswert gewesen, doch hinterlässt „Das Buch von Blanche und Marie“ eher den Eindruck einer losen Gedankensammlung, die noch sortiert und in die richtige Reihenfolge gebracht werden muss. Auch die häufig wechselnde Erzählerperspektive erschwert das Lesen, da oft erst aus dem Zusammenhang klar wird, ob der Erzähler spricht oder wir Passagen aus Blanches Fragebuch zu lesen bekommen.
Leider möchte der Autor zu viele Aspekte in seinem Büchlein unterbringen, sodass er die meisten Dinge nur anreißen kann, denn natürlich ist die Biographie einer Persönlichkeit wie Marie Curie nicht annähernd in ein so dünnes Buch zu quetschen. Zudem tauchen zahlreiche bekannte Figuren auf, die ihren Raum verlangen; der Versuch, all diese Personen unter einen Hut zu bringen, muss zwangsläufig scheitern.
Wünschenswert wäre gewesen, wenn Per Olov Enquist sich auf ein Thema beschränkt hätte, wenn er also aus Curies und Wittmans Leben nur ihre Liebesgeschichten erzählt hätte oder wenn er nur eine der beiden Damen herausgepickt hätte. Doch hält er sich mit Beschreibungen aus der Vergangenheit der beiden Frauen so sehr auf, dass für die Liebe zu wenig Raum bleibt. Darüber hinaus ist es schade, dass Enquist die Schicksale beider Frauen nicht mehr miteinander verbindet, da beide Erzählungen fast zusammenhanglos nebeneinander stehen.
_Gefühlskalte Worte_
Auch sprachlich weiß das Buch nicht zu überzeugen. Häufig finden sich nur kurze holperige Satzfragmente, die teils ohne Verb auskommen müssen. Darüber hinaus hat Enquist offenbar eine Vorliebe für Ausrufezeichen, die manchmal gehäuft mitten in einem Satz auftauchen und den Lesefluss erheblich stören. Als Stilmittel sind mir diese eingeschobenen Satzzeichen nicht sonderlich positiv aufgefallen, da sie scheinbar zufällig einzelne Worte betonen.
S. 115: |“Der Punkt! von dem aus die Geschichte betrachtet wurde und wirklich wurde! einen Meter von einem Tisch entfernt, an dem sie einst! als Pierre noch lebte! den geheimnisvollen Stoff entdeckt hatte, der! und das blaue radioaktive Licht! war denn dies nicht der richtige Punkt, um die Angst zu überwinden!“|
Besonders negativ aufgestoßen ist mir die Passage über Pierre Curies Unfalltod, der völlig herzlos und gefühlskalt beschrieben wird wie von einer Person, die sich nichts mehr gewünscht hat als diesen brutalen Tod. Mir erscheint eine solche Ausdrucksweise in der Situation völlig unangemessen, da sie selbst Maries Trauer nicht adäquat zeigen kann.
S. 85: |“Man rief die Ehefrau Marie herbei, und sie kam. Und er war tot. Nichts mehr zu machen. Wir müssen alle sterben. Aber er war doch noch so jung. […] So endete Maries dritte Liebe. Sein Kopf wurde zertrümmert. In keiner Weise gleich einem Vogel, der von der Wasseroberfläche abhebt und im Nebel verschwindet, nein, sein Kopf wurde ganz einfach von dem sechs Tonnen schweren Wagen zertrümmert, und dann war es zu Ende.“|
_Versuch eines Brückenschlages_
„Das Buch von Blanche und Marie“ wird im Nachwort ausdrücklich als Roman tituliert, dennoch stützt Enquist sich auf viele historische Quellen, die etliche Aspekte des Buches belegen können. Besonders aus Marie Curies Leben ist offensichtlich wenig hinzugedichtet, da bis auf ihre Freundschaft zu Blanche Wittman alle ihre Daten bekannt sind. Somit scheint das Buch eine Vermischung zwischen Biographie und Roman werden zu wollen, doch ist dieser Versuch misslungen. Die Geschichte um Blanche Wittman ist an vielen Stellen zu skurril, als dass sie wirklich mitreißen und unterhalten könnte, sodass ich auf diesen Part im Buch leicht hätte verzichten können. Über Marie Curie schreibt Enquist aber zu wenig, um sich deutlich von einer Biographie abzugrenzen.
Ein solcher Brückenschlag wäre durchaus möglich gewesen, wenn der Autor sich am Ende genug Raum gelassen hätte, um seine eigene Geschichte zu entwickeln, die sich endlich vom bereits Bekannten abgrenzen kann. Als das Buch etwas in Schwung kommt, Blanche von ihrer Affäre zu Charcot erzählt und Marie unter Liebeskummer leidet, da hetzt Enquist plötzlich, obwohl er sich doch vorher so viel Zeit genommen hat, um den persönlichen Hintergrund seiner Figuren zu entwickeln. Fast hat es den Eindruck, als wären ihm die Ideen ausgegangen und auch der Mut, eine eigene Geschichte über zwei so bekannte Personen zu schreiben.
_Ein Fazit_
Der vorliegende Roman ist schwierig in ein Genre einzuordnen, da er sich größtenteils auf bekannte historische Fakten stützt und zwei Biographien entwickelt, die in unabhängigen Quellen nachzulesen sind. Zu wenig eigene Ideen hat Enquist eingebaut, wobei er die Charakterisierung Blanche Wittmans leider zu stark übertrieben hat. Wittman erscheint dem Leser eher als verkrüppelter und verschrobener Torso denn als eine gefühlsvolle Frau, die versucht, die Liebe zu erklären. Auch sprachlich konnte Enquist mich nicht überzeugen, die Wahl seiner Stilmittel erscheint mir oftmals ungeschickt und unangemessen. Sein Schreibstil kam mir unausgegoren vor, zumal die Erzählung einen roten Faden deutlich vermissen ließ. Abschließend kann ich nur nochmals unterstreichen, dass ich enttäuscht war von diesem Buch und mir deutlich mehr erwartet hatte.
Dische, Irene – Ein Job
Ganz harmlos fängt sie an, die Geschichte, die Irene Dische um die Erlebnisse eines kurdischen Profikillers in New York spinnt, mit Schneeballwerfen in der kurdischen Heimat. Der kleine Junge, der damals türkische Soldaten mit Schneebällen beworfen hat, ist in der Gegenwart der gefürchtete Killer „Schwarzer Stein“. Nach der Flucht aus dem türkischen Gefängnis, in dem Alan Korkunç inhaftiert war, bringt ihn sein neuer Auftraggeber nach New York, um ihn dort einen Job erledigen zu lassen. Alan soll einem unbequemen Geschäftpartner seines Auftraggebers eine Lektion erteilen und zu diesem Zweck dessen Familie umbringen.
Alan versucht den Job mit der gleich Coolness anzugehen wie jeden anderen auch. Die Tatsache, dass er zum ersten Mal in New York ist und nicht ein Wort Englisch versteht, ist für einen Mann wie Alan schließlich kein Hindernis. Etwa eine Woche bleibt ihm für die Vorbereitungen, die er nach den ersten schweißtreibenden Erlebnissen beim Donutkauf und bei der Fortbewegung durch die Stadt angehen will. Doch irgendwie ist er hin- und hergerissen zwischen neuen Eindrücken und der Sehnsucht nach Vertrautem. Er sehnt sich nach seinen Joop-Socken und seinen teuren Anzügen, die daheim in Istanbul in seinem Schrank hängen, während er in New York nicht einmal eine Hose zum Wechseln hat. Seine Finger brauchen dringend eine Maniküre, denn mit nichtmanikürten Fingern den Abzug zu ziehen, kommt für Alan nicht in Frage, schließlich ist er Perfektionist.
Doch irgendwie geht mit Alan auch eine merkwürdige Veränderung vor sich, denn da wäre noch Mrs. Allen, die ältere Dame, die im Appartement nebenan wohnt und glücklicherweise Türkisch spricht. Alan trägt ihr nicht nur die Einkaufstaschen in die Wohnung, er isst auch mit ihr und sieht zusammen mit ihr fern. Die fremde Stadt, Mrs. Allen – irgendwie scheint Alan ein wenig aus dem Takt zu geraten. Aber er hat schließlich noch einen Job zu erledigen …
Einen Kriminalroman verspricht Irene Dische dem Leser und hält das Versprechen, während sie es gleichzeitig bricht. Sie provoziert eine gewisse Erwartungshaltung, die letztendlich eine kleine, aber geschickte Fallgrube ist, denn am Ende stößt sie den „Kriminalroman-Leser“ ein wenig vor den Kopf. Auch die Krimizutaten Profikiller und Mordauftrag können nicht darüber hinwegtäuschen, dass „Ein Job“ eine Geschichte ist, die sich eigentlich auch noch auf einer gänzlich anderen Ebene abspielt. Seltsam schwarzhumorig angehaucht, entpuppt sich die gerade einmal 155 Seiten lange Erzählung zum Ende hin als eine Art Lebensmärchen. Eine Geschichte, die ein Vater seiner Tochter erzählt.
Für den Leser ist dies allemal unterhaltsam. Der Zusammenprall zweier gänzlich unterschiedlicher Kulturen, mit allen Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, wird mit scharfem Blick und Witz geschildert. Die kurdische Problematik taucht dabei nur am Rande auf. Alan ist ein eher unpolitischer Mensch. |“Ein Kurde ist zu wenig. Zwei Kurden sind zu viel.“| So lautet Alans Einstellung. Alan, der in Istanbul stets um Coolness und korrektes, mitunter eiskaltes Auftreten bemüht war, der es verstand, Frauen mit einem gewissen Blick um den kleinen Finger zu wickeln, wirkt nach dem Ortswechsel seltsam deplatziert. Wie ein dummer Bauerntrottel stolpert er durch die Metropole. Seine Beschattungsversuche des Zielobjekts verlaufen derart unprofessionell und stümperhaft, dass man als Leser fast schon Mitleid bekommt, und so entwickelt sich eine etwas sonderbare Sympathie zwischen Leser und Hauptfigur.
Alan wirkt mitunter orientierungslos und fängt dabei, ohne dass er es selbst großartig merkt, an, sich anderen Menschen zu öffnen. Er verbringt viel Zeit mit Mrs. Allen, trinkt mit ihr Sherry und fährt mit ihr spazieren, und so entsteht daraus ein überraschend herzliches Verhältnis, das so gar nicht zu dem eiskalten Profikillerimage passen mag. Die Erzählung wird dadurch um eine weitere interessante und unterhaltsame Komponente erweitert – zumal der Leser schon recht schnell vermuten darf, dass es für den Job eines Killers nicht unbedingt förderlich ist, so eine enge persönliche Bindung zu einer älteren Dame einzugehen.
Je näher der Tag rückt, an dem Alan seinen Job auszuführen hat, desto mehr scheint er bereits aus dem Takt geraten zu sein. Auch in diesem Punkt hegt man als Leser im Laufe der Erzählung die dunkelsten Befürchtungen. Es scheint fast unausweichlich. Irgendetwas geht bestimmt schief. Man spürt es einfach. Und so baut Irene Dische einen kontinuierlichen Spannungsbogen auf, der eine ausgewogene und professionelle Gesamtkomposition erkennen lässt. Der Leser fiebert mit und sehnt den Tag des „Jobs“ richtiggehend herbei.
Zum Ende der Geschichte hin, aber führt Irene Dische den Leser noch einmal ein wenig an der Nase herum. Sie fährt ein etwas sonderbares Happy-End auf, bei dem man nicht so recht weiß, was man davon halten soll. Irgendwie absurd wirkt es, wie sie den Leser aus der Geschichte schickt.
Sprachlich wirkt die Erzählung jederzeit souverän. Irene Dische versteht mit Worten umzugehen, zaubert durch ihre Formulierungen immer wieder Witz und Charme in die Zeilen, zeichnet die Figuren sehr treffend und versteht mit wenigen Worten, die kulturellen Unterschiede spitzfindig herauszukehren. Selbst die eingestreuten kurdischen Wörter stören nicht, sondern tragen zur Atmosphäre bei, obwohl sie nicht übersetzt werden. Sie erschließen sich aus dem Zusammenhang. Einzig die Erzählperspektive wirkt hier und da verwirrend, denn es kommt vor (zwar nur an sehr wenigen Stellen der Geschichte), dass mit dem Erzählten eine Person direkt angesprochen wird, entweder der Leser oder irgendwer sonst, den der Leser nicht kennt. Diese merkwürdige Perspektive, die sich auch nicht aus dem Ende heraus so richtig erschließt, schafft wiederum eine gewisse Distanz zur Geschichte und bleibt etwas sonderbar.
Wer einen Roman mit Action erwartet, der ist schief gewickelt. Irene Dische konzentriert sich auf Alans Erlebnisse im New Yorker Alltag und schildert am Ende den Verlauf seines Auftrags. Aber Alans Zurechtfinden im Alltag, das Aufeinanderprallen zweier so unterschiedlicher Kulturen ist für sich genommen schon nervenaufreibend und teilweise rasant genug. Action ist da absolut überflüssig. Entstanden ist der Roman übrigens nach dem Drehbuch „The Assassin’s Last Killing“, das Irene Dische zusammen mit Nizamettin Ariç geschrieben hat.
Dische erzählt herrlich unterhaltsam, scharfsinnig beobachtend und manchmal urkomisch und schwarzhumorig. „Ein Job“ ist ein Krimi und ist es gleichzeitig nicht. Eine Geschichte, die mit der Erwartungshaltung des Lesers spielt und dabei absolut ausgewogen komponiert und für den Leser ein kurzweiliges Vergnügen ist.
Mader, Matthias – Over the Top – Das Motörhead-Fanbuch
Neben dem primär auf die Person Lemmy Kilmister ausgerichteten [„Lemmy – White Line Fever“ 954 hat der Verlag |Iron Pages| ein Buch herausgebracht, welches sich mit dem Gesamtphänomen MOTÖRHEAD beschäftigt: „Over the Top – Das Motörhead-Fanbuch“ von Matthias Mader. Mader hat mit „Burning Ambition“ bereits ein „Fanbuch“ zu IRON MAIDEN im selben Verlag herausgebracht und möchte dieses Prinzip nun mit „Over the Top“ fortsetzen.
Zum Inhalt: Mader beginnt nach einem zweiseitigen „ultimativen Quiz für alle MOTÖRHEAD-Kenner“ sofort mit einer einleitenden Rechtfertigung seines Werkes. Zum einen sei der deutsche Markt nicht wirklich offen für MOTÖRHEAD-Biographien aus dem Ausland, und andere deutschsprachige Publikationen zu diesem Bereich seien bis dato nicht „zusammenhängend“ gewesen. Zum anderen sei gerade das Buch „White Line Fever“ ein Produkt der „The Osbournes“-Ära und somit nicht „seriös“. Diese Kritik mutet ein wenig seltsam an, da die deutsche Edition von „White Line Fever“ im selben Verlag wie „Over the Top“ erschienen ist, auf S. 41 ganzseitig beworben wird und obendrein von Lemmy persönlich autorisiert wurde. Man könnte meinen, Mader würde seine Fachkompetenz, was MOTÖRHEAD betrifft, über die von Lemmy selbst stellen. Starker Tobak, zumal Mader eine solche Selbstbeweihräucherung eigentlich gar nicht nötig hätte – „Over the Top“ weiß durchaus aus sich selbst heraus zu überzeugen.
Neben dem Prolog gliedert sich das Buch in sechs weitere Teile. „Teil 2: Die Bandhistory“ beleuchtet zunächst den Werdegang von MOTÖRHEAD, Lemmys Interesse am III. Reich, das freundschaftliche Verhältnis zwischen MOTÖRHEAD und den RAMONES sowie Lemmys Berührungen mit der Filmbranche. Maders Wiedergabe der Bandgeschichte bietet im Grunde das, was bei „White Line Fever“ gefehlt hat: Fakten, Fakten, Fakten in einer chronologisch sinnvollen Reihenfolge. Einige Zitate werden dabei (wie im folgenden Textverlauf auch) noch einmal gesondert in grauen Kästchen hervorgehoben. Dieses Verfahren kenne ich sonst nur aus Zeitschriftenartikeln. Wirklich stören tut es den Textfluss m.E. nicht, aber es trivialisiert das Ganze ein wenig. „Lemmys Faszination mit dem [sic!] II. Weltkrieg“ ist eine erfreulich unaufgeregte Darstellung der Fakten. Wer nach der Lektüre immer noch meint, Lemmy eine rechtsradikale Gesinnung attestieren zu müssen, disqualifiziert sich im Grunde nur selbst. Das Verhältnis zwischen MOTÖRHEAD und den RAMONES wird kurz, aber anschaulich beschrieben. Ich habe MOTÖRHEAD selbst live gesehen und kann daher aus eigener Erfahrung bestätigen, dass der Tod von Joey und Dee Dee (Johnny lebte damals noch) für Lemmy ein großer persönlicher Verlust ist. Schließlich folgt eine Reihe von Kurzbesprechungen sämtlicher Filme, in welchen Lemmy mitgespielt hat. Diese Besprechungen entsprechen natürlich Maders persönlichen Präferenzen. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten, aber weshalb „Airheads“ im Vergleich zu „Eat the Rich“ „platt“ und „langweilig“ sein soll, entzieht sich völlig meinem Verständnis.
In Kapitel Nr. 3 beschreibt Mader en detail, wer wann wo und wie bei MOTÖRHEAD musikalisch mitgewirkt hat, und was für andere Projekte diese Personen verfolgt haben. Inhaltlich gibt es hier nichts zu meckern. Die Frage ist nur, ob und inwiefern man sich für diese Detailfülle begeistern kann.
Kapitel Nr. 4 besteht aus vier O-Ton-Interviews. Zunächst kommen wir in den Genuss eines dreiseitigen Interviews aus dem Jahre 1998, welches Mader mit Lemmy himself geführt hat. Das Hauptthema ist wieder einmal „deutsche Geschichte“. Danach folgt ein längeres Interview mit Fast Eddie Clarke aus dem Jahre 2003, wiederum von Mader geführt. Dieses Interview ist insbesondere deswegen interessant, weil die Gleichung MOTÖRHEAD = Lemmy Kilmister eben nicht aufgeht. Nachdem die Perspektive der Band dergestalt zum Tragen gekommen ist, folgt wieder ein Interview aus dem Jahre 2003, diesmal mit Jörn Rüter von Remedy Records bzw. TORMENT. Rüter ist sowohl Fan als auch Experte und steht mit MOTÖRHEAD in persönlichem Kontakt. Auch hier erwartet den Leser wieder eine Menge Insiderwissen. Zuletzt folgt ein Interview mit dem Hamburger Underground-Filmemacher Peter Sempel. Sempel ist auf Musikfilme spezialisiert und hat mit „Lemmy“ ein filmisches Portrait des selbigen gedreht.
Es folgt mit Kapitel Nr. 5 eine ausführliche Katalogisierung der wichtigsten MOTÖRHEAD-Cover und Tribut-Alben. MOTÖRHEAD-Fans, die musikalisch aufgeschlossen sind, kommen hier sicherlich auf ihre Kosten.
Kapitel Nr. 6 wurde von einem gewissen Ralf Hartmann verfasst und beinhaltet eine Auflistung sämtlicher MOTÖRHEAD-Bootlegs (von denen es tatsächlich nicht allzu viele gibt). Für Sammler eine unentbehrliche Checkliste und wahre Fundgrube.
Das Buch schließt mit einem ausführlichen Quellenverzeichnis. Zwar hat Mader nicht wissenschaftlich (ohne Fußnoten) gearbeitet, aber anhand dieser Auflistung müssten sich die meisten seiner Aussagen überprüfen lassen (wenn es einem der Aufwand wert ist).
Mein Gesamteindruck: Der Schreibstil von Matthias Mader ist soweit okay und der Thematik angemessen, sofern man von seinem inflationären Gebrauch des Ausrufezeichens absieht. Bindung und Papierqualität sind aber – wie schon bei „White Line Fever“ – angesichts des Preises von 18,60 Euro eine absolute Frechheit. Wenn der Verlag |Iron Pages| „Over the Top“ schon als „Fanbuch“ etikettiert, dann sollte er m.E. auch eine entsprechende Preispolitik betreiben.
Letztendlich kommen aber die absoluten MOTÖRHEAD-Maniacs an dieser Ansammlung geballten Fachwissens nicht vorbei. Alle anderen sollten vielleicht mal einen Blick riskieren. „Over the Top“ ist dabei keinesfalls als Konkurrenz zur Quasi-Autobiographie „White Line Fever“ zu sehen, da die beiden Bücher völlig verschiedene Bereiche („Infotaimnent“ respektive „Rockstarmythos“) abdecken. Tatsächlich ergänzen sich die beiden Bücher gerade aufgrund ihrer unterschiedlichen Betrachtungsweisen des motörheadschen Paralleluniversums hervorragend. Wer also bereit ist, knapp 40 Euro zu investieren, erhält dafür ein MOTÖRHEAD-Kompendium, welches (inhaltlich) keine Wünsche offen lässt.
Matthew Delaney – Dämon
Im November 1943 erreicht der Pazifikkrieg die kleine Tropeninsel Bougainville. Während der Gefechte geht ein US-Erkundungstrupp im Dschungel verloren. Ein zweites Platoon wird ihm hinterher geschickt. Ständig wird es in Scharmützel mit feindlichen Japanern verwickelt. Schlimmer sind jedoch hinterhältige Mordattacken, die eine fremde, sadistische Macht auf die Männer verübt. Hartnäckig verfolgen diese ihren Auftrag, aber was sie finden und bergen (s. Buchtitel), versinkt nach einem Luftangriff mit dem Truppentransporter „Galla“ im Meer.
2007 wird das Wrack gehoben und in das neue Marinemuseum des Finanzmagnaten Joseph Lyerman nach Boston im US-Staat Massachusetts geschleppt. Ein Jahr später fällt dessen Sohn einem brutalen Mord zum Opfer. Mit dem Fall werden die Detectives Jefferson und Brogan beauftragt. Sie haben kaum die Ermittlungen aufgenommen, als überall in der Stadt Leichen gefunden werden, die von riesigen Klauen buchstäblich in Stücke gerissen wurden. Matthew Delaney – Dämon weiterlesen
Arthur, Robert / Hitchcock, Alfred – Die drei ??? und der Super-Papagei
Der Super-Papagei hat in Deutschland einen Sonderstatus innerhalb der Serie, denn mit ihm begann der Siegeszug. Das bedarf einer kurzen Erklärung. Einem breiteren Publikum bekannt wurden die Fragezeichen erst 1979 über die Hörspiele aus den EUROPA-Studios, die ersten Bücher erschienen bereits Anfang der Siebziger und fristeten bis dahin ein ziemliches Schattendasein. Bei EUROPA wurde der eigentlich erste Roman „… und das Gespensterschloss“ von 1964 zurückgestellt und dafür „… und der Super-Papagei“ (aus dem gleichen Jahr) stattdessen als Pilot vertont. Das Gespensterschloss rutschte auf Platz 11 und fürderhin galt der Papagei – nach dem durchschlagenden Erfolg der Hörspielserie – auch bei den Büchern als Auftaktgeschichte. Zumindest in Deutschland. Wenngleich es chronologisch falsch ist, hält sich diese Annahme bei manchen bis heute. Ebenso wie die Autorenschaft von Hitchcock, tatsächlich wurde die Serie von Robert Arthur ins Leben gerufen, der sich auch noch für den Super-Papagei verantwortlich zeigt.
Alfred Hitchcock hat eigentlich nichts weiter mit den „Three Investigators“ (so der amerikanische Originaltitel der Reihe) zu tun. Er stiftete unter Lizenz lediglich seinen zugkräftigen Namen und tritt als Moderator in den alten Geschichten auf, später ließ aber auch das nach. Die drei Fragezeichen sind ein flügger Selbstläufer geworden, man brauchte das markttechnische Tuning nicht mehr. Jene Lizenz ist nun Anfang des Jahres 2005 pünktlich zum 25. Jubiläum der Serie in Deutschland sowieso endgültig ausgelaufen. Fürderhin werden Printausgaben und Hörspiele ohne sein Konterfei und Namen im Titel erscheinen. Das Nostalgikerherz blutet ein wenig, doch im Grunde genommen ist dies kein wirklicher Verlust oder gar Rückschlag. Man hatte sich als Fan nur daran gewöhnt, Altmeister Hitchcock mit der Serie in Verbindung zu bringen. Nicht mehr, nicht weniger.
Doch wer sind die drei Detektive? Die amerikanischen Schuljungs Justus, Peter und Bob lösen ihre kniffligen und mysteriösen Fälle zumeist von ihrer Zentrale – einem alten, versteckten Campingwagen – auf dem Schrottplatz von Justus‘ Onkel Titus aus. Auch und gerade solche, welche der Polizei manchmal zu banal erscheinen. Hier und da stößt die Jugenddetektei auch durch puren Zufall auf Rätsel und Abenteuer, falls sie nicht von ihrem Impressario Hitchcock oder einem anderen potenziellen Klienten an sie herangetragen werden. „Wir übernehmen jeden Fall“ ist das Credo der drei Schnüffelnasen, das neben dem ???-Logo auf der berühmten Visitenkarte der drei prangt. Die Fragezeichen – ein verschiedenfarbiges für jeden – stehen nicht etwa für Selbstzweifel, sondern für ungelöste Geheimnisse und Rätsel aller Art. Diesen Umstand müssen sie, als Running Gag, mindestens einmal pro Fall den oft skeptischen Erwachsenen erklären.
Sollte die Visitenkarte nicht den gewünschten Effekt bringen, das Gegenüber zu überzeugen, dass die Drei es faustdick hinter den Löffeln haben, verfügen sie noch über einen Ausweis der Polizeidirektion von Rocky Beach, der sie zu „offiziellen, ehrenamtlichen Junior-Mitarbeitern“ erhebt. Diesen haben sie aufgrund ihrer zurückliegenden, oft erfolgreichen, Zusammenarbeit mit den Cops von der Behörde erhalten. Den Ausweis drücken sie gerne jedem in die Hand, der ihre Fähigkeiten wegen ihres Alters in Zweifel zieht. Nicht selten münden die Ermittlungen der Jungs nämlich darin, dass der ihnen wohlgesonnene Hauptkommissar Reynolds tätig werden muss, weil sich ein anfangs harmlos anmutender Fall dann doch als „richtiges“ Verbrechen erweist. Morde sind aber nie aufzuklären, man beschränkt sich darauf, die Jugendserie „sauber“ zu halten und auf weniger kapitale Verbrechen, z. B. Diebstahl, Fälschung, Entführung, Betrug etc. als maximum crime zu setzen.
_Zur Story_
Mr. Malcolm Fentriss ist sein Papagei Lucullus abhanden gekommen, den er erst kürzlich von einem mexikanischen Hausierer erstanden hat. Da sich die Polizei wenig kooperativ zeigt und davon ausgeht, dass sein gefiederter Hausgenosse ganz einfach entflogen ist, wendet sich Mr. Fentriss an seinen Freund Alfred Hitchcock, ob dieser nicht eine gute Detektei empfehlen könne. Kann er. Natürlich schickt Hitchcock die drei Fragezeichen auf die Fährte des ausgesprochen sprachbegabten Flatterviehs. Doch zunächst müssen Just und Peter das Haus des neuen Klienten besuchen, um näheres zu erfahren. Ein Hilferuf daraus alarmiert die Jungs, als sie sich dem Gebäude nähern. Ein unfreundlicher, dicker Mann in Fentriss‘ Haus, der sich als der Eigentümer ausgibt, behauptet, das wäre der wiedergekehrte Papagei gewesen. Es gäbe keinen Fall zu lösen. Vielen Dank und Tschüss!
Natürlich war das nicht Mr. Fentriss, den finden Justus und Peter kurz darauf gefesselt in seinem Haus, nachdem sie misstrauisch geworden waren und noch einmal zurückkehrten. Der Befreite erzählt ihnen die ganze Geschichte und auch, dass der Papagei keinesfalls ausgebüxt sein kann. Einleuchtend, denn kein Papagei würde gleich seinen Käfig mitnehmen. Doch vor allem was „Lucky“ so auszeichnete, klingt für Justus hochinteressant. Er hat einen sehr höchst rätselhaften Spruch auf der Pfanne. Damit ist Lucullus nicht der Einzige. Mrs. Waggoner – eine Nachbarin von Mr. Fentriss – hat vom gleichen Hausierer einen gelbköpfigen Papagei gekauft. „Schneewittchen“ gibt auch seltsam Verdrehtes zum Besten – und ebenso wie schon Lucullus ist Schneewitchen gestohlen worden, wie Justus und Peter wenig später durch Zufall erfahren. Und wieder wurden der dicke Mann und sein markantes Auto in der Nähe des Tatorts gesehen.
Als wären zwei solcher schrägen und geheimnisvollen Vögel nicht schon genug, stellt sich heraus, dass es insgesamt sieben davon gibt, hinter denen nicht nur der undurchsichtige Mr. Claudius (so heißt der Dicke), sondern auch der spätere Erzrivale der Satzzeichen – Victor Hugenay – her sind wie der Teufel hinter armen Seelen. Vor allem Monsieur Hugenay, der Gentleman-Kunstdieb aus Frankreich, ist eine verdammt harte und clevere Nuss. Doch wie passt er ins Bild? Skinny Norris, der Dauergegenspieler der drei Detektive, schmeißt ihnen auch noch Steine in den Weg, was die wilde Jagd nach dem Federviechern zum Kippen zu bringen droht. Wem wird es zuerst gelingen die Papageien zu finden und die Rätselsprüche von Lucullus, Schneewittchen, Robin Hood, Blackbeard, Käpt’n Kidd, Sherlock Holmes und Al Capone zu knacken? Besonders der unscheinbare Blackbeard scheint der unverzichtbare Schlüssel zum kniffligen Fall zu werden. Obwohl er optisch nicht viel hermacht, ist er nämlich: der Super-Papagei.
_Meinung_
Die Entscheidung, den Roman „… und der Super-Papagei“ als Auftakt zur Hörspielserie zu verwenden, war eine sehr gute von EUROPA. Und eine mit Spätfolgen. Man hatte sich eine Vorlage herausgepickt, die voller Stammfiguren steckt, mit welchen die drei Detektive auch später immer wieder zu tun bekommen werden. Der verhasste Erzrivale Skinny Norris, Superschurke Hugenay (gesprochen: „Üschänee“) oder Chauffeur Norton, der den (gelegentlich zur Verfügung gestellten) Rolls Royce der drei Fragezeichen lenkt. Alles ziemlich feste Größen im späteren Verlauf der Reihe. Nicht zu vergessen Blackbeard – genannt „Blacky“ -, der ab dieser Story dauerhaft in Justus‘, Peters und Bobs Zentrale einzieht. Als ihr gefiedertes Maskottchen. Kein Wunder also, dass auch der Buchtitel fälschlicherweise gemeinhin als „Teil 1“ gilt.
Besonders attraktiv für Jugendliche ist sicher das Konzept, dass drei Schuljungs in der Erwachsenenwelt bestehen und diese von ihren detektivischen Fähigkeiten überzeugen können. Wer hätte sich als Kind bzw. Teenie nicht gewünscht, wenigstens etwas mehr Gehör zu finden? Oder auch geheimnisvolle Rätsel zu lösen vermocht? Die drei Fragezeichen bestehen solche Abenteuer und dabei symbolisieren sie, dass frisches Denken und gute Bildung im Verbund mit Teamwork zum Erfolg führen. Teamwork ist ein gutes Stichwort. Fallen viele der Fälle in „the one and only Justus-Superstar“-Manier aus, dienen Peter und Bob endlich mal wieder nicht nur als reine Statisten, sondern liefern der Leserschaft äußerst wichtige Informationen, die selbst das unumstrittene Mastermind der Fragezeichen nicht kennt. Bei der Lösung des Falles ist zudem diesmal eine große Portion Glück mit im Spiel und nicht nur fleißige Detektivarbeit.
Der Superpapagei ist auch wieder eine Geschichte, bei der man eine Menge nebenher lernen kann. Nicht nur den Gebrauch des eigenen Verstandes, um des Rätsels Lösung auf eigene Faust zu knacken, wie es bei jedem Fall der drei Detektive stets gedacht und erwünscht ist. Gemeint sind vielmehr die Papageien (wie man ihren Namen bereits ersehen kann), die dem Autor als Transportmittel dazu dienen, durch ihre verbogenen Zitate auch andere berühmte Gestalten der Literatur und aus realen Geschichte dem Leser etwas näher zu bringen. Diesen vielleicht sogar neugierig zu machen, über die einzelnen Figuren, welche die Papageien verkörpern, selbst etwas mehr zu lesen. Ein geschickter Schachzug, ein paar pädagogisch und didaktisch wertvolle Informationen in Punkto Allgemeinwissen derart einzuflechten.
Besonders angetan hat es Robert Arthur offensichtlich Robert Louis Stevenson und seine „Schatzinsel“. Leider ist Übersetzerin Leonore Puschert das wohl nicht ganz aufgegangen, als sie „Long John Silver“ (ein feststehender Eigenname) mit „dem langen John Silver“ übersetzte. Dies ist aber die einzige Übersetzungsmacke, die auffällig wurde und soweit ich weiß, ist sie in späteren Auflagen ausgebügelt worden. Sieht man von der Änderung des Titels an sich mal ab, denn eigentlich müsste das Buch „… und der stammelnde Papagei“ heißen. Okay, „Super-Papagei“ klingt zweifellos interessanter und ist so falsch nun nicht. Der Schreibstil ist locker, mutet aber in seiner Wortwahl ein wenig antiquiert an. Das tut der Geschichte aber keinen Abbruch, im Gegenteil. Irgendwie gehört diese Schreibweise zu den drei Fragezeichen.
Geübte Leseratten rauschen in knapp zweieinhalb bis drei Stunden durch die fast 200 Seiten. Somit ist das Buch eines der längeren der Serie. Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass die Figuren schärfer konturiert sind als bei manch anderem Vertreter der Reihe. Fehlen darf selbstverständlich nicht, dass „Alfred Hitchcock“ mit seinen gelegentlichen, augenzwinkernden Zwischenkommentaren, die vielleicht nicht ganz so akribisch mitdenkenden Leser immer wieder in die richtige Bahn lenkt und Denkanstöße liefert. Aber auch das hilft nicht, den Fall selbst klären zu können, geschweige denn das verzwickte Rätsel zu lösen. Arthur gibt als „Hitchcock“ zwar subtile Hinweise, der Showdown gerät dann doch sehr unerwartet und spannend bis zur letzten Seite. Außerdem dürfen die Protagonisten am Ende noch beweisen, dass sie das Herz auf den rechten Fleck haben. Warum? Das sei hier aufgrund des Spannungserhalts nicht verraten.
_Fazit_
Es wäre ganz bestimmt ein würdiges Buch zur Vorstellung der Serie gewesen, keine Frage. Es verkörpert wie kaum ein zweites das Flair und die Tugenden, welche Leser – ob jung oder alt – seit Jahrzehnten so sehr schätzen. Es ist alles da, was eine gute Abenteuergeschichte ausmacht: Ein „richtiges“ Verbrechen, ein exzellent durchdachtes und logisch aufgebautes Rätsel, eine Portion Mystery und zu guter Letzt ein Friedhof im Nebel mit abschließendem Happy-End. Lesefaulen sei an dieser Stelle das Hörspiel in der 2004er-Neuauflage ans Herz gelegt, welches schon ziemlich nah an die Vorlage herankommt. Im Gegensatz zur „alten“ Version von 1979 jedenfalls, auch wenn einige wichtige Nebenhandlungen auch hier fehlen bzw. stark angepasst wurden. Alles in allem ist dieser Fall ganz besonders für Neueinsteiger dringend zu empfehlen, auch wenn das „Gespensterschloss“ der allererste Fall der drei Fragezeichen ist.
_Die Buchdaten auf einen Blick:_
Originaltitel: „Alfred Hitchcock and the Three Investigators in the Mystery of the Stuttering Parrot“
Erzählt von Robert Arthur
Erstveröffentlichung: 1964 / Random House, NY
Deutsche Ausgabe: 1972 / Franckh-Kosmos, Stuttgart
Zugrunde liegende Ausgabe: Taschenbuchausgabe 1978 / dtv
Übersetzung: Leonore Puschert
Seiten: 186
Von verschiedenen Verlagen in unterschiedlichen Bindungen erhältlich
ISBN: 3-423-07316-0 (TB / dtv)
Athans, Philip – Verheerung (Der Krieg der Spinnenkönigin 5)
„Verheerung“ von Philip Athans ist der fünfte Band des sechsteiligen AD&D-Epos „Der Krieg der Spinnenkönigin“ (War of the Spider Queen), das in deutscher Übersetzung bei |Feder & Schwert| erscheint.
Unter der Schirmherrschaft von AD&D-Altmeister R. A. Salvatore haben sechs Autoren ihr Debüt in der Serie „Die Vergessenen Reiche“ gegeben. Bei Philip Athans kann man weniger von einem Debüt sprechen: Seit Jahren ist er als Herausgeber verschiedener Bücher der „Vergessenen Reiche“ bei |Wizards of the Coast| tätig, gelegentlich hat er jedoch einige wenige Bücher selbst geschrieben, wie die in Deutschland eher unbekannten Romanfassungen der AD&D Computerspiele |Baldur’s Gate| und |Neverwinter Nights|. Athans wurde von seinen Kollegen mehrfach lobend erwähnt für seine Mithilfe in AD&D-Fragen, er hat auch das Lektorat der Serie übernommen.
_Die verschollene Göttin_
Was kann eine Gruppe von sieben bösartigen und egoistischen Drow dazu veranlassen, fast uneigennützig für ein gemeinsames Ziel Gefahren und Entbehrungen auf sich zu nehmen? Natürlich nur ein außergewöhnlicher Notstand … und dieser ist eingetreten: Lolth, die Spinnengöttin der Drow, schweigt – verwehrt ihren Priesterinnen ihre Magie und jeglichen Beistand. Die matriarchalische Herrschaftsstruktur der Drow ist gefährdet, ohne die Magie der Priesterinnen droht der Metropole Menzoberranzan die Vernichtung durch ihre zahlreichen Feinde. Aber auch abtrünnige männliche Drow sehen eine Chance, die Verhältnisse zu ihren Gunsten umzukehren, andere sinnen einfach nur auf Rache. Die Macht der Feinde der Drow ist groß, die Stadt Ched Nasad wurde bereits völlig vernichtet. Nur Gromph, der Erzmagier Menzoberranzans, könnte den Leichnam (Lich; ein untoter Magier) aus dem abtrünnigen Haus Agrach Dyrr aufhalten, dessen Verbündete (Dunkelzwerge, Tanarukk) bereits in den Straßen Menzoberranzans kämpfen.
Die bereits zerbrochene Gruppe um die Hohepriesterin Quenthel und ihren Draegloth-Diener Jeggred, bestehend aus dem Magier Pharaun, dem Waffenmeister Ryld, dem Söldner Valas Hune sowie der aus Ched Nasad entkommenen Priesterin Halisstra und ihrer Leibsklavin Danifae war bisher auf ihrer Suche nach der Göttin Lolth erfolglos.
Halisstra ist vom Glauben an Lolth abgefallen und hat sich Eilistraee, der Göttin der an die Oberfläche Faerûns zurückgekehrten Dunkelelfen, zugewandt. Zusätzlich hat sie von ihrer neuen Göttin eine schwere Aufgabe erhalten: Sie soll mit einer magischen Mondsichelklinge Lolth selbst töten! Ryld ist verwirrt von den Lehren Eilistraees und entsetzt von dem Gedanken, gegen Lolth kämpfen zu müssen, bleibt aber wegen seiner Liebe zu Halisstra bei ihr.
Quenthel und Pharaun setzen derweil ihre Reise in den Abgrund der Dämonennetze fort. An die Stelle der sonst üblichen, oft eskalierenden Reibereien ist Verzweiflung getreten, Quenthel wirkt apathisch und hoffnungslos, was insbesondere Jeggred missfällt. Das nützt Danifae für ihre Zwecke aus. Während eines Erkundungszugs mit Valas Hune gelingt es ihr zudem, sich von Halisstras Bindezauber zu befreien, ihr Leben ist nicht mehr mit ihrem verbunden – endlich kann sie Rache nehmen …
Während Gromph mit dem Lich Dyrr um sein Leben und um Menzoberranzan kämpft, eskaliert die Situation im Abyss: Jeggred macht sich auf die Jagd nach Halisstra und Ryld. Schließlich erreicht Quenthels Gruppe den Abgrund der Dämonennetze, der sich anscheinend aus dem Abyss gelöst hat und nun eine eigene Ebene bildet. Quenthel übernimmt wieder die Führung: Lolth lebt – und gewährt ihren Priesterinnen wieder ihre Macht.
_Fast am Ende der Reise_
Es ist ein seltenes Vergnügen, Drow-Priesterinnen im Freudentaumel zu erleben. Lolth lebt offensichtlich, aber warum hat sie den Abgrund der Dämonennetze aus dem Abyss gelöst, warum hat sie so lange geschwiegen? Diese Fragen bilden den Cliffhanger für den nächsten Band. Man sollte zudem nicht vergessen: Halisstra ist nach wie vor wild entschlossen, Lolth zu töten.
Athans rückt neben dieser entscheidenden, das Finale vorbereitenden Neuigkeit vorallem Gromph und Danifae in den Mittelpunkt. Die Vorbereitungen für das Magierduell um Menzoberranzan und schließlich der Kampf selbst zählen zu den Highlights des Romans. Wie Gromph sich zum Beispiel sein verlorenes Augenlicht wiederbeschaffft, ist einfach nach feinster Drow-Manier …
Einige Schnitzer aus vorherigen Romanen bügelt Athans aus, so war Danifae trotz ihrer Bindung an Halisstras Leben und ihrer langen Abwesenheit nie im Geringsten besorgt. Diese Bindung zerschlägt Athans in diesem Roman etwas beiläufig und wenig originell, aber er gibt der bisher blassen Danifae etwas mehr Charakter, sie ist sogar eine entscheidende Triebfeder der Handlung dieses Romans.
Athans hat die Handlung und die zahlreichen Kämpfe geschickter verbunden als viele seiner Kollegen, was mir sehr gut gefiel, doch gerade bei einem Kenner wie Athans sind einige Fehler einfach nicht verzeihlich: So hat Ryld als Waffenmeister von Melee-Magthere einen schwereren Stand gegen eine Riesenfaultiermutter als der Späher Valas Hune gegenüber einem uralten Drachen. Die Konzentration auf Danifae tut sowohl Pharaun als auch Quenthel nicht gut, insbesondere Pharaun wirkt nicht mehr gewitzt, sondern eher beschränkt. Die wenig überzeugende apathische Phase Quenthels erklärt sich wenigstens am Ende des Romans, wenn auch nicht zur vollständigen Zufriedenheit. Diese inkonsistenten Charakterdarstellungen – jeder Autor hob bisher eine andere Figur hervor – sind leider ein durchgehendes Problem der gesamten Serie.
Zwischen Ryld und Jeggred wird es in diesem Roman zu einem tödlichen Duell kommen, in dessen Verlauf Athans sie recht originell aus der Sicht einiger unfreiwillig in diese Auseinandersetzung hineingezogener menschlicher Holzfäller beobachten lässt. Ob Ryld den Halb-Dämon halbiert oder ob dieser, wie er es schon oft versprochen hat, Ryld das Herz herausreißen und fressen wird, möchte ich nicht verraten.
_Fazit:_ Wie alle Autoren bisher, hat auch Philip Athans den Schwerpunkt auf eine andere Figur verlagert, in diesem Fall Gromph. Die Handlung ist nach wie vor sehr actionreich und spannend, eine besondere Note konnte Athans jedoch weder der Handlung noch einer Figur geben. Seine Vorgänger hatten jeweils eine deutliche Stärke oder Schwäche; so hat Richard Lee Byers Menzoberranzan überzeugend dargestellt, während man bei Richard Baker außer einer – wenn auch überzeugenden – Kampforgie wenig geboten bekam. Athans erlaubte sich keine Extreme oder Fehler bis auf die enttäuschend beiläufige Entfernung von Danifaes Bindungszauber und den offensichtlich schwächelnden Drachen. Das Magierduell sowie der Showdown zwischen Ryld und Jeggred sind zweifelsohne die Highlights dieses Romans, ebenso wird ein vielversprechendes Finale vorbereitet. Leider schafft es auch Athans nicht, die Charaktere zumindest konsistent zum Vorgängerband darzustellen. Dennoch ist auch dieser Roman überdurchschnittlich gutes Lesefutter für Drow-Fans. Wie die ganze Reihe ist er jedoch eher Kennern der „Vergessenen Reiche“ zu empfehlen, da sie entsprechende Grundkenntnisse voraussetzt.
Weitere Besprechungen aus dieser Reihe bei |Buchwurm.info|:
[Zersetzung 183 (Band 1)
[Zerstörung 677 (Band 4)
Reinhold Eichacker – Panik
Mit einem mysteriösen dunklen Punkt im All beginnt es: Professor Earthcliffe, der kauzige aber begnadete Leiter der Michigansternwarte in New York, verliert ob der Unmöglichheit, dieses Phänomen identifizieren zu können, bald den Verstand. Erst als der junge, hoch talentierte Amateurwissenschaftler Dr. Nagel sich ihm als Assistent zur Seite stellt, gelingt des Rätsels Lösung: Ein gewaltiger Meteorit nähert sich der Erde, auf der er mit hoher Wahrscheinlichkeit einschlagen wird!
Earthcliffe fürchtet eine weltweite Massenpanik und rät zum Schweigen („Die Masse der dummen, kritiklosen Menge würde die kosmische Gefahr und Drohung gewiss nicht ertragen.“, S. 42). Doch sein skrupelloser Kollege Dr. Wepp denkt anders. Er will die Panik, um durch Aktienspekulationen ein gigantisches Vermögen zu erraffen. In einem zweiten Schritt will er sich gar zum Herrn der außer Kontrolle geratenen Welt aufschwingen.
Sein böser Plan lässt sich gut an. Die Erde verwandelt sich in einen Hexenkessel. Wepp entpuppt sich als fähiger Aufwiegler, der den Mob nach seiner Pfeife tanzen lässt. Die verzweifelten Versuche Earthcliffes und Nagels, seine Manipulationen aufzudecken, bleiben nutzlos. Von Wepp aufgehetzt, rückt die Meute gegen die Michigansternwarte vor, um die vermeintliche Stätte allen Übels und ihre Bewohner zu vernichten.
Alles wäre verloren, hätte Nagel nicht vor einiger Zeit den charismatischen deutschen Chemiker und Physiker Walter Werndt zu Hilfe gerufen. Mit Hilfe des „Falken“, seines fabelhaften Flugzeugs, könnte es möglich sein, Zeit und Ort des Meteoriteneinschlags zu ermitteln. Wepp hart auf den Fersen, versucht das kleine Forscherteam seinen Job zu tun, während die Apokalypse einsetzt …
Panik im All ist vor allem Panik auf Erden
„Panik“ ist der zweite Band der später so genannten „Walter-Werndt“-Trilogie, verfasst von Reinhold Eichacker, einem heute weitgehend unbekannten Pionier der (deutschen) Science Fiction. Die SF-Gruselmär vom außerirdischen Kometen, der auf die Erde stürzt und die Zivilisation der Menschen vernichtet, ist schon vor „Deep Impact“ oder „Armageddon“ immer wieder erzählt worden. Kometen, Meteore und Meteoriten, die Feuer sprühend vom Himmel fallen, haben seit jeher die Menschen fasziniert und in Schrecken versetzt. In der ‚modernen‘ Welt des 20. Jahrhunderts war es keineswegs anders. Als der Halleysche Komet 1912 am Himmel erschien, glaubten viele Zeitgenossen tatsächlich, das Ende der Welt werde in Gestalt seines angeblich giftgeschwängerten Schweifes über sie kommen. Reinhold Eickacker veröffentlichte „Panik“ 1922; es waren seither erst zehn Jahre verstrichen. Hier haben wir eine der Quellen offengelegt, aus denen der Verfasser schöpfte.
Panik beherrschte freilich auch die deutsche Gegenwart des Jahres 1922. Der verlorene I. Weltkrieg lag erst vier Jahre zurück, seine Folgen waren nicht ansatzweise überwunden. Zur Schmach des „Versailler Schandfriedens“ kamen die enormen Reparationszahlungen, die dem Deutschen Reich von den Siegermächten abverlangt wurden. Seit 1918 befand sich die Wirtschaft im freien Fall. Eine inflationäre Abwärtsspirale war in Gang gekommen, die das Geld praktisch wertlos werden ließ. Angesparte Guthaben und Notgroschen verfielen, der Mittelstand geriet in Not, die junge deutsche Republik bekam die Probleme nicht in den Griff.
Kriegsgewinnler und Börsenspekulanten – der Bildikone gewordene, dickwanstige Kapitalist mit Pelzmantel, Zylinder und Zigarre – schienen sich auf Kosten des braven, hilflosen Manns von der Straße zu bereichern. So schlug die Stunde für demagogische Seelenfänger à la Dr. Wepp: ‚starke Männer‘, die Besserung versprachen, unter ihnen ein gewisser Adolf Hitler, der Anno 1922 freilich noch ganz am Beginn seines verhängnisvollen Siegeszuges stand.
Gänzlich diesseitige Visionen
Diese Stimmung – der „Tanz auf dem Vulkan“, wie es schon die Zeitgenossen ausdrückten – prägt Eichackers Roman, nicht aber seine angebliche Vision von der Weltwirtschaftskrise des Jahres 1929, wie Eichacker-Jünger gern betonen. Mit Science Fiction im Sinne von technischer oder gar gesellschaftlicher Zukunftsschau hat der Verfasser ohnehin wenig am Hut. SF-Elemente werden recht wahllos in die Handlung eingestreut; sie sind Mittel zum Zweck, das Geschehen in Gang zu halten, haben mit einer gewollten und ‚seriösen‘ Projektion gegenwärtiger Zustände in eine unbekannte Zukunft nichts zu tun.
Hier sollten wir das Positive sehen: SF ist Unterhaltung, sie wird nicht von besonders klugen Menschen geschrieben – klug in dem Sinn, dass sie sehen was da kommen mag. Was ist visionär am Entwurf einer Sternwarte, die von einem Elektrozaun umgeben ist, der ungebetene Besucher kurzerhand röstet? Verblüffung weckt auch die Kunde, dass in der Michiganwarte 70 (!) Maschinengewehre bereit liegen, die vom schießkundigen Personal sehr wirksam eingesetzt werden. Ausschließlich die Handlung, wie Eichacker sie konstruiert, benötigt solche logikfreien Seltsamkeiten.
Eichackers Welt ist ansonsten eindeutig die der 1920er Jahre, der einige sacht utopische Erfindungen (Ingenieur Werndts hubschraubenähnliches Libellenflugzeug „Falke“, Professor Earthcliffes „elektrische Rechenwand“) aufgepfropft werden, während gesellschaftlich alles beim Alten geblieben ist. Gedacht und gehandelt wird ohnehin sehr gegenwärtig. Verrat, die typische Hetzjagd zwischen Gut & Böse, eine schmalzige Liebesgeschichte – diese konventionellen Bausteine sind Eichacker für seine Geschichte sehr viel wichtiger als Naturwissenschaft & Technik, deren Erkenntnisse er ungeschickt und spannungsretardierend in die Handlung einbringt.
Zumal er sich – stellvertreten durch Walter Werndt – als Anhänger der obskuren „Erdeis“-Theorie outet. Seit Ende des 19. Jahrhunderts vertrat Hanns Hörbiger (1860-1931) die These, dass die Welt geprägt sei von einem ewigen Antagonismus zwischen den mythischen Urmächten Eis und Feuer. Das All wäre demnach erfüllt von kalten und heißen Himmelskörpern, die einander anziehen, zusammenprallen, zerstören und dadurch neue Planeten erschaffen. Das ist schierer Unfug, der indes lange überlebte, zumal den Nationalsozialisten diese gewaltreiche Bild einer Schöpfung durch Zerstörung ausnehmend gut gefiel.
Macht, Sucht und Realitätsverlust
Eichacker kann nicht verbergen, dass er auf einer ähnlichen Wellenlänge liegt. Menschen fallen dem Welteis-Meteoriten sowie der durch ihn entfachten Panik in Millionenzahl zum Opfer. Das rührt ihn nicht, denn in langen Sequenzen hat er die, welche sterben, als wertlosen Pöbel deklassiert, um den es nicht schade ist. Die Katastrophe ist womöglich keine, weil primär die Tüchtigen überleben und das Pack vom Erdboden vertilgt wird. Die “neue” Welt kann so nur eine bessere werden.
Andererseits wirft Eichacker sehr wohl einen kritischen Blick auf die Manipulation der Massen. Er hat die Mechanismen, die wenige Jahre später von Joseph Goebbels zur Vollendung gebracht wurden, gut begriffen: [Wepp spricht zu der von Panik erfüllten Masse und wiegelt sie auf] „‚Nur ein Weg bleibt uns, um dem Tod zu entgehen, nur ein Weg, liebe Freunde …‘ Ein Hoffnungsschimmer erfasste die Menge: ‚Der Weg! Die Rettung! Hilf uns!‘, schrie es wild durcheinander … Wepp stand mit sprunghaft gebogenem Körper wie eine wutfletschende Katze, die mageren Arme zur Menge gestoßen. Jetzt hatte er die da unten so weit. Jetzt tobte da unten nur noch eines: die Angst, und fraß die Vernunft auf. Jetzt konnte er ihnen den Giftpfeil zuwerfen, sie waren ihm hörig. (S. 97) ‚Ich, euer Führer, rufe euch, ich helfe euch … Hinaus auf die Straße! … Mir nach! Tod den Mördern!‘“ (S. 99)
Dies wurde Anfang der 1920er Jahre geschrieben, und es sind eigentlich altbekannte Fakten über jenes seltsame, grausame Tier, in das sich der Mensch in der Masse verwandeln kann: den Mob. In Passagen wie dieser leistet Eichacker Großes. Er verbreitet echte Furcht, wenn er die Bestie Mensch entfesselt zeigt. Ähnlich eindrucksvoll schreibt er, wenn er den Aufschlag des Meteoriten schildert und ihm wahrlich apokalyptische Szenen gelingen. Von Action versteht Reinhold Eichacker etwas!
Für ein generelles Manko kann man den Verfasser nicht verantwortlich machen: Er befleißigt sich einer Sprache, die für die Entstehungszeit von „Panik“ typisch war, heute aber nur noch mühsam erträglich ist. Sie wird geprägt durch altmodisches Pathos, durch eine Bildhaftigkeit, die in ihren stakkatohaften Wortwirbeln und stummfilmhaften Übertreibungen an freies Assoziieren erinnert. Wenn sich also der böse Dr. Wepp seinem schuftigen Bundesgenossen als künftiger Weltdiktator offenbart, so klingt das bei Eichacker so: „‚Wegfegen werde ich diese Hohlköpfe alle. Tod dem, der mir trotzte!‘. Die massige Gestalt des Dicken [= Wepps Zuhörer] wankte. Mit einem röchelnden Aufschrei fiel er auf die Knie und hob die Arme zu Wepp in die Höhe. ‚Herr! Meister! Mir schwindelt! Was sind wir vor dir doch für erbärmliche Wichte!‘“ (S. 94) Das ist ein Stil, auf den sich der Leser einstellen muss; es wird nicht immer gelingen.
Figuren: Übertreibung ist alles!
Zum Thema Figurenzeichnung kann man sich nur in Molltönen äußern. Da gibt es ausschließlich holzschnitthafte Klischeegestalten, welche die Handlung verkörpern sollen. Dies lässt die Trivialität des Romans wohl am deutlichsten erkennen. Viel Zeit und Mühe scheint Eichacker in sein Werk nicht investiert zu haben, es war für den raschen ‚Verbrauch‘ bestimmt. Deshalb kocht der Autor routiniert Stereotypen wie den weltfremden aber gescheiten Professor, sein tatkräftiges, natürlich hübsches Töchterlein oder ihren mutigen Galan, der die Fäuste spielen lässt, auf.
Erst recht spät tritt als entscheidender Retter in der Not ein ‚zufällig‘ deutscher Ingenieur auf den Plan. Der gibt sich ruhig, wo ansonsten Hysterie und Übertreibung die Szene beherrschen, und zeigt den zwar tatkräftigen aber überforderten Yankees, wie ein Teutone solche Krisen zu meistern versteht. Solcher mehr oder weniger offene Hurra-Patriotismus war freilich kein deutsches ‚Privileg‘, sondern wiederum zeittypisch.
Dr. Wepp, der Bösewicht, ist wie so oft die interessanteste Gestalt der Geschichte. Ihn bewegen keine hehren, sondern nur egoistische Ziele; wahrscheinlich lässt ihn das so realistisch wirken. Später geht es mit Eichacker durch; Wepp wird vom Volksverhetzer zum Größenwahnsinnigen, der sich schließlich für Satan persönlich hält und ein lachhaft übertriebenes Ende findet; andererseits hat es auch später weitaus dämlichere Schurkenfinale gegeben, so dass man hier in der Kritik Milde walten lassen könnte.
Autor
Wer war Reinhold Eichacker? Man sollte meinen, dass diese Frage in dem durchaus vorhandenen Nachwort beantwortet wird. Stattdessen verbreitet „Michael Gallmeister, Magister der Philosophie“ jenen Schwurbel, für den seine Zunft oft kritisiert und verspottet wird. Eine Kostprobe: Über die Rolle der SF als Blick in die Zukunft heißt es u. a.: „Zum anderen können auch teils noch heute gültige Wunschbilder, Visionen erkannt werden. Welche uns über unser heutiges Sein dahingehend aufklären, das viele ökonomisch logisch und vernunftorientierte Lösungen in Wirklichkeit animalisch evolutionären Hintergrund haben, und viele anscheinend selbstverständliche Begründungen für unser Tun nur Alibi darstellen.“ (S. 155) Alles klar?
Durch Abwesenheit glänzen dagegen ein biografischer Abriss zum Verfasser und eine (literatur-) historische Einordnung des Eichackerschen Werks. Warum ist er ein Pionier des Genres? War er der einzige seiner Art? (War er nicht.) Was hat er sonst geschrieben? Ist Eichacker-SF prägend und typisch für die frühe deutsche SF? Stattdessen lesen wir: „Es handelt sich bei dem Autor Reinhold Eichacker um einen technisch interessierten Roman-Schriftsteller.“ (S. 156) Wer hätte das gedacht? Das ist kümmerlich angesichts der Tatsache, dass die Herausgeber mit der „Phantastischen Bibliothek Wetzlar“ zusammenarbeiten konnten.
Für den Laien ist es leider schwierig, wenigstens einige Infos über der Verfasser auszugraben. Immerhin steht fest, dass sich Robert Eichacker (1886 1931) schon in jungen Jahren der Literatur zuwandte. Zunächst widmete er sich der Theorie, wurde 1912 Mitglied der Deutschen Schiller-Stiftung. Wie alle tauglichen Männer seines Jahrgangs kämpfte Eichacker wenig später im I. Weltkrieg. Seine Erfahrungen prägten ihn nachhaltig; Eichacker gehörte zur Gruppe der Unzufriedenen, die sich von unpatriotischen Feiglingen verraten und verkauft fühlten. Er begann zu schreiben, und besonders seine frühen Werke zeichnen sich durch revanchistische Züge aus, das noch im ersten Band der Walter-Werndt-Trilogie sehr stark zum Tragen kommt. Inwieweit sich dies in den historische Romane, erotischen Novellen und anderen Eichacker-Werken wiederholt, mögen literaturwissenschaftliche Untersuchungen klären.
Im ersten Werndt-Band („Kampf ums Gold“, 1921) überschüttete der große Erfinder jedenfalls das verhasste Siegerland Frankreich mit Todesstrahlen und sparte auch sonst nicht mit ‚völkischem‘ Gedankengut. Ob dies in „Panik“ und 1923 in „Die Fahrt ins Nichts“ fortgesetzt wird, muss offen bleiben. Der Celero-Verlag ließ Eichackers Werke bearbeiten und allzu arge Ausfälle tilgen. (Es wäre übrigens nützlich zu wissen, wie diese ‚Bearbeitung‘ im Detail aussieht.)
Taschenbuch: 157 Seiten
Der Autor vergibt: 



Reto Wehrli – Verteufelter Heavy Metal (Erweiterte Neuausgabe)

_Der Autor:_
Reto Wehrli – Verteufelter Heavy Metal (Erweiterte Neuausgabe) weiterlesen
Catherine Aird – Schlossgeheimnisse

Catherine Aird – Schlossgeheimnisse weiterlesen
Nix, Garth – Sabriel (Das alte Königreich 1)
Garth Nix ist Fantasy-Lesern sicherlich durch den Zyklus um „Der Siebte Turm“ bekannt, welcher in den letzten Jahren beim |Dino|-Verlag erschien und sich vor allem an ein jugendliches Publikum richtete, das die Fantasy gerade erst durch Harry Potter, die „Herr der Ringe“-Filme oder entsprechende Computerspiele für sich entdeckt hatte. Jugendliche Helden wurden berufen, um ein düsteres Geheimnis zu lösen und durch die Reise erwachsen zu werden. Auch in seiner neuesten Trilogie müssen sich junge Helden bewähren.
Eine große Bannmauer trennt das Alte Königreich, in dem Magie und Zauberei noch an der Tagesordnung sind, vom technisch viel fortschrittlicheren Ancelstierre. Soldaten bewachen die Grenze, über die immer wieder freie Magie ausbricht und Schaden anrichtet, und lassen nur wenige Grenzgänger durch. Zu ihnen gehört auch Terciel Abhorsen, ein Magier und Nekromant des Alten Königreiches, der als einer der wenigen Garanten für die Sicherheit beider Reiche gilt, da das magisch begabte Herrschergeschlecht des Alten Königreichs vor ein paar Generationen ausgestorben ist.
Seine Tochter Sabriel wächst in Ancelstierre auf. In einem Mädcheninternat hat sie für das Leben wichtige Dinge gelernt und mit ihren Freundinnen viel Spaß gehabt, aber auch ihre Wurzeln nicht vergessen. So zögert sie nicht lange, als sie eine düstere Botschaft erreicht. Ihr Vater Abhorsen ist verschwunden, und an den Grenzen gehen seltsame Dinge vor sich: Die Toten versuchen nach Ancelstierre vorzudringen – es ist fast so, als würde sie eine düstere Macht kontrollieren.
Sabriel weiß, was sie nun zu tun hat. Sie lässt die Schule und ihre Kindheit hinter sich und kehrt in das Alte Königreich zurück, um ihren Vater zu retten. Sehr schnell stellt sie fest, dass sie sich noch einiges an Wissen aneignen muss, um gegen den geheimnisvollen Feind bestehen zu können, denn bei einem Überfall mächtigerer Toter verliert sie fast ihr Leben.
Dank der magischen Katze Mogget, die ihrer Familie schon viele Jahrhunderte dient, erlangt sie die ihr noch fehlenden Kenntnisse. So gerüstet, bricht sie ihrerseits auf, um den Feind herauszufordern. Doch auf dem Weg zu ihrem Ziel muss sie erkennen, dass sie nicht allein ausersehen ist, um die dunkle Macht zu brechen.
Auch der geheimnisvolle Jüngling Touchstone, der für Jahrhunderte in die Gallionsfigur eines Totenschiffes gebannt war, scheint ein Schlüssel zur Lösung des Problems zu sein, denn er ist vom Blut der alten Könige …
Die ersten Kapitel von „Sabriel“ erwecken den Eindruck, es mit einem weiteren Harry-Potter-Klon zu tun zu haben. Denn die Geschichte beginnt in einem englischen Internat, dessen Schülerinnen durchaus mit Magie vertraut sind. Garth Nix macht keinen Hehl daraus, dass Ancelstierre England irgendwann im 20. Jahrhundert ist.
Allerdings verfliegt der erste Eindruck ziemlich schnell und „Sabriel“ entwickelt sich zu einem eigenständigen Werk, das einen sehr eigenständigen Kosmos mit ungewöhnlicher Magie und fantasievoller, düsterer Atmosphäre entwickelt, die stellenweise die Dichte klassischer „Gothic Novels“ erreicht. Auch die Vermischung von Moderne und Fantasy ist gut gelungen und wirkt an keiner Stelle des Romans aufgesetzt.
Mich hat beeindruckt, wie elegant Garth Nix mit einem zwiespältigen Thema wie Nekromantie, d. h. der Totenbeschwörung, umgeht und ihre guten wie auch schlechten Seiten aufzeigt. Magie ist kein schmückendes Beiwerk, sondern das Hauptthema des Buches und nicht immer leicht zu beherrschen, wie Sabriel immer wieder lernen muss. Als Heldin ist sie angenehm normal – immer wieder wird sie in überheblichen Momenten in ihre Schranken verwiesen, kann aber auch durch Erfolge und Siege wachsen.
Auch die Nebencharaktere haben es in sich – Mogget ist nicht unbedingt das, wofür man ihn zunächst halten mag, und die Beziehung zwischen Sabriel und Touchstone bleibt bis zum Ende angenehm kitschfrei.
„Sabriel“ ist nicht nur für Jugendliche spannende Unterhaltung. Garth Nix hat ein interessantes und atmosphärisch sehr ausgereiftes Universum mit komplexer und ausbaufähiger Magie erschaffen, in eine Handlung verpackt, die immer wieder mit neuen und vor allem nicht nur vordergründigen Überraschungen aufwartet. Also Fantasy, in die man ruhig einmal einen Blick werfen sollte, wenn man der Drachen, Elfen und Zwerge einmal überdrüssig ist.
Wem die gebundene Ausgabe von |Carlsen| übrigens zu teuer ist, der kann auch auf die im April 2005 erschienene Taschenbuchausgabe von |Lübbe| zurückgreifen, die in ihrer Aufmachung dem Hardcover in nichts nachsteht, wenngleich das Titelbild dieser Ausgabe viel stimmungsvoller wirkt.
_Christel Scheja_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [X-Zine]http://www.x-zine.de/ veröffentlicht.|
Jostein Gaarder – Maya oder Das Wunder des Lebens

Philosophie oder nur leeres Wortgeplänkel, das ist hier die Frage! Handelt es sich hierbei um hochwichtige Verse oder einfach nur inhaltslose Worthülsen, die keine Bedeutung mit sich tragen, aber wichtig klingen sollen? Ich denke, beide Deutungen sind möglich, wobei ich eindeutig zur zweiten tendiere, da Gaarder mich mit seinen philosophischen Ausführungen leider nicht überzeugen kann. Mit dem Erfolg von „Sofies Welt“ gelangte der norwegische Autor zu Weltruhm, auch seine nachfolgenden Romane wie „Das Kartengeheimnis“ oder „Der Geschichtenerzähler“ verkauften sich blendend, doch in „Maya oder Das Wunder des Lebens“ verlangt Gaarder seinen Lesern mehr Geduld und Ausdauer ab denn je.
Eine Geschichte in der Geschichte
Zunächst begegnet uns der Schriftsteller John Spooke, der von seinem Zusammentreffen mit dem Evolutionsbiologen Frank Andersen auf der kleinen Fidschiinsel Taveuni berichtet. Doch schon bald wechselt die Erzählerperspektive und der Großteil des Buches ist in Form eines Briefes von Frank an seine Frau Vera geschrieben, in welchem Frank seine Erlebnisse auf der Fidschiinsel zusammenfasst und von Ana und José erzählt.
Bei Ana und José handelt es sich um ein spanisches Paar, welches Frank auf Taveuni kennenlernt, die beiden unterhalten sich untereinander stets auf Spanisch und geben dabei merkwürdige philosophische Sätze von sich. Frank, der selbst Spanisch sprechen kann, lauscht ihnen heimlich und versucht, den beiden gegenüber zu vertuschen, dass er ihren Diskussionen folgen kann. Zudem hat Frank sofort das Gefühl, dass er Ana bereits irgendwo gesehen hat, doch kann er sie bzw. ihr Gesicht nicht einordnen. Komischerweise befällt John Spooke genau das gleiche Gefühl, doch findet er bald im Internet heraus, dass Ana der Maya auf Goyas Gemälde „La Maya Desnuda“ („Die nackte Maya“) nicht nur verblüffend ähnlich sieht, sondern diese Maya sein muss. Doch wie kommt Anas Gesicht auf ein 200 Jahre altes Gemälde? Erst spät werden dem Leser mögliche Antworten auf diese seltsame Frage präsentiert.
Frank und Vera leben seit dem Unfalltod ihrer kleinen Tochter getrennt voneinander, da dieses Unglück ihre Beziehung zueinander zu sehr überschattet hat. Doch in seinem Brief richtet Frank von Beginn an eine Bitte an Vera und verlangt von ihr, bis zum Ende des Schriftstückes durchzuhalten und alles zu lesen, was er für sie aufgeschrieben hat. Dabei berichtet er von philosophischen Diskussionen auf der kleinen Insel Taveuni und auch von ausführlichen Gesprächen mit dem Gecko Gordon, der Frank vom Trinken abhalten will.
Es wird deutlich, dass Ana und José eine Schlüsselposition einnehmen und insbesondere Goyas Werk in diesem Zusammenhang zu sehen ist, auch wird Frank am Ende in den Besitz des berühmten Manifestes gelangen, welches er mit Vera teilen möchte.
Philosophisches Verwirrspiel
Erneut hat Jostein Gaarder einen sehr philosophischen Roman vorgelegt, der dem Leser viel Konzentration, Geduld und Ausdauer abverlangt. Bereits die wechselnde Erzählerperspektive von John Spooke zu Frank Andersen und später wieder zurück zu John verwirrt, da nicht sofort klar wird, wer überhaupt der Erzähler ist. Auch streut Gaarder viele Andeutungen von bereits stattgefundenen Ereignissen ein, über die Frank später berichten will, sodass man schnell den Überblick zu verlieren droht und kaum noch behalten kann, auf welche Punkte der Autor nochmals zurückkommen möchte.
Jostein Gaarder versucht kläglich, eine gewisse Erwartungshaltung beim Leser aufzubauen, indem er schon früh andeutet, dass Frank in seinem Brief eine wichtige Bitte an Vera formulieren wird, doch am Ende erweist sich dieses Anliegen als trivial und nichtssagend, sodass man sich als Leser ziemlich verschaukelt fühlt, weil man doch mehr von diesem Buch erwartet bzw. sich erhofft hat. Gaarders Intention erschließt sich selbst dem aufmerksamen Leser nicht leicht. In langen philosophischen Abhandlungen schwärmen die verschiedenen Protagonisten des Buches vom Wunder des Lebens, preisen die Vorzüge der Evolution und beschreiben in furchtbar schwülstigen Worten die Natur der Fidschiinseln.
Sprachliche Hürden
Insbesondere sprachlich ist das Buch eine echte Herausforderung. So verliert Gaarder sich oftmals in langatmigen und detaillierten Naturbeschreibungen, die sich über etliche Seiten hinziehen und auch seine philosophischen Wortergüsse verlangen dem Leser viel ab. Gaarders Worte sind schwülstig und teilweise recht kompliziert, seine Ausdrucksweise mutet deutlich selbstverliebt an und die komplizierten Satzkonstrukte tragen auch nicht gerade zum Verständnis des Buches bei. Selten erlebe ich Romane, in denen mir unbekannte Worte auftauchen, doch Gaarder schafft es häufig, dem Leser Ausdrücke zu präsentieren, die nicht dem alltäglichen Wortschatz angehören. Aus dem Zusammenhang erschließen sich die meisten Bedeutungen, doch fand ich diese wertschwangere und überladene Sprache sehr lästig, auch wenn sie wohl zum beabsichtigten Inhalt des Buches passt. Ich bin sicherlich einiges an Kitsch gewöhnt, doch überschreitet Gaarder dieses Mal selbst bei mir die Grenze des Erträglichen. Die ellenlangen Darstellungen von Flora und Fauna auf Taveuni trieften vor Schmalz und waren in schier unerträgliche Wortungetüme gekleidet.
Doch was ist eigentlich Maya? Gaarder schreibt darüber Folgendes (S. 172/173): „Aber Laura ließ sich davon nicht beeindrucken. Sie behauptete, jegliche Vielfalt sei nur ein Trug. Wenn wir jeden Tag die Welt als vielfältig erleben, dann beruhe das auf Blendwerk, auf dem, was in Indien viele Jahrtausende hindurch maya genannt worden sei. Denn nicht die äußerliche, sichtbare oder materielle Welt sei die wirkliche. Sie sei nur eine traumähnliche Illusion, zwar real genug für die, die darin gefangen seien, doch für weise Menschen sei nur brahman oder die Weltseele wirklich. Die Seele des Menschen sei identisch mit brahman, fügte sie hinzu, und erst, wenn wir das einsähen, könnten wir uns von der Illusion der äußeren Wirklichkeit befreien. Dann werde die Seele zu brahman, was sie ohne ihr eigenes Wissen ja schon die ganze Zeit gewesen sei.“
Da über die Hälfte des Buches in Form eines Briefes an Vera geschrieben ist, sind die Dialoge meist in indirekter Rede aufgeführt, was häufig zu langen Absätzen führt, durch die der Leser sich hindurch kämpfen muss. An dieser Stelle frage ich mich darüber hinaus, welche Frau einen solchen langen und schwülstigen Worterguss ihres Ehemannes lesen wird, von dem sie ohnehin getrennt lebt?!
Identifikation fehlgeschlagen
Die Figuren in diesem Roman bleiben leere Gestalten, die einzig dazu dienen, ihre Meinung über das Wunder des Lebens preiszugeben. Keine Person wird uns derart präsentiert, dass man sich ein gutes Bild von ihr machen könnte, die Figuren rücken völlig in den Hintergrund, Gaarder geht es einzig und allein um sein Manifest. Die wenigen Eigenschaften, die wir von den handelnden Charakteren erfahren, erlauben weder eine Identifikation noch führen sie dazu, dass jemand uns ans Herz wächst. Ganz im Gegenteil, die Figuren wirken unrealistisch und meist unsympathisch, besonders Ana scheint eher eine sagenumwobene Kunstfigur zu sein als ein Mensch aus Fleisch und Blut, und auch Frank kann nicht punkten. Spätestens, wenn er sich mit einem Gecko unterhält, der eines Abends auf seiner geliebten Ginflasche sitzt, beginnt man als Leser ernsthaft, sich Gedanken um den Gesundheitszustand des Erzählers zu machen. Wo dieses skurrile Zusammentreffen zwischen Mensch und Gecko anfangs noch zum Schmunzeln verleitet, so wird es doch auf Dauer immer lästiger, wenn sich selbst der Gecko an den philosophischen Abhandlungen beteiligt und seinen Standpunkt zum Besten gibt.
Was am Ende übrig bleibt
Im Gegensatz zu „Sofies Welt“, in der die schmückende Rahmengeschichte und die philosophischen Abhandlungen strikt voneinander getrennt sind (und es dem entnervten Leser schlussendlich ermöglichen, einen der beiden Handlungsstränge komplett zu überspringen), sind beide Elemente in diesem Buch eng miteinander verwoben. Zwar erzählt Frank von seinen Erlebnissen auf der kleinen exotischen Insel, doch taucht dort immer wieder das spanische Pärchen auf, das mit wichtigen Thesen nur so um sich wirft. Auch treffen sich eines Abends die Inselbesucher zu einer Diskussion um das Wunder des Lebens, die Entstehungsgeschichte, Illusionen und das Bewusstsein der Menschheit. Jede Figur steht für eine eigene Sichtweise und stellt diese lang und breit dar. Leider fehlt auch hier der rote Faden, der dem Leser zeigen könnte, wohin sich die Erzählung entwickeln wird und worauf der Autor hinausmöchte.
Am Ende bemerkt der Leser, dass Gaarder ihn an der Nase herumgeführt hat, denn Franks Brief stammt nicht aus seiner eigenen Feder, sondern aus der des Schriftstellers, der sich von Frank und dem Besuch auf Taveuni zu einem neuen Roman inspirieren ließ. Erst im Nachwort treffen beide Männer wieder zusammen und an manchen Stellen wird klar, wo im Brief Franks Realität aufhört und Johns Fiktion beginnt. Die genauen Grenzen zwischen Erdachtem und wahrem Geschehen bleiben jedoch verwaschen, es wird nicht immer deutlich, wo Johns Phantasie einsetzt und neue Dinge hinzuerfindet. Manch einer mag dies für eine besondere literarische Raffinesse halten, allerdings ist man am Ende des Buches so ausgelaugt und genervt von den Dingen, die man lesen musste, dass dies gleichgültig am Leser vorbeizieht.
Schon in „Sofies Welt“ versuchte Jostein Gaarder, die Geschichte der Philosophie in Romanform zu verpacken, sodass auch Leser ohne Vorwissen, wie zum Beispiel Kinder und Jugendliche, einen Einblick in diese Wissenschaft erhalten können. Auch „Maya oder Das Wunder des Lebens“ ist als Jugendbuch ausgewiesen, das ab 12 Jahren lesbar sein soll, doch halte ich diese Angabe der Zielgruppe für völlig verfehlt, da der Autor durch die wechselnde Erzählperspektive, die weitschweifenden Beschreibungen und die teils spezielle und komplizierte Wortwahl seine jugendlichen Leser überfordern dürfte. Während „Sofies Welt“ bei den Anfängen der Philosophie einsetzt und relativ einfach Grundzüge dieser Wissenschaft erklären soll, ist „Maya“ doch eher als eine Art Anwendung der Philosophie zu sehen, die speziell auf Fragen der Evolution und den Wert des Lebens eingeht. Diese Übertragung auf schwierigere Fragestellungen dürfte Lesern ohne Vorkenntnisse sehr schwer fallen, zumal Gaarder durch die Vermischung von Realität und Fiktion eine weitere Hürde schafft.
Gaarder scheint hochwichtige Botschaften in Romanform weitertragen zu wollen, doch scheitert er bei diesem Versuch. Sein Brückenschlag zwischen Roman und Sachbuch ist beim vorliegenden Werk völlig misslungen, da der Autor weder durch eine interessante Geschichte zu unterhalten weiß, noch philosophisches Fachwissen vermitteln kann. Lediglich viele hohle Phrasen werden ohne roten Faden aneinander gereiht, sodass der Leser Gaarders Gedankengängen nicht folgen kann. Für mich war dieses Buch der wohl letzte und abschreckendste Versuch, mit Jostein Gaarder und seinen Büchern warm zu werden.
Taschenbuch: 432 Seiten
www.dtv.de
Michael Peinkofer – Die Bruderschaft der Runen
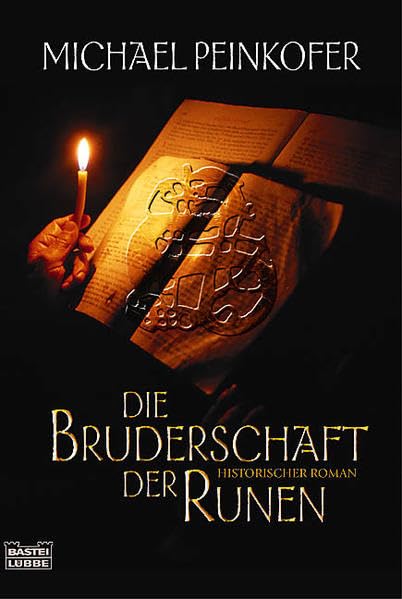
Die drei ??? und der sprechende Totenkopf (Band 5)

Die drei ??? und der sprechende Totenkopf (Band 5) weiterlesen
Andreas Eschbach – Das Marsprojekt
Carl und Elinn Faggan, Ronald Penderton und Ariana DeJones sind die einzigen Kinder der Marssiedlung. Sie sind ein eingespieltes Team, wenn es darum geht, der künstlichen Intelligenz AI-20 kleine Streiche zu spielen oder ihre Geheimnisse vor den Erwachsenen zu bewahren. Die kleine Siedlung von gut zweihundert Mitgliedern ist annähernd unabhängig von der Erde, nur gewisse Impfstoffe und Medikamente müssen regelmäßig eingeflogen werden. Die „Marskinder“ gelten auf der Erde als Berühmtheiten, auf dem Mars sind sie normale Kinder, die den Verwaltern von der Erde tierisch auf die Nerven gehen. Aber das ist nicht der Grund, warum die Siedlung geschlossen und damit die Erforschung des Mars beendet werden soll. Der Verwalter will unbedingt auf die Erde zurück, und dazu ist ihm jedes Mittel recht – auch wenn es so drastische Maßnahmen wie die Schließung der Siedlung sind. Er benutzt eine mächtige politische Strömung der Erde für seinen Antrag und argumentiert mit den laufenden Kosten der Siedlung. Nach einer Milchmädchenrechnung würde die Erdregierung fünf Milliarden Verrechnungspunkte sparen, und das ist in der momentanen Situation Grund genug, dem Antrag zu entsprechen.
Die Nachricht schlägt unter den Siedlern ein wie eine Bombe, doch die Kinder trifft es am härtesten. Sie haben die Erde nie erlebt, der Mars ist ihre Heimat. Und das Schlimmste: Unter der niedrigen Schwerkraft des Mars hat ein unbehandelter Geburtsdefekt an Elinns Lunge zu einer neuen Entwicklung geführt, wonach das Mädchen auf der Erde nicht mehr lebensfähig ist. Trotzdem soll die Schließung der Siedlung mit allen Mitteln durchgesetzt werden, und nur den Marskindern bietet sich eine winzige Chance, die Sache noch umzubiegen. Außerdem sind da noch die merkwürdigen Artefakte, bisher nur von Elinn gefunden, die daher fest an Marsianer glaubt …
Andreas Eschbach wurde 1959 in Ulm geboren, studierte in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik, arbeitete als Softwareentwickler und gründete eine kleine EDV-Firma, ehe er sich ganz dem Schreiben widmete. 2001 erschien im Arena-Verlag mit „Das Marsprojekt“ sein erstes Jugendbuch. Durch Bestseller wie „Das Jesus-Video“, „Quest“ oder „Eine Billion Dollar“ bekannt geworden, erhielt er nun die Gelegenheit, zum Marsprojekt Fortsetzungen zu schreiben. Im März 2005 erschien mit „Das Marsprojekt – Die blauen Türme“ der zweite Band der Reihe.
Offensichtlich kann Eschbach auch Jugendromane schreiben, denn dass „Das Marsprojekt“ einer ist, erkennt man auf den ersten Seiten, als Elinn in Todesgefahr gerät und die künstliche Intelligenz des Stützpunkts „AI-20“ als erstes ihren Bruder verständigt, ehe sie auf seine Anweisung richtig Alarm schlägt. Die Kinder stehen im Vordergrund, werden im Zweifelsfall von der KI unterstützt und gegen die Erwachsenen verteidigt – was Eschbach so erklärt, dass eine künstliche Intelligenz durch ihre Lernfähigkeit einige Eigenarten entwickeln kann, wenn man sie nicht regelmäßig neu kalibriert. Und das wurde bei AI-20 seit der Installation nicht getan. Uns fällt natürlich sofort die Bezeichnung „AI“ für eine KI auf – Artificial Intelligence. Ob sich hinter der 20 mehr verbirgt, bleibt ungewiss.
Die Kinder sind so charakterisiert, dass sich junge Leser schnell mit ihnen identifizieren können, jedes hat eigene Fähigkeiten und Eigenarten. Der jüngste von ihnen, Ronny, scheint ständig mit Flugsimulatoren zu spielen und meint, fast jedes fliegende Objekt der Menschheit steuern zu können. Später stellt sich heraus, dass diese Simulatoren jene Programme sind, mit denen auch die Astronauten der Erde trainieren. Ronny ist also trotz seiner Jugend ein wahrer Flugkünstler. Elinn ist ein ruhiges, etwas träumerisches Mädchen, das von seinem verstorbenen Vater oft lange Geschichten über die Marsianer gehört hat und nun von ihrer Existenz überzeugt ist. Sie ist die einzige, die diese seltsamen Artefakte aus „verunreinigtem Silizium“ findet, denn sie sieht oft ein seltsames Leuchten, mit dem sie ihrer Meinung nach die Marsianer auf sich aufmerksam machen wollen. An dem Ursprung des Leuchtens liegt immer ein kleines Stück des anscheinend vulkanischen Stoffes, der aber merkwürdigerweise sonst nicht zu finden ist. Aber auf ein Kind hört man ja nicht.
Ariana ist die Tochter des Siedlungsarztes und etwas zickig. Sie redet immer davon, wie wenig los auf dem Mars doch ist und wie gern sie zurück zur Erde will, um endlich |Jungs| kennen zu lernen. Sie ist eine Art von Gegenpart zu Carl, der als Ältester oft mit Vorschlägen aufwartet, die durch ihr Misstrauen hinausgezögert und durchdacht werden. Carl ist für einen Marsgeborenen sehr fit und kräftig, denn er will auf der Erde studieren und bei der Erforschung des Sonnensystems mitwirken, und dazu braucht man eine Muskulatur, um unter Erdschwerkraft leben zu können. Trotzdem trifft es ihn nicht weniger hart, als die Siedlung geschlossen werden soll, denn der Mars ist für ihn die wahre Heimat und er macht sich natürlich Sorgen um seine Schwester Elinn, die in ihre Idee von den Marsianern vernarrt ist und wegen des Defekts an der Lunge den Mars nicht verlassen kann.
Carl ist es auch, der die wohlprogrammierte KI zu irrationalen Handlungen bringt. Es ist eine philosophische Frage, die er ihr vorsetzt: Wenn die Siedlung geschlossen wird, wird auch AI-20 abgeschaltet. Was wäre, wenn es ein Aus für immer ist? Was bedeutet das für eine eigensinnige KI?
Der Roman ist auch für Erwachsene sehr schön zu lesen, gerade die sozialkritischen und philosophischen Fragen sind eher an sie gerichtet als an den jugendlichen Leser, für den diese Fragen aber eine Aufforderung zum Denken und Sich-Gedanken-Machen sind. Hintergründig und zurückhaltend, nicht mit moralisch erhobenem Zeigefinger, was ein Aspekt von Eschbachs Qualität ist: Er vermittelt seine Ansichten nicht plakativ, sondern versucht sie tröpfchenweise in das Bewusstsein des Lesers einzubringen.
An ein paar Stellen hat man das Gefühl, dass hier gekürzt werden musste; so wirken manchmal die Charakterisierungen der Kinder wie copy&paste-Übernahmen aus einem Datenblatt, oder die am Ende gedrängte Erzählung um die Aktivierung der „Blauen Türme“ … Vielleicht hat Eschbach hier aber auch schon auf einen Nachfolgeroman abgezielt. Und für die Marskinder hat er noch eine schockierende Überraschung parat: Der Sohn des irdischen Statthalters (ihres Gegenspielers) kommt zum Mars!
Insgesamt macht die Lektüre Spaß und Lust auf den zweiten Teil.
Taschenbuch, 304 Seiten
Der Autor vergibt: 




Marzi, Christoph – Lycidas
Das alte London war seit jeher Schauplatz von Legenden und hat ein ganz eigenes Flair. Der deutsche Autor Christoph Marzi lässt den viktorianischen Charme der Metropole in seinem Roman „Lycidas“ neu aufleben. Dabei bedient er sich freizügig bei berühmten literarischen Vorbildern: Charles Dickens‘ Waisenhaus, John Miltons Elegie „Lycidas“ sowie Neil Gaimans Idee eines „Unter-London“, einer Stadt unter der Stadt, greift er auf. Auch Rabbi Löws Golem und Jack the Ripper geben sich die Ehre … und damit sind die Querverweise auf literarisch Werke, geschichtliche Ereignisse und bekannte Autoren bei weitem nicht erschöpft.
Heldin der Geschichte ist die einäugige Emily Laing, die in dem Waisenhaus des bösartigen Reverend Dombey aufwächst. Dort spricht sie eines Tages eine Ratte an, die sich als Lord Hironymus Brewster vorstellt. Er bittet sie, auf die kleine Mara aufzupassen. Diese wird kurze Zeit später von einem Werwolf entführt, Emily selbst bekommt Ärger mit Dombey und läuft weg. Sie wird von dem etwas verdrießlichen Wittgenstein, einem Gentleman alter Schule, und seinem Freund Maurice Micklewhite aufgenommen.
Diese offenbaren ihr ungeahnte Geheimnisse über ihre Herkunft und die Welt, in der sie lebt, über Elfen und deren Wechselbälger sowie über die uralten Familien Manderley und Mushroom. So existiert unter London eine nahezu exakte Kopie der Oberstadt, in der Fabelwesen und alte Götter sich ein Stelldichein geben. Im Tower der Unterstadt residiert der mysteriöse Meister Lycidas, in dessen Auftrag zahlreiche Kinder in die Unterwelt verschleppt werden.
Dies ist nur der Auftakt eines der drei Bücher, in die „Lycidas“ (das zweite heißt „Lilith“, das dritte „Licht“) unterteilt ist. Eine gewisse Kenntnis der literarischen Vorbilder ist zwar nicht notwendig, schadet jedoch nicht. So bestimmt John Miltons Version der Schöpfungsgeschichte große Teile der Handlung; wer sie kennt, kann erahnen, wer sich hinter dem Namen „Lycidas“ verbirgt. Die große Stärke des Buches sind zweifellos das stimmungsvolle Ambiente und seine trotz zahlloser Referenzen eigenständige Storyline. Die Charaktere sind durchweg tiefgründig; kein Bösewicht ist nur böse, alle haben gute Gründe und Motive, oft entpuppen sich die vermeintlichen Schurken als menschlicher und warmherziger als einige Engel wie Uriel – ja, auch Engel hat es nach London verschlagen …
Das Buch sprüht vor Ideenreichtum und Phantasie; ein weiterer Pluspunkt ist der dem altmodischen Ambiente entsprechende Humor der Figuren. So ist besonders Wittgensteins trockene Art sehr stilvoll und amüsant, seine Lieblingsredewendung „Fragen Sie nicht!“, meist als Antwort auf Emilys bohrende Fragen, ist jedoch ein zweischneidiges Schwert und kann auf Dauer auch etwas ermüden.
Einige Schwächen lassen sich einfach nicht leugnen. So hat das Buch einen deutlichen Hänger und Spannungsabfall in der Mitte, denn der namensgebende „Lycidas“ wird bereits am Ende des ersten Buchs ausgeschaltet, um erst im späteren Handlungsverlauf wieder herausgekramt zu werden. Die folgenden zwei Bücher wurden von Marzi erst auf Bitte des Verlags geschrieben, er wollte ursprünglich erst einmal nur den ersten Teil veröffentlichen, und sie sind deutlich weniger spannend als dieser. So tritt an die Stelle einer ständig neue Elemente einführenden, flotten Handlung eine lange Zeit relativ ziellose und träge, viel zu oft wiederholt dasselbe reflektierende Erzählung. Dafür bieten diese beiden Bücher philosophische Überlegungen, die vermeintliche Engel in einem schlechten und die Übeltäter des ersten Buchs in einem sehr positiven Licht erscheinen lassen. Die Erzählperspektive ist sicher auch nicht jedermanns Geschmack: Weitgehend ist Wittgenstein der Erzähler. Jedoch werden oft Orte und Personen gewechselt, der Wechsel von Wittgenstein auf einen neutralen Erzähler und wieder zurück ist des Öfteren abrupt und verwirrend. Desweiteren verwirrt der zeitliche Aspekt: So spielt die Geschichte im modernen London, es gibt McDonald’s und sonstige Aushängeschilder unserer Zeit. Doch merkwürdigerweise sind nicht nur das Waisenhaus in Rotherhithe, sondern auch Personen wie Wittgenstein und Micklewhite komplette Anachronismen. Die Unterstadt selbst befindet sich wohl seit Ewigkeiten in einem Zustand kurz vor der industriellen Revolution. Man fragt sich, warum Marzi die aufgesetzt wirkende und selten gebrauchte Neuzeit nicht ganz gestrichen hat und stattdessen die Geschichte vollständig in dieses Zeitalter verlegt hat.
Fazit: Neue Ideen braucht das Land. Was Marzi aus alten Klassikern macht, ist wirklich bemerkenswert. Man mag sagen, er habe alles nur geklaut – aber wer es schafft, Charles Dickens‘ Waisenkinder mit der Geschichte um Jack the Ripper zu verbinden, ohne dabei ins Absurde abzugleiten, sondern vielmehr zu begeistern, der muss sich nicht verstecken. Man merkt Marzi noch eine gewisse Unerfahrenheit an, schließlich ist „Lycidas“ sein erster größerer Roman. Die Wege die er beschreitet, sind frisch und unverbraucht, so dass man über einige Haken und Ösen hinwegsehen kann. Für Winter 2005 ist bereits ein Folgeband mit den Arbeitstitel „Pequod“ geplant, die Reihe ist laut Marzi eine Trilogie. Man darf gespannt sein, ob Marzi auf Walfang geht und sich zu China Miéville ([Perdido Street Station)]http://www.buchwurm.info/book/anzeigen.php?id_book=695 nun auch noch Herman Melville gesellt … nur eines verrät der Autor: Das verschlagene Kopfgeldjägerduo Mr. Fox und Mr. Wolf wird wieder mit von der Partie sein.
Eine Leseempfehlung nicht nur für Fantasyfreunde – „Lycidas“ hat Stil, Charme und Niveau.
Homepage des Autors:
http://www.christophmarzi.de/