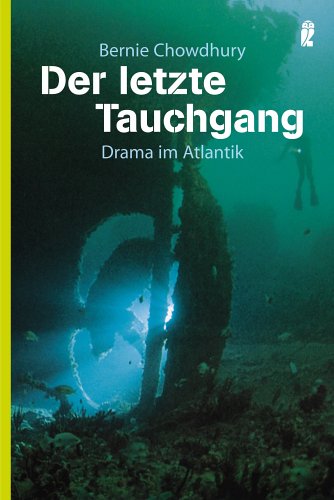
Mit an (bzw. meist über) Bord der „Seeker“ sind Chris und Chrissy Rouse, eher älterer und jüngerer Bruder als Vater und Sohn, die gerade 17 Jahre trennen. Seit vier Jahren erst tauchen sie, haben sich aber in dieser kurzen Zeit bereits einen guten Namen gemacht. Inzwischen gehören sie zur Elite der ‚technischen‘ Taucher, plätschern nicht nur in flachen Küstengewässern herum, sondern erforschen regelmäßig die düsteren Kammern ausgedehnter Unterwasserhöhlen, die weniger fähigen Zeitgenossen regelmäßig zur Todesfalle werden, und scheuen auf hoher See nicht vor Tiefen zurück, in denen der erste Fehler in der Regel der letzte ist.
Vater und Sohn sind ein eingespieltes Team, das unter Wasser Außerordentliches leistet. Chris und Chrissy sind allerdings dem Rausch der Tiefe erlegen; auf der Jagd nach Ruhm und Trophäen vom Meeresgrund gehen sie immer größere Risiken ein. Zudem gibt es erhebliche persönliche Spannungen; der ältere Rouse ist ein Pedant, dem der Sohn selten etwas recht machen kann, während der Junior mit seinen 22 Jahren noch reichlich unreif ist und darüber hinaus unter einer angeborenen Konzentrationsschwäche leidet. Das sind keine idealen Voraussetzungen für ein Leben direkt am Limit. Jetzt ist auch noch das Familiengeschäft ins Trudeln geraten, was weitere Sorgen und damit Ablenkungen verursacht, die mit auf den Meeresboden genommen werden.
Schon oft ist das Duo nur knapp einer Katastrophe entronnen. Am 12. Oktober 1992 ist sein persönlicher Glücksvorrat indes verbraucht. In der rostigen Röhre des geborstenen U-Boots setzen technische Fehler und Selbstüberschätzung eine unheilvolle Kette von Ereignissen in Gang, die diesen Tauchgang für die Rouses zu demjenigen werden lassen, den alle Sporttaucher fürchten: dem letzten …
Tja, selbst schuld, könnte man da knapp und trocken urteilen; was treiben sich die beiden auch dort herum, wo Menschen eigentlich nichts verloren haben – zumal sie wissentlich gegen Regeln verstießen, die sie genau kannten? Ist es denn ein altes Wrack wert, sein Leben aufs Spiel zu setzen? Dass die Erforschung von „U-Who?“ gefährlich ist, musste auch den Rouses klar sein, denn es hatte schon ein Taucher dort sein Leben gelassen.
Aber wie Bernie Chowdbury, Autor des vorliegenden Buches, den eingeschworenen Landratten unter seinen Lesern deutlich zu machen versteht, lassen sich Sporttaucher vom Schlage der Rouses nicht mit den Maßstäben des gesunden, aber eben gewöhnlichen Menschenverstandes messen. Auf dieser Welt gibt es Menschen, die mehr vom Leben erwarten als Planungssicherheit. Sie suchen nach ’sich selbst‘ und nach dem Sinn ihres Daseins, und offensichtlich lässt sich beides nur dort entdecken, wo es so heiß, kalt, tief, hoch oder giftig ist, dass der menschliche Körper darüber seinen Geist aufgeben kann.
Mit Logik und Vernunft kann und darf man diesen Zeitgenossen nicht kommen. Autor Chowdbury weiß dies, denn er gehört selbst zu den Tiefsee-Junkies, die vom Außergewöhnlichen nicht mehr loskommen – und sollte es sie das Leben kosten, wie er am eigenen Leibe erfahren hat, als ihn ein Tauchunfall in eine menschliche Sprudelflasche und sein Blut in Stickstoffschaum verwandelte. Doch die Moral von der Geschicht‘ wird denen, die tunlichst die Überholspur des Lebens meiden, wohl nicht schmecken: Noch auf der Bahre plagt den gelähmten, taub gewordenen, hirngeschädigten Chowdbury hauptsächlich die Angst, zukünftig nicht mehr tauchen zu können.
„Der letzte Tauchgang“ ist mehr als die Chronik eines verhängnisvollen Unglücks. Chowdbury ist bemüht, nicht nur Ereignisse zu rekonstruieren, sondern sucht und findet Wurzeln in der Geschichte des Tieftauchens. Als enger Freund der Familie Rouse kann er sein Wissen biografisch ergänzen. Allerdings hat er sichtlich Schwierigkeiten, dabei objektiv zu bleiben. Die Rouses haben ihr Ende selbst verschuldet, aber über die Toten spricht man ungern schlecht – besonders in Amerika, wo stets nur Helden fallen. Chowdbury übt immerhin vorsichtig, aber hörbar Kritik und nutzt die Gelegenheit, Auswüchse des „Technical Diving“ zu geißeln. Nötig ist dies allemal, denn wie sonst ließe sich erklären, dass etwa die Hälfte der Personen, die Chowdbury und die Rouses 1991/92 bei diversen Tauchgängen begleiteten, in den nächsten zehn Jahren selbst umgekommen sind?
Gewisse Widersprüche mag oder kann Chowdbury aber auch nicht klären. Er selbst kam bei einer seiner Expeditionen zum Wrack der „Empress of Ireland“ 1991 beinahe zu Tode. Der Grund: Er hatte ‚Souvenirs‘ – Geschirr, Schiffglocken, Bullaugen – vom Meeresboden holen wollen und in seiner Gier jegliche Vorsicht fahren lassen. Ihm spielte wie den Rouses das eigentümliche Prestigedenken amerikanischer Sporttaucher einen bösen Streich: Unter ihnen gilt als ‚Größter‘, der in seinem Heim den Tauchergenossen mit großer Geste und scheinheiligem Understatement die schönsten Trophäen präsentieren kann. Wer dann noch ein Tauchgeschäft oder ein Extremsport-Reiseunternehmen führt, ist sogar geradezu gezwungen, Totenschiffe zu fleddern, denn der US-Taucher kauft oder bucht halt am liebsten beim nachweislich tüchtigsten Wassermann. Den gern vorgeschützten Forscherdrang nimmt man den Sporttauchern deshalb nur bedingt ab. Solche Kritik sind sie allerdings gewohnt und haben sich im Laufe der Jahre aus arg konstruierten Schutzbehauptungen eine Burg gezimmert, in der sie sich sicher fühlen.
Als Autor ist Bernie Chowdbury kein völliger Neuling, aber auch kein wirklich gewandter Schriftsteller. Er schreibt schon lange über das Tauchen und ist zudem Herausgeber und Chefredakteur des US-Tauchmagazins „Immersed“. Allerdings ging es ihm bisher eher um die technischen Aspekte ’seines‘ Sports, wobei ihn natürlich regelmäßig die üblichen naturburschenmystischen Offenbarungen (auch „Messnerismen“ genannt) überkamen. Mit „Der letzte Tauchgang“ betritt Chowdbury dagegen ehrgeizig Neuland – und das merkt man.
Während ihm die Beschreibungen der einschlägigen Unterwasser-Aktionen ebenso gelungen sind wie die mehrfach eingeschobenen Abrisse zur Geschichte des Tauchens (wobei nicht mit berechtigter Kritik an Aqualung-Übervater Cousteau gespart wird), ist Chowdbury in den biografischen Teilen deutlich ungelenker. Das würde man ihm nachsehen, unterläge er nicht der Versuchung, Geschichte zu ‚inszenieren‘ und dramatischer zu gestalten. Allen Geschehnissen wird ein Unheil verkündender, aber unwahrscheinlicher Ton nahen, unausweichlichen Verhängnisses unterlegt. Chris und Chrissy sind quasi von Geburt an verdammt zum dramatischen Tod auf See. Möchte man Chowdbury Glauben schenken, war er vorher stets und mit laufendem Rekorder zur Stelle, wenn sich im Taucherleben der Rouses etwas Bedeutendes ereignete. Schlimmer: Im Nachhinein werden sie auf plumpe Weise zu Modellgestalten des „Amerikanischen Traumes“ verklärt.
Eine kleine Kostprobe? |“Chris grinste von einem Ohr zum anderen und streckte John die Hand hin. ‚Hi. Ich bin Chris Rouse. Das hier ist mein Sohn, Chrissy, und meine Frau Sue. Wollen Sie nicht vielleicht mit uns zusammen essen? Setzen Sie sich, fühlen Sie sich ganz wie zu Hause.‘ Reekie fand diesen geselligen Zeitgenossen sehr sympathisch, aber er war von Natur aus skeptisch und schloss nicht leicht mit jemandem Freundschaft. Reekie hatte auf unangenehme Weise erfahren müssen, dass sich manchmal erst in der Unterwasserwelt einer Höhle die wahre Natur eines Menschen offenbart, der einem an Land sehr nett erscheint.“| (S. 57)
Selbstverständlich bestehen die Rouses diese harte Probe mit Bravour. Wieso denn nicht, ist doch der brave Chris mit seiner Sue schon seit der Highschool zusammen (und das, obwohl sie nach Chrissys Geburt ziemlich moppelig geworden ist …) und hat nur mit seiner Hände Arbeit, einem Zahnstocher und zwei Büroklammern ein gut gehendes Baugeschäft geschaffen. Müßiggang kennt Chris nicht, er malocht, taucht, fliegt, hilft unentwegt seinen zahllosen Freunden, repariert alles, was sich bewegt, und liebt seine Familie so sehr, dass er sie auch unter Wasser stets um sich haben will und sie ohne ihr Wissen zu diversen Tauchkursen anmeldet – ein Amerikaner von echtem Schrot und Korn also.
Aber man sollte nicht ungerecht sein. Die Schattenseiten dieser Bilderbuchfamilie kann und mag auch Chowdbury nicht schönfärben. Schließlich hat es schon seine Gründe, dass erst Chris und später Chrissy zwischen sich und der Realität am liebsten mindestens fünfzig Meter Wasser sehen, wie die um Rat gefragte US-Klippschul-Psychologin weise anzumerken weiß. Trotz der formalen und inhaltlichen Schwächen (die sich auch in der z. T. sehr hölzernen Übersetzung fortsetzt) garantiert „Der letzte Tauchgang“ eine spannende Lektüre, die zudem (und wohl nicht immer freiwillig) einige ungern gehörte Wahrheiten über die Extremsportler unter uns zu verkünden weiß.
Taschenbuch: 400 Seiten
www.ullsteinbuchverlage.de
