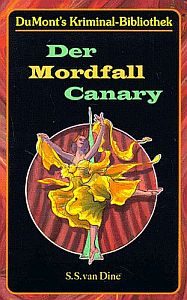
Das geschieht:
Auf dem Broadway von New York galt sie als absoluter Bühnenstar, doch nun liegt Margaret Odell, liebevoll „The Canary“ (= Kanarienvogel) genannt, brutal erdrosselt in ihrer kleinen aber luxuriösen Wohnung. Für die Presse ist dieser Mord ein Fest, für die Polizei jedoch ein Albtraum. Eine rasche Aufklärung des Falls ist geboten, weshalb Bezirksstaatsanwalt John F.-X. Markham persönlich die Ermittlungen leitet.
Wie starb der Kanarienvogel? Die Leiche wurde in einem von vergitterten Fenstern geschützten Raum entdeckt, der nur durch eine einzige, zudem fest von innen verschlossene Tür zu betreten ist. Die Wohnung wurde durchsucht und Schmuck gestohlen, was den etwas beschränkten Sergeant Heath von der Mordkommission an einen Raubmord denken lässt. Markham würde sich da gern anschließen, doch wie wurde die Tat begangen?
Zu Markhams Freunden gehört der Kunstsammler Philo Vance, ein kauziger aber hochintelligenter Mann, der dem Staatsanwalt vor einiger Zeit sehr erfolgreich in einem Mordfall beraten hat. Hilfe suchend wendet sich Markham erneut an Vance, der sich tatsächlich anheuern lässt. Den Mord betrachtet er als intellektuelle Herausforderung und sorgfältig geplantes Verbrechen, denn Miss Odell sang nicht nur, sondern erpresste gern ihre männlichen Begleiter, die sorgfältig nach gesellschaftlichem Status und Vermögen ausgesucht wurden.
Vier Verdächtige gibt es: den honorigen Fabrikanten Kenneth Spotswoode, den Pelzhändler Louis Mannix, den Lobbyisten und Nachtclub-Besitzer Charles Cleaver sowie den Modedoktor Ambroise Lindquist. Alle weisen sie hieb- und stichfeste Alibis nach, die Vances Nachforschungen nur bedingt standhalten. Die Lösung des Rätsels scheint indes an der Unmöglichkeit der Tat zu scheitern, bis Philo Vance die losen Fäden eines fast perfekten Verbrechens zu einem Knoten schnürt …
Die Macht der Täuschung
Traue deinen Augen nicht, wenn Menschen in ein Rätsel verwickelt sind, denn entweder lügen sie, oder sie irren sich. Dieses Urteil schließt nach Ansicht von Philo Vance sogar eine heilige Kuh der Kriminalistik ein: den Glauben an die Unfehlbarkeit des Indizes. „Der Mordfall Canary“ belegt prompt diese Aussage, die auch dem Krimileser recht provozierend in den Ohren klingt, gilt doch das Indiz seit Auguste Dupin und Sherlock Holmes bis heute vor allem in seiner Inkarnation als versehentlich am Tatort zurückgelassene Spur im Zweifelsfall als alles entscheidender Hinweis.
Wieso dies nicht so ist bzw. sein muss, erläutert Philo Vance einem ungläubigen John Markham im einleitenden Kapitel von „Der Mordfall Canary“. 1927 war ein Referat als Auftakt eines Kriminalromans noch möglich; die Leser ließen es sich gefallen und erwarteten sogar, dass ihnen die Regeln des sich anschließenden Spiels erläutert wurden.
Weil S. S. Van Dine zu den Autoren gehörte, die diese Regeln entscheidend mitgestalteten, galt es ihm erst recht zu lauschen. Mit dem ihm eigenen Geschick trat er denn auch umgehend den Beweis an und wählte dafür infam ein „locked room mystery“, d. h. den prinzipiell nicht möglichen Mord in einem fest verschlossenen Raum, der wenige mysteriöse und miteinander vermeintlich unvereinbare Hinweise auf den Täter enthält. In dieser Umgebung mussten sie zum Schlüssel werden.
Der lange Weg zu des Rätsels Lösung
Zunächst wiegt uns Van Dine auch in dieser Sicherheit und arbeitet brav die Liste der vorhandenen Indizien ab. Bald kommt er jedoch auf seine anfänglich geäußerte These zurück und setzt diese im zweiten Teil des Romans zu immer neuen, zunächst sehr logisch klingenden Szenarien zusammen, die sich wiederholt als Fehlinterpretationen herausstellen.
Weil der Detektiv Philo Vance heißt, reibt er dies dem armen Markham und damit auch uns Lesern allzu gern unter die Nase. Obwohl wir ihn ob seiner Überheblichkeit gern in den Hintern treten möchten, müssen wir zugeben, dass im Recht ist. Als Vance das Rätsel schließlich (und selbstverständlich im Rahmen eines großen Finales, das alle Verdächtigen an einem Ort versammelt) lüftet, erweist es sich als nicht einmal besonders kompliziert, sofern man sich nicht gar zu fest in die vorgeblichen Beweise verbissen hat.
Eine interessante Lektion lernen wir Krimifreunde auf diese Weise – und ein Lehrstück ist „Der Mordfall Canary“ tatsächlich; dafür sorgt S. S. Van Dine, der nie ein Problem damit hatte, auf sein einschlägiges Fachwissen zu pochen. Als Leser zahlt man dafür seinen Preis: Van-Dine-Krimis sind klar konstruierte Geschichten, die mit der Präzision eines Uhrwerks ablaufen. Gefühle sind Elemente des Puzzles, das mit reiner, emotionsfreier Geisteskraft zusammengesetzt wird. Keine Person in diesem Roman ist sympathisch – am wenigsten der ermittelnde Detektiv – oder weckt unser Mitgefühl. Wo Sherlock Holmes trotz seiner intellektuellen Kühle immer noch einnehmend wirkt, ist Philo Vance schier unerträglich.
Mr. Vance weiß es besser
Ein Snob sei er nicht, obwohl ihm genau dies oft vorgeworfen werde, argumentiert Anwalt Van Dine (der als fiktiver Chronist Vances Taten dokumentiert und kommentiert); Vance stehe aufgrund seiner geistigen Fähigkeiten und seines Wissens einfach auf einer höheren Stufe als die Mehrheit seiner Zeitgenossen, denen dieser Weg nach oben durch Herkunft und die Verpflichtung zu alltäglicher Brotarbeit verschlossen bleibt. So ‚begründet‘ ist es nicht Arroganz, die Vance von der Masse trennt, sondern seine eingeschränkte Möglichkeit, mit dieser zu kommunizieren.
Wenn man weiß, dass Willard Huntington Wright, der unter dem Pseudonym S. S. Van Dine schrieb, hier seiner eigenen Überzeugung Ausdruck verlieh (die er realiter auch lebte), wirkt diese Interpretation nicht gar zu verlogen. Für ein vom Alltagsschmutz nicht beflecktes Superhirn wie Philo Vance mögen seine Mitmenschen in der Tat nichts als Schachfiguren sein. Das schließt Vertraute wie Van Dine und ‚Freunde‘ wie Markham ausdrücklich ein. Selbst sie können Vance nur ein kleines Stück auf dessen geistigen Höhenflügen begleiten.
Vance ist als Masterhirn eine singuläre Erscheinung. Darüber hinaus ist er von Geburt Angehöriger der (New Yorker) Oberschicht, die in den „Mordfall Canary“ verwickelt ist. Der gemeine Polizeibeamte hat in diesem Jahr 1927 nicht das Recht, gegen Männer von Stand und Einfluss zu ermitteln. Was das bedeutet, zeigt sich im Vernehmungsstil: Markham und Vance empfangen potenzielle Verdächtige in vornehmen Clubs und fassen sie mit Glacéhandschuhen an. Berufsdieb Skeel wird hinter den dicken Mauern einer Polizeiwache ‚vernommen‘, d. h. in die Mangel genommen, bedroht und geprügelt – eine Selbstverständlichkeit, die nicht einmal das Opfer in Frage stellt.
Die gerade noch Goldenen Zwanziger
Selbstverständlich sorgt der Bezirksstaatsanwalt für den guten Ruf der prominenten Verdächtigen. Sie haben sich zwar mit dem Kanarienvogel vergnügt und sich im Urteil ihrer Klasse damit in die Gosse begeben. Deren Verdammung trifft sie jedoch nur, wenn diese Verfehlung an die Öffentlichkeit gerät; ansonsten wird stillschweigend gebilligt, dass auch feine Männer sich ihre Hörner abstoßen müssen – eine Heuchelei, für deren Ende wir den modernen Medien endlich einmal dankbar sein können.
Die Welt des Philo Vance ist in diesem Jahr 1927 bereits vom Untergang bedroht. Der ‚plebs‘ beginnt die Oberschicht zu infiltrieren. Altes Geld wird in den Strudel der Weltwirtschaftskrise von 1929 geraten, was aber nur Teil einer Entwicklung ist, die zum grundlegenden Wandel der Gesellschaftsordnung führt. Van Dine geht selbst darauf ein, als er einfließen lässt, dass wenige Jahre nach dem „Mordfall Canary“ der Stuyvesant-Club, in dem Vance und der New Yorker ‚Adel‘ unter sich bleiben können, ersatzlos einem Wolkenkratzer weichen musste; Vance verlässt die USA und geht nach Europa, wo sich sein Lebensstil noch einige Zeit länger konservieren lässt.
Der Film zum Buch
„The Canary Murder Case“ wurde schon 1928 unter der Regie von Malcolm St. Clair mit der Starbesetzung William Powell (in der Rolle des Philo Vance), Luise Brooks (Margaret Odell) und Jean Arthur (Alys La Fosse) als einer der letzten Hollywood-Stummfilme gedreht und 1929 von Frank Tuttle zu einem Tonfilm umgearbeitet. Trotz der daraus resultierenden technischen Probleme wurde der kuriose Filmhybrid zu einem großen Kinoerfolg, was die zeitgenössische Popularität der Van-Dine-Romane unterstreicht.
Autor
S. S. Van Dine wurde als Willard Huntington Wright 1888 in Charlottesville, Virginia, geboren. Unter den Kriminalschriftstellern muss er geradezu als Patrizier gelten: Er besuchte diverse Colleges und schließlich die renommierte Harvard University. Dort wurde er als bester Student in den Fächern Anthropologie und Ethnologie ausgezeichnet.
1907 wechselte Wright in die Literaturredaktion der „Los Angeles Times“. Sechs Jahre schrieb er Kritiken zu Büchern und Theaterstücken. Ab 1915 arbeitete Wright als Kunst- und Musikkritiker. In raschem Wechsel wurde er für verschiedene Zeitungen und Magazine tätig. Daneben verfasste Wright eine Reihe von Büchern über Kunst, Literatur und Musik, die in Fachkreisen als Standardwerke galten. 1916 entstand auch ein erster Roman.
1925 wurde Wright krank. Zwei Jahre ans Bett gefesselt, vertiefte er sich in das Studium sämtlicher bis dato erschienener Kriminalromane. Was er las, missfiel ihm meist und er beschloss, dem Genre höchstpersönlich Logik und Klasse einzuhauchen. Diese Fassung der Wrightschen Biografie wird immer noch gern nacherzählt; die Wahrheit ist wesentlich profaner: Der gelehrte Mann war seiner Leidenschaft für Alkohol und Drogen erlegen und darüber arbeitslos geworden. So warf er sich notgedrungen auf die leichte Muse, ohne dabei seine hohen eigenen Standards zu vergessen.
„The Benson Murder Case“ (dt. „Der Mordfall Benson“) markiert den Auftritt von Philo Vance, dem Mann, der W. H. Wright gern sein wollte. Um seine wissenschaftliche Reputation zu schützen – so streng waren die Sitten einst –, wählte er ein Pseudonym als Verfassernamen: Van Dyne war der Name seiner Großmutter mütterlicherseits.
Philo Vance schlug buchstäblich ein wie eine Bombe. Binnen kurzer Zeit war Wright saniert und konnte im Luxus leben wie sein Detektiv. Er hütete zunächst seine Identität, die schließlich doch gelüftet wurde, als Wright sich literaturwissenschaftlich dem Krimi widmete und u. a. Gebote für seine schreibenden Kollegen formulierte, die einen nachvollziehbaren Plot einforderten.
Wright schrieb insgesamt zwölf Philo Vance-Romane, die sämtlich verfilmt wurden. Auch für das Radio wurden sie bearbeitet. Seinen Reichtum genoss Wright in vollen Zügen. Als er im Jahre 1939 an einem Herzanfall starb, belief sich sein Erbe auf gerade noch 13.000 Dollar.
Taschenbuch: 310 Seiten
Originaltitel: The Canary Murder Case (New York : C. Scibner’s Sons 1927/London : Ernest Benn Limited 1927)
Übersetzung: Manfred Allié
http://www.dumont-buchverlag.de
Der Autor vergibt: 




