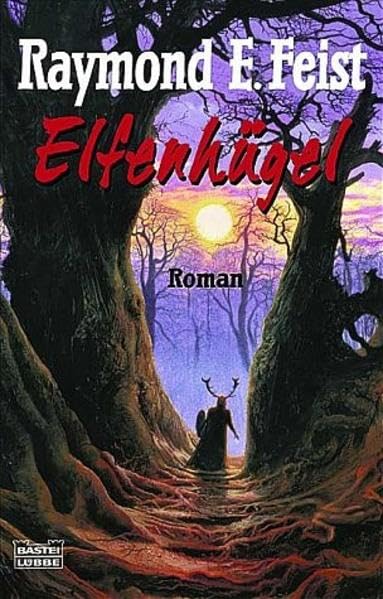Pittsville, wir kommen! – die amerikanische Bilderbuch-Familie Hastings nämlich: Vater Phil, geachteter Schriftsteller, aber des gemeinen Volkes nicht entrückt, weil außerdem Drehbuch-Autor für rabaukige Hollywood-Blockbuster; Mutter Gloria, einst Schauspielerin ebendort, aber längst Hausfrau & Mutter und glücklich am heimischen Herd, wo ihre Familie sie am liebsten sieht; Sean & Patrick, die achtjährigen Zwillinge, laut aber lieb, dem Baseball-Spiel zugeneigt und somit zwei richtige Jungens, die das Herz jedes braven Bürgers im Leibe lachen lassen, sowie Gabrielle, rollig erblühte Spät-Teenager-Tochter Phils aus einer ersten Ehe (gescheitert, weil die verworfene Ex ihre Karriere mehr liebte als die Familie, weshalb sie von ihrem Kind auch verstoßen wurde – recht so!).
Haben wir noch jemanden vergessen? Richtig! Bad Luck, der nicht besonders kluge, aber ulkige & tapfere Labrador-Familienhund, und Ernie, der Kater, komplettieren das Fleisch gewordene Quintett uramerikanischer Tugenden, das gerade in das kleine Städtchen Pittsville irgendwo dort im Staate New York gezogen ist, wo es noch ländlich und ehrlich zugeht. Phil ist des lockeren Hollywood-Daseins überdrüssig geworden (nachdem er ordentlich abkassiert hatte), besinnt sich tugendhaft auf seine schriftstellerischen Wurzeln und sucht sich ein ruhig gelegenes Haus, um dort endlich wieder ein Buch zu schreiben. Ganz wie im richtigen Leben folgt ihm die Familie freudig ins Exil, das sich als Idylle mit einem gewaltigen Haken entpuppt.
Denn es spukt tüchtig in und um Old Kessler Place, unter der alten Trollbrücke und auf dem Erlkönig-Hügel. Der alte Barney Doyle hat’s gesehen, und da er in Irland geboren ist (und deshalb einem guten Schluck nicht abgeneigt, wie ja die Iren überhaupt fröhliche, meist rothaarige Zecher sind, die gern zur Geige tanzen, wie der gute Amerikaner über dieses Volk weiß), wo die Kobolde seit jeher des Nachts über die Kartoffelfelder klabautern, weiß er sofort, was vorgeht: Die Weiße Königin der Feen hat sich mit ihrem übernatürlichen Hofstaat heuer ausgerechnet in Pittsville niedergelassen! Jeweils in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November – Happy Halloween! – schlägt dieser irgendwo auf der Welt sein Lager auf, um dort seinen übernatürlichen Geschäften nachzugehen. Weil im Geisterreich öfter mal ein Fenster zum Diesseits offen steht, stolpert immer wieder überraschtes Menschenvolk (siehe B. Doyle) in die Feenrunde, was ihm meist nicht gut bekommt.
Dieses Mal ist es sogar schlimmer als sonst, denn der trotz seines Namens eher finster gesonnene „Leuchtende Mann“, das dunkle Gegenstück zur Weißen Königin, hat das auf die Nacht beschränkte Spukdasein satt. Wie wir nach und nach erfahren, lebten Menschen und Elfen einst in wenig friedlicher Nachbarschaft auf dieser Welt, bis nach einem schrecklichen Krieg Erstere die Letzteren ins Exil (bzw. in die Märchenbücher) zwangen, das sie seither nur beschränkt verlassen dürfen. Besiegelt wurde der Vertrag durch ein Pfand – einen gewaltigen Goldschatz, der mit dem Hofstaat reist und folglich in diesem Jahr auf dem Erlkönig-Hügel verborgen wurde. Der Leuchtende Mann lenkt listig die Aufmerksamkeit der Hastings auf diesen Hort, der froh gestimmt – wer könnte es ihnen verdenken – aus dem Erdreich gebuddelt wird. Leider gilt dadurch der besagte Vertrag als gebrochen, was dem Leuchtenden Mann das Recht gibt, seine Herrschaft nunmehr auf das Diesseits auszudehnen. Unterstützt von seinem gruseligen Helfershelfer, dem Bösen Ding, aber immer noch unterworfen den Gesetzen der Feistschen Holzhammer-Dramatik, muss der böse König erst die Hastings aus dem Weg räumen, bevor ihm dies gelingen kann. Ganz souveräner Fürst der Finsternis, raschelt er zunächst Unheil verkündend im Unterholz umher, killt dann die Katze und entführt schließlich, als trotzdem niemand recht von ihm Notiz nehmen mag, einen der Zwillinge, um ihn gegen ein Wechselbalg – ein spukhaftes Ebenbild – auszutauschen. Dass man so vielleicht mit bangbüxigen Franzosen und anderen Europäern (sowie vielleicht noch Kanadiern), aber keineswegs mit echten Amerikanern umspringen kann, muss der Erlkönig auf die harte Tour lernen, als Zwilling Zwei und der erboste Vater im Geisterreich auftauchen, um ihn und seine Spießgesellen Mores zu lehren …
… und wenn sie nicht gestorben sind, dann wird es langsam Zeit, wie einst ein bekannter deutscher Komiker kalauerte, den ebenfalls die Zeit einholte und der inzwischen mindestens ebenso tot wie der Erlkönig ist. Mythen sind empfindliche Pflänzchen, die nur auf Humus, aber nicht auf Mist gedeihen. Da Raymond E. Feist den Unterschied nicht zu kennen scheint, wuchert sein „Elfenhügel“ schnell zu einem entarteten Bastard aus Instant-Fantastik, Rotkäppchen-Grusel und Seifenoper heran, der den Leser in Verdruss und Langeweile zu ersticken droht. Die Ausgangsidee ist eigentlich einfach, aber gut und entwicklungsfähig: Neu ist es zwar nicht, auf den Spuren Shakespeares zu wandeln und den „Mittsommernachtstraum“ in neuen Kulissen zu inszenieren. Feen, Elfen, Kobolde und andere Märchenwesen mit der realen Welt des inzwischen 21. Jahrhunderts zu konfrontieren, funktioniert aber immer noch – wenn man mit einem Mindestmaß Talent und Inspiration gesegnet ist. Beides geht Feist offensichtlich ab. Sollte das wundern bei einem Mann, dessen Ruhm und Ruf sich auf ein ebenso endloses wie mittelmäßiges Tolkien-Abklatsch-Fantasy-Epos namens „Midkemia“ gründet?
Dabei sind die echten fantastischen Elemente dem Verfasser noch am besten gelungen. Als das Hastings-Rollkommando das Elfenreich erreicht, merkt man Feist die Erleichterung an, wieder vertrautes literarisches Terrain erreicht zu haben. Die hier spielenden Szenen sprühen zwar ebenfalls nicht vor Originalität, aber sie überzeugen wenigstens und verraten vor allem endlich, wieso Feist ein so beliebter Autor von Unterhaltungsromanen ist. Aber bis es so weit ist, muss der Leser ein weites, bitteres Ödland durchqueren. Der „Elfenhügel“ erhebt sich nicht in der völlig dem Hier & Jetzt enthobenen Fantasy-Welt Midkemias, sondern in der realen Welt der Gegenwart (bzw. des Jahres 1988, denn so ganz taufrisch ist dieser Roman nicht mehr). Damit begibt sich Feist freiwillig aufs Glatteis, denn er muss hier, wo sich seine Leser mindestens genauso gut auskennen wie er, der Realität deutlich stärker Tribut zollen als dem Wunschdenken. Sein Unvermögen in dieser Hinsicht macht „(Der) Elfenhügel“/“Der Märchenhügel“ geradezu erschütternd offenbar.
Die Kritik muss sich noch mehr als am Plot an der Personenzeichnung entzünden. Feist ist Amerikaner; ein Punkt, den es sehr wohl zu berücksichtigen gilt, weil er erklärt, was primär den lesenden Europäer irritiert. Besonders gut lässt sich das am „deutschen“ Handlungsstrang der Geschichte erläutern. Den Elfenspuk und die Einhaltung des Friedens überwacht nämlich ein geheimer, uralter, geheimer Geheimbund freimaurerischer Tempelritter-Illuminaten. Er ist zuletzt in „Süddeutschland“ aktiv geworden, und das muss man in Anführungsstrichen schreiben, denn Feists Vision von Deutschland im Jahre 1905 ist die eines grotesk-pseudomittelalterlichen Märchenlandes, bevölkert von furchtsamen, abergläubischen Bauern, die von der in diesem Landstrich zwei Jahre nach dem ersten Motorflug der Gebrüder Wright offenbar immer noch aktiven Inquisition brutal ausgerottet werden, als sie damit beginnen, den Alten Göttern Menschenopfer zu bringen … Kommentar wohl überflüssig.
Feist hat zwar durchaus begriffen, dass es nicht so ohne Weiteres möglich ist, die Geisterwelt von der Alten in die Neue Welt zu verpflanzen; während die Menschen zu Millionen über den Großen Teich reisten, blieben die Elfen lieber in Europa. Sie wussten schon, wieso sie dies taten, denn Feist konfrontiert sie dort jetzt mit einer kaum erträglichen Bande pappiger Popanze, dem US-Kino oder -Fernsehen dort entsprungen, wo es am verlogensten ist, schrecklicher als jeder Leuchtende Mann und jedes Böse Ding: mit der amerikanischen Durchschnittsfamilie!
„Heim ist, wo das Herz ist“, heißt das Sprichwort, aber nicht nur Al Bundy selig hat es in „…, wo der Horror ist“ abgewandelt. Feist versagt spektakulär, wo Steven Spielberg und Stephen King trotz allen Kitsches regelmäßig an unser Herz rühren: in der Beschreibung jenes seltsamen, ebenso fragilen wie unverwüstlichen, schrecklichen, wunderbaren, unersetzlichen Phänomens, das wir „Familie“ nennen. Die Hastings sind keine Familie. Sie verkörpern stattdessen jenes grässliche Zerrbild (mitsamt treudoofem Hund), wie es bevorzugt konservative Politiker, reaktionäre Kirchenfürsten oder psychisch derangierte Tugendbolde propagieren. Man fiebert und bangt nicht mit den Hastings, sondern wünscht ihnen schon sehr bald einige kräftige Trolle mit scharfen Schwertern auf den Hals. Unter der Schlangenhaut aus Affenliebe und Leutseligkeit tritt eine oberflächliche, engstirnige Gesinnung und die unbarmherzige Diktatur des manisch Tüchtigen zu Tage. Wenn das Elfengold geborgen wird, bewundert man nicht seine Schönheit, sondern taxiert aufgeregt Münze für Münze nach Dollar und Cent. Phil Hastings hält gern weitschweifige Predigten gegen Hollywood-Babylon, das er zum Frommen seiner Familie und um der hehren Kunst willen verlassen hat – um im Finale fürstlich bezahlt für einen weiteren IQ-Null-Blockbuster dorthin zurückzueilen. Der zum scheußlich schäumenden Wechselbalg zitierte Wunderarzt erläutert den gebrochenen, aber zahlungskräftigen Eltern sachlich, wie sie den scheinbar wahnsinnig und damit wertlos gewordenen Sohn in einem weit entfernten Pflegeheim entsorgen können.
Solche Passagen lassen sich viele finden in diesem an Ärgernissen reichen Werk, aber den einsamen Gipfel der Lächerlichkeit erklimmt Feist mit der Schilderung eine Plänkelei zwischen Gabrielle, der überreifen Hastings-Tochter, und Puck, dem fröhlich-geilen Luft- und Lustgeist. Zweifellos als Höhepunkt knisternder Erotik gedacht, produziert der Verfasser einen schier endlosen Schwall schwülstig-verklemmter Schweinigeleien, der peinlich gekrönt wird durch den abrupten Abbruch des Liebesspiels, als es wirklich ernst wird: Im Mutterland der frömmlerischen Doppelmoral muss sich auch ein Puck mit Petting begnügen, wenn ihm ein anständiges Mädchen gegenüberliegt.
Die deutsche Ausgabe aus dem Jahre 2000 prunkt zwar mit einem für ein Taschenbuch recht pompösen Äußeren (für das man aber seinen Preis zu zahlen hat, was unter den beschriebenen Umständen doppelt schmerzt), stützt sich aber leider immer noch auf die Übersetzung der Erstausgabe von 1991 (deren Existenz im Impressum aus unerfindlichen Gründen unterschlagen wird; sie sei an dieser Stelle bzw. weiter unten enthüllt). Diese ist weniger schlampig als schlicht und ergreifend ungenügend, weil hölzern, dilettantisch und heftige Schmerzen auf dem eigentlich kurzen Weg zwischen Sehnerv und Hirn erzeugend. Der gesellt sich dann zu der schrecklichen Leere in der Geldbörse und rundet den unerfreulichen Eindruck ab, gar zu viel kostbare Lebenszeit dem Versuch geopfert zu haben, eine ziemlich taube Nuss zum Keimen zu bringen.