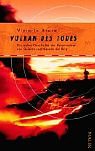Kolumbien, im Nordwesten des südamerikanischen Kontinents gelegen, gehört zu den vielen Ländern, die dem Standard-Michel beklagenswert unbekannt bleiben. Obwohl reich an Geschichte, Kultur und Natur, dringen primär die weniger schönen Dinge des kolumbianischen Lebens an die Öffentlichkeit. Die politische Realität erinnert fatal an den Verlauf des Brettspiel-Klassikers „Junta“, und wenn in den Nachrichten gerade nicht über neue Korruptionsfälle, Volksaufstände und Rebellenattacken berichtet wird, dann garantiert über Städte wie Medellin oder Cali, in denen die wahre Macht im Staate sitzt: absolut herrschende Drogenkartelle, neben denen die Mafia wie ein Kindergarten wirkt.
Die traurige Berühmtheit Kolumbiens wurde in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts durch eine Reihe von Naturkatastrophen gesteigert, die eindrucksvoll deutlich machten, dass die Bürger dieses Land nicht nur politisch auf einem Pulverfass sitzen. 30 Vulkane prägen eindrucksvoll die Landschaft, die wunderschön dort ist, wo ihr Umweltverschmutzung und Raubbau noch nicht den Garaus gemacht haben. Diese Feuerberge sind keineswegs erloschen, sondern mindestens latent aktiv. Kolumbien liegt an der Westkante der südamerikanischen Kontinentalscholle, die links von der „Nazca-Platte“ des Pazifischen Ozeans gerammt wird (1). Dadurch faltet sich an der Unfallstelle ein langsam, aber stetig wachsendes Gebirge – die nördliche Kordillere – auf. Gleichzeitig quillt glühende Lava aus dem Erdinneren hervor – mal mehr, mal weniger reichlich, und manchmal explosiv.
Im November 1985 sind ziemlich genau 140 Jahre seit dem letzten Ausbruch des 5.300 Meter hohen Nevado del Ruiz verstrichen. Dieses Ereignis wurde von den Menschen, die in seinem Schatten leben, längst aus dem kollektiven Gedächtnis gestrichen; sie haben sich emsig vermehrt und die tief eingeschnittenen Täler unterhalb des Vulkans besiedelt, in denen es sich wegen des ausgeglichenen Klimas viel besser leben lässt als in den schwülheißen Niederungen Ostkolumbiens. Ein Frühwarnsystem für Vulkanausbrüche und Erdbeben existiert nicht einmal in Ansätzen; das Geld ist knapp und wird wie in jeder Bananenrepublik, die auf sich hält, lieber auf geheimen Schweizer Bankkonten unterschlagen oder für Waffen und Protzbauten, aber ungern für Bildung und Wissenschaft ausgegeben. Niemand weiß daher die Unheil verkündenden Anzeichen zu deuten: Der Nevado del Ruiz heizt sich auf wie ein gigantischer Wasserkessel, bis er buchstäblich Dampf ablässt – und Millionen Tonnen Eis und Erde, die den Gipfel bedecken, in eine kochende Schlammlawine verwandelt, die sich – 30 Meter hoch, 80 km/h schnell – talabwärts wälzt, ganze Ortschaften unter sich begräbt und mehr als 23.000 Menschen tötet.
Jetzt ist die Aufmerksamkeit der Regierung, der Medien und der ganzen Welt geweckt. Blinder Aktionismus soll die peinlichen Versäumnisse der Vergangenheit übertünchen. Fachleute aus dem In- und Ausland werden gerufen, Gremien und Ausschüsse eingerichtet, Frühwarn- und Evakuierungspläne entworfen. Doch statt an einem Strang zu ziehen, arbeiten die Beteiligten nicht selten gegeneinander. Konkurrenzdenken und Neid sind den beteiligten Wissenschaftlern keineswegs fremd. Vor Ort sträuben sich die lokalen Politiker und Geschäftsleute gegen mögliche Einschränkungen des Fremdenverkehrs, denn der Blick in einen rumorenden Vulkanschlot gehört für die zahlungskräftigen, doch leider recht raren Touristen zu den Höhepunkten einer Kolumbien-Reise. Die bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen der Regierung, diversen Rebellengruppen und den Drogenbaronen erschweren oder verhindern zusätzlich die Umsetzung jeder Maßnahme, zu der man sich schließlich durchringen könnte.
So kommt es, wie es wohl kommen musste: Als im April 1988 der Galeras, ein weiterer Vulkan, Anzeichen einer bevorstehenden Eruption bemerken lässt, ist wiederum nichts und niemand vorbereitet. Fast fünf Jahre lässt der Berg sich Zeit – Jahre, in denen Forscher aus der gesamten Welt den Galeras untersuchen, sich streiten, warnen und einander widersprechen, bis die verwirrte Bevölkerung sich endgültig im Stich gelassen fühlt. Im Januar 1993 treffen sich die Koryphäen der Vulkanologie dann in Kolumbien zu einer Fachtagung. Als Höhepunkt steht eine Exkursion zum brodelnden Krater des Galeras auf dem Programm; das Angebot wird von den meisten Teilnehmern gern angenommen.
Es ist, als ob sich gestandene Fachleute plötzlich in ahnungslose Touristen verwandelt hätten: Männer und Frauen, die theoretisch vermeintlich alles über Vulkanismus wissen, erkennen in der Realität die Anzeichen für die unmittelbare Katastrophe nicht. Ein bizarrer Zufall will es, dass der Countdown für die Explosion des Galeras genau in dem Moment abläuft, als sich am 14. Januar 1993 die neugierigen Forscher um den Vulkankessel scharen; sie haben keine Chance. Dieses Mal geht keine Schlammlawine ab – eine vielhundertgradheiße Gas- und Aschewolke hüllt den Krater ein; wer ihr entkommt, fällt dem Hagel der Steinbrocken zum Opfer, die von der Detonation wie Schrapnellfeuer in alle Richtungen geschossen werden.
Binnen weniger Minuten kommen neun Menschen grausam zu Tode; zehn werden zum Teil schwer verletzt. Die Vulkanologie als Wissenschaft hat versagt, so denkt der Kolumbianer von der Straße. Aber auch im Ausland werden unangenehme Fragen gestellt, als sich die Überlebenden in widersprüchliche Aussagen verwickeln, denn es stellt sich heraus, dass es sehr wohl Warnungen besorgter Kollegen gab, die jedoch vorsätzlich ignoriert wurden.
Das ist in Kurzform die Geschichte, die uns Victoria Bruce im vorliegenden Sachbuch erzählt. Natürlich geht sie – selbst Geologin und nun Journalistin – wesentlich stärker ins Detail, was ihr Werk in Form und Inhalt einem dieser Wissenschafts-Thriller à la Michael „Jurassic Park“ Crichton ähneln lässt, die gerade so gern gelesen werden. Die Wirklichkeit schlägt freilich zuverlässig jede Fiktion. Dazu trägt das Thema seinen Teil bei: Die Dramatik eines Vulkanausbruchs zieht die Menschen zu allen Zeiten in den Bann.
Trotzdem lenkt der recht vordergründige (wenn nicht sogar platte) deutsche Titel die Aufmerksamkeit des Publikums in etwas falsche Bahnen. „Keine unmittelbare Gefahr“ nannte die Autorin selbst ihr Werk, und tatsächlich geht es nicht nur um Naturgewalten, sondern vor allem auch um menschliches Versagen in einer Krise. Und versagt haben sie alle, die Bruce Revue passieren lässt, und das nicht nur einmal, sondern wieder und immer wieder. Augen zu, das Beste hoffen, es wird schon nichts schief gehen – das ist ein Motto, das stets zuverlässig die größten Katastrophen einleitet. Mit deprimierender Präzision trägt Bruce die Rädchen, Federn und Wellen zusammen, die zusammengesetzt das Uhrwerk menschlicher Dummheit und Ignoranz gleich zweimal in Gang brachten. Ihre Forscher-Kollegen finden in diesem Werk den ihnen gebührenden Platz; sie treten hier nicht als selbstlose Streiter für Wissen und Weltfrieden auf, sondern als zerstrittener Haufen, der durchaus seinen Teil zum doppelten Desaster beiträgt.
Mit Schuldzuweisungen sollte man aber dennoch vorsichtig sein. Bruce stellt die Ereignisse von 1985 und 1993 auch als Produkt historischer und aktueller Prozesse dar, die in ihrer Gesamtheit ähnlich unwiderstehlich wie ein Lavastrom in eine Richtung drängen und ein Schwimmen gegen den Strom oder Ausbrüche nicht gestatten. In Südamerika gehen halt nicht nur die Uhren anders. Außerdem gilt weiterhin die schlichte Erkenntnis, dass es einfach bzw. billig ist, hinterher schlauer zu sein. Die brutale Wahrheit, die auch Bruce anspricht, ist wie gehabt, dass a) in absehbarer Zeit das Leid derer, die bei den Ausbrüchen des Nevado del Ruiz und des Galeras Familie & Freunde, Hab & Gut verloren, in Vergessenheit gerät, b) die Geologen, Vulkanologen etc. bei allem Unglück definitiv dazugelernt haben und c) sich bei einem neuerlich drohenden Ausbruch an anderer Stelle dieselbe traurige Geschichte im Großen und Ganzen wiederholen wird. (Letzteres ist allerdings die persönliche Ansicht Ihres Referenten, der strikt davon überzeugt ist, dass der Mensch nie wirklich dazulernt.)
Anmerkung:
(1) Dem geologischen Laien sei kurz beschrieben, dass die Erde auch Jahrmilliarden nach ihrer Entstehung ein Ball flüssigheißen Gesteins ist, der von einer recht dünnen Kruste bedeckt wird. Diese bildet keine geschlossene „Schale“, sondern ist in Schollen zerborsten, die auf der Lava schwimmen, bestimmten „Strömungen“ folgen und folglich an den Kanten zusammenstoßen oder sich reiben. Die Folgen sind besonders dort spektakulär, wo eine oder gar beide Schollen vom Wasser der Weltmeere bedeckt werden, da heiße Lava und kaltes Wasser zwei Elemente sind, die sich gar nicht gut vertragen.
http://www.piper-verlag.de/