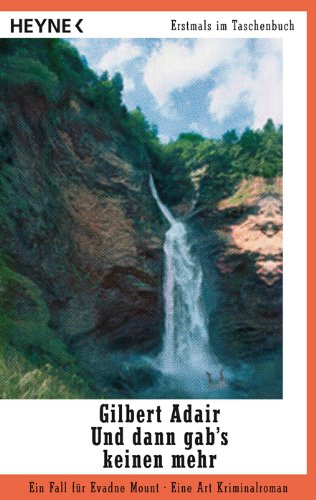Schriftsteller Gilbert Adair wird auf ein Sherlock-Holmes-Festival in den kleinen Ort Meiringen eingeladen. Dort hatte Arthur Conan Doyle 1891 vergeblich versucht, sich seines ihm verhasst gewordenen Meisterdetektivs durch einen Sturz in den nahen Reichenbachfall zu entledigen. Eigentlich will Adair nicht teilnehmen, doch Honorar und Spesen locken ihn in die Schweiz. Außerdem wird er in Meiringen vier schreibende Kollegen wiedersehen.
Die Veranstaltung wird durch das unerwartete Auftauchen eines Überraschungsgastes zur Sensation: Weil er nach der terroristischen Zerstörung des World Trade Centers 2001 nicht in das Rachegeschrei der US-amerikanischen Patrioten einstimmen wollte, sondern stattdessen schärfste Kritik am Bush-forcierten Irak-Krieg übte, setzte ein ultra-reaktionärer texanischer Milliardär ein Kopfgeld in Höhe von 100 Mio. Dollar auf den Schriftsteller Gustav Slavorigin aus. Dieser musste untertauchen und führt seitdem ein Leben auf der Flucht.
Schwer bewacht taucht er nun ausgerechnet in Meiringen auf. Hier trifft der brillante aber arrogante Mann auf alte und neue Feinde, von denen ihm einer im örtlichen Sherlock-Holmes-Museum auflauert und einen Pfeil in die Brust schießt. Während die Polizei an die Tat eines Kopfgeldjägers glaubt, ermittelt die Krimi-Autorin und Hobby-Detektivin Evadne Mount, die ebenfalls in Meiringen zu Gast ist, in eine andere Richtung: Sie vermutet den Täter unter den eingeladenen Schriftstellern!
Adair muss zugeben, dass Mount richtig liegen könnte, denn Slavorigin hat sich nicht nur durch seinen Anti-Amerikanismus verhasst gemacht. Alle Teilnehmer des Festivals hatten ihr Hühnchen mit ihm zu rupfen, und der Mörder will keineswegs für seine Tat büßen, wie Mount zu ihrem körperlichen Nachteil erfahren muss …
Kriminelles Spiel mit Schein und Wirklichkeit
2006 war der Schotte Gilbert Adair ein durchaus bekannter und prominenter aber nicht populärer und berühmter Schriftsteller. Dies änderte sich ausgerechnet (jedoch von ihm nicht unerwartet), als er die Gefilde der Hoch-Literatur verließ, um einen Kriminalroman zu schreiben – keinen ‚normalen‘ Thriller allerdings, sondern ausgerechnet einen Rätsel-Krimi im Agatha-Christie-Stil. Nicht die Handlung stand für Adair im Vordergrund, sondern die spielerische aber präzise Auseinandersetzung mit einem Genre, das schon in seiner großen Zeit in seinen eigenen Formeln und Regeln erstarrt war.
Agatha Christie musste das Vorbild sein, weil sie weiterhin die „queen of crime“ ist, deren Werke weltweit bekannt sind bzw. die quasi synonym für den „Whodunit“ stehen. Dass sie eher Handwerkerin als geniale Künstlerin war, ist weder eine überraschende noch eine sensationelle Entdeckung. Christie wusste sehr gut um die Mechanismen der Spannung, die sie vielfach variiert immer wieder zum Einsatz brachte; nur eine gewisse Arbeitsökonomie ermöglicht es, über ein halbes Jahrhundert immer ‚neue‘ Bestseller vorzulegen.
Insofern diente Adair „The Act of Roger Murgatroyd” (dt. „Mord auf ffolkes Manor”) der ihm selbst gestellte literarische Auftrag eher als Feigenblatt. Die Mehrzahl der Leser interessierte sein aufklärerisches Motiv denn auch nicht. Sie freuten sich über einen Krimi alten Stils, der perfekt die Vorgabe aufgriff, sich jegliche Modernität (scheinbar) verkniff, und sie selig in Krimi-Nostalgie schwelgen ließ. Gilbert Adair, zwar ein Literat, aber auch nur ein Mensch, legte schon 2007 mit „A Mysterious Affair of Style“ (dt. „Ein stilvoller Mord in Elstree”) nach. Erst dann begannen ihn Skrupel zu plagen, weshalb er beschloss, die peinlich erfolgreiche Evadne Mount zurück in den Orkus der Trivialität zu stürzen – und dies buchstäblich!
Das Spiel mit dem Spiel
„And Then There Was No One“ (dt. „Und dann gab’s keinen mehr“) ist Adairs Versuch, sich dem Phänomen Evadne Mount zu nähern, nachdem es sich zu seiner Verblüffung selbstständig gemacht hat. Der Krimi-Plot ist nur noch Vorwand für eine Reflexion, die oft vergnüglich aber auch geschwätzig ist. Vor allem kann Adair nie wirklich deutlich machen, was ihn dazu treibt, sich für seine beiden Erfolgsromane quasi zu entschuldigen. (Allerdings sollte man Adair in seinem Bemühen nicht allzu ernst nehmen; er treibt mit den Literaten ebenso gern seine Scherze wie mit dem krimifreundlichen Fußvolk.)
Man könnte auch sagen, dass Adair den Teufel mit Beelzebub bzw. Sherlock Holmes austreiben möchte. Wie Arthur Conan Doyle wählt er den Reichenbachfall in der Schweiz als Ort der finalen Abrechnung zwischen Detektiv und Mörder. Dass diese klassische Auseinandersetzung völlig anders als erwartet oder krimiüblich abläuft, dürfte angesichts des bisher bereits Gesagten kaum überraschen. Man könnte sicherlich auch sagen, dass Adair mit voller Absicht den letzten Nagel in jenem Sarg treibt, den er für Evadne Mount gezimmert hat.
Das eigentliche Vergnügen soll der Leser dieses Mal nicht auf der Ebene des Kriminalromans finden. Schon die beiden ersten Mount-Romane waren Spiele mit dem Genre. Nun geht Adair einen Schritt weiter und treibt sein Spiel mit dem Spiel. Formal ist ihm dies gelungen, inhaltlich eher nicht.
Kunst der Verwirrung/Kunst ist Verwirrung
Schon dass Adair selbst zum Ich-Erzähler avanciert, dürfte den Leser irritieren. Daraus könnte Ärger dort entstehen, wo Adair die Mount-Ebene vollständig verlässt bzw. sie missbraucht, um gänzlich Krimifremdes zu thematisieren. So scheint ihn stark die Frage zu beschäftigen, wie sich der Sturz der Twin Towers in den zehn Jahren nach 2001 im kollektiven Gedächtnis der angelsächsischen Menschheit verankert und verändert hat. Für die Krimi-Handlung ist dies unerheblich. Adair treibt einmal mehr literarisch postmoderne Scherze, indem er die Schranke zwischen Fiktion und Realität auflöst und mit beiden Ebenen spielt.
Dies gibt ihm offenbar das Recht, die Handlung mit einer ausführlichen bis endlos langen Biografie des Schriftstellers Gustav Slavorigin einzuleiten, die für das Geschehen ebenfalls bedeutungslos ist. Auch zwischendurch setzt Adair die Handlung gern aus, indem er beispielsweise eine Sherlock-Holmes-Geschichte erzählt – sehr hübsch, an dieser Stelle fehl am Platz aber zweifellos sehr symbolträchtig.
Die Barriere zwischen Leser und Roman soll um jeden Preis durchbrochen werden. Deshalb lässt Adair die bisher definitiv fiktive Evadne Mount ‚real‘ werden. Bisher ist sie ganz klassisch in den Jahrzehnten vor und nach dem Zweiten Weltkrieg aktiv gewesen. Plötzlich erscheint sie in der Schweiz des Jahres 2011, wo sie – der Autor spricht es selbst aus – inzwischen mindestens 120 Jahre alt sein müsste, tatsächlich aber nicht gealtert ist. Auf diese Weise macht Adair auch noch dem dümmsten (oder auf einen ‚richtigen‘ Rätsel-Krimi hoffenden) Leser klar, dass es dieses Mal nicht wirklich um einen eigentlich unmöglichen Mord geht.
Zwischen den Zeilen lesen
Das Changieren zwischen Realität und Fiktion gleicht dem Tanz auf einem Seil. Mehrfach gerät Adair ins Straucheln, indem er die Langmut seiner Leser überstrapaziert: Manches originell gemeinte Gedankenspiel ist schlicht uninteressant bzw. uninteressanter als ein mechanisch entwickelter aber unterhaltsamer Kriminalroman.
Bewundern darf man Adair dafür, dass er höchstens einmal abstürzt; dies freilich ausgerechnet im Finale. Offenbar fand er für seine Geschichte kein zufriedenstellendes Ende und inszenierte es schließlich als „big crunch“, der das Evadne-Mount-Universum in sich zusammenstürzen lässt. „Und dann gab’s keinen mehr“, heißt es abschließend sehr richtig mit einer letzten ironischen Anspielung auf Agatha Christie, deren Roman-Klassiker „Ten Little Niggers“ (1939; dt. „Zehn kleine Negerlein“) politisch korrekt als „And Then There Were None“ neu betitelt wurde.
Obwohl sich „Und dann gab’s keinen mehr“ wie ein literarisches Testament lesen lässt, hatte der Autor sein Buch sicherlich nicht als solches konzipiert. 2008 war Gilbert Adair gerade 64 Jahre alt und ahnte nichts von dem Schlaganfall, der ihn Ende 2010 traf, erblinden und im Dezember 2011 an einer Hirnblutung sterben ließ. Zufällig wurde „Und dann …“ deshalb sein nur bedingt gelungenes Vermächtnis. Es legt indes Zeugnis von Adairs beachtlicher Eloquenz ab, die ein ihm viele Jahre verbundener Übersetzer – der sich seinerseits auf einer weiteren Ebene über die Fußnoten ins Geschehen einmischt – fabelhaft in die deutsche Sprache überträgt.
Deutschland war Adair wichtig, denn hier, wo man Agatha Christie womöglich noch höher schätzt als in ihrer Heimat, wurden seine Evadne-Mount-Krimis besonders erfreut gelesen. „Und dann …“ erschien hierzulande sogar früher als in England, was auf eine gewisse Erwartungshaltung schließen lässt. Die wurde – oft recht bitter, wie kritische Leserstimmen verraten – enttäuscht, obwohl durch den Untertitel („Eine Art Kriminalroman“) vorgewarnt wurde.
Autor
Gilbert Adair wurde am 29. Dezember 1944 im schottischen Kilmarnock geboren. Er war Schriftsteller und Dichter, aber als Journalist und Filmkritiker auch mit den Niederungen der Kunst vertraut. 1995 meisterte Adair – der zwischen 1968 und 1980 in Paris gelebt hatte – eine besondere Herausforderung: Er übersetzte Georges Perecs Roman „La Disparation“. Der Verfasser hatte es geschrieben, ohne den Buchstaben E zu verwenden. Adair übertrug es genauso ins Englische (und wurde dafür mit dem „Scott Moncrieff Translation Prize“ ausgezeichnet).
Adair schrieb Drehbücher für verschiedene Filme; so inszenierte Bernardo Bertolucci 2003 „The Dreamer“ (dt. „Die Träumer“). Mehrfach arbeitete Adair mit dem Regisseur Raúl Ruiz zusammen. Er schrieb seinen 1990 erschienenen Roman „Love and Death on Long Island“ (dt. „Liebestod auf Long Island“) als Theaterstück um, als ihn ein Schlaganfall traf. Obwohl erblindet, setzte der Autor seine Arbeit fort, bis er den Folgen seiner Krankheit am 8. Dezember 2011 endgültig erlag.
Taschenbuch: 272 Seiten
Originaltitel: And Then There Was No One (London : Faber & Faber 2009)
Übersetzung: Jochen Schimmang
www.heyne-verlag.de
Der Autor vergibt: