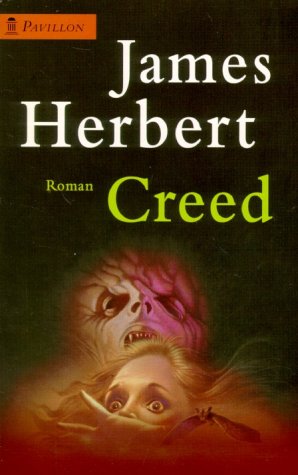Als ich „Creed“ kaufte, sagte mir der Name James Herbert genau gar nichts. Dabei soll der 1943 in London geborene Autor der meist gelesene Horror-Schreiber auf der britischen Insel sein. Herbert studierte vor seiner schriftstellerischen Karriere Grafikdesign mit Schwerpunkt Werbung am Horsey College of Art, arbeitete nach erfolgreichem Abschluss für verschiedene Werbeagenturen und wurde 1971 Direktor einer solchen. Er schrieb insgesamt acht Romane, bevor er mit „Moon“ den Durchbruch schaffte. Dieses katapultierte sich sofort in die Bestsellerlisten Großbritanniens und war auch das erste seiner Bücher, das in Deutschland erschien. Inzwischen erreichen seine Romane eine Auflage von über 30 Millionen Exemplaren weltweit und Herbert gilt als der englische Stephen King.
Herbert suchte sich für „Creed“ einen Helden, der alles andere als ein Held ist. Genauer gesagt ist Joseph Creed „ein Kotzbrocken ersten Ranges – in Anbetracht seines Gewerbes vielleicht sogar höchsten Ranges“, so sein Erfinder. Creed ist ein Paparazzo, und zwar einer der schlimmsten Sorte, aber auch einer der erfolgreichsten, mitunter ein Grund für seine Unbeliebtheit bei seinen Kollegen (bei seinen Opfern sowieso). Und diesen so ganz und gar unsympathischen Herrn lernen wir bei seinem neuesten Einsatzort kennen: auf dem Friedhof. Das Begräbnis von Lily Neverless, eine wegen ihrer schlechten Leistungen verehrte Schauspielerin, ist für Creed eher einer der langweiligeren Routineaufträge. Als er jedoch nach dem beendeten Zeremoniell einen masturbierenden Mann auf die Kamera bannt, beginnt sein Alptraum.
Zuerst lernt er Cally McNally kennen, die sich unter fadenscheinigen Begründungen an ihn dranhängt. In der Nacht bricht Dracula bei ihm ein – zumindestens ein Etwas, das wie Dracula aussieht – und stiehlt die Fotoabzüge. Creed holt sich eine Beule, weil er vor Schock die Treppe herunterfällt, und als er blutsaugende Spinnen in seinem Bett findet, die spurlos wieder verschwinden, und seine Toilettenschüssel zu einem gefrässigen Maul mit scharfen Zähnen mutiert, glaubt er zunächst an eine Gehirnerschütterung. Er macht sich neue Abzüge der Fotos, die allerdings nach einem Besuch von McNally wieder verschwunden sind, und eine Nachricht macht ihm deutlich, dass er besser auch die Negative herausrücken sollte.
Creeds Recherche ergibt, dass der besagte Mann am Grab, Nicholas Mallik mit Namen, vor über fünfzig Jahren gehängt wurde und die „Bestie von Belgravia“ genannt wurde, weil er Kinder ermordet und zerstückelt hatte. Außerdem war er mit Aleister Crowley im Bunde gewesen, dem berühmt-berüchtigten Schwarzmagier. Creed riecht eine Sensationsstory, die ihm zu Ruhm und mächtig viel Geld verhelfen wird, und genau zu diesem ungünstigen Zeitpunkt schickt seine Ex-Frau Evelyne seinen Sohn Samuel zu ihm, damit er die Vaterfreuden genießen kann. Den Sohnemann halbwegs versorgt, macht Creed einen Treffpunkt für die Übergabe der Fotos mit McNally aus. Mitten in der Nacht und in einem leeren Park, wo ihn nicht das Mädchen, sondern Mallik und sein Vampir erwarten – und Bäume, die sich bewegen. Den beiden Monstern knapp entkommen, muss er zu Hause feststellen, dass Samuel verschwunden ist.
„Dämonen sind heutzutage ein erbärmlicher Haufen“ lautet die Widmung des Buches, und da muss ich dem Autor aus vollem Herzen zustimmen – zumindestens, was seine eigenen Dämonen angeht. Das will ich gar nicht mal im negativen Sinne meinen, denn „Creed“ ist unglaublich unterhaltsam, und die Dämonen sind tatsächlich eher von der amüsanten denn der gruseligen Art (obwohl ich skeptisch bin, dass der Autor das beabsichtigt hatte). Die Schauplätze sind Friedhöfe, alte Gemäuer, verlassene Parkanlagen, ein dubioses Altersheim, und natürlich spielt alles nachts – also Standardvoraussetzungen für einen Horrorroman. Aber das ist es ja auch nicht, was „Creed“ lesenswert macht, sondern die Art und Weise, wie Herbert seinen Antihelden von einer dummen Situation in die nächste rennen lässt; wie er die Story unterbricht, um dem Leser, den er auch direkt anspricht, Nebensächlichkeiten und Zusatzerklärungen nahe zu bringen; wie er seinen Protagonisten analysiert, entschuldigt und niedermacht. Irgendwie tut einem dieser so unnette Zeitgenosse dann doch leid. Herberts Vergnügen, so gut wie alle seine Charaktere zuerst von der schlechtesten Seite zu beleuchten, springt vom ersten Satz an auf den Leser über. Zugegeben, seine Detailfreude ist zwar manchmal etwas zu überschwenglich, aber der unterschwellige Zynismus macht alles wieder wett.
Herbert erfindet im Horror-Bereich nicht unbedingt Neues und auch die Story ist meistens vorhersehbar, trotz allem bringt „Creed“ jede Menge Spaß.
Leseprobe:
„Manche Leute weigern sich zu glauben, was ihre eigenen Augen ihnen gezeigt haben. Gewöhnlich liegt es daran, dass sie nicht glauben wollen. Man mag es der Unwissenheit, dem Vorurteil, der Realitätsblindheit oder den Rätseln des Lebens selbst zuschreiben. Es kann auch viel mit der Unfähigkeit zu tun haben, die Unerfreulichkeiten der Welt, in der wir leben, zu bewältigen. Das kommt nicht nur beim Individuum vor. Noch verbreiteter ist es wahrscheinlich bei den Massen, und bei bestimmten Völkern kann es vorherrschende Züge annehmen (obwohl wir hier keiner bestimmten Nation etwas nachsagen wollen, denn niemand von uns hat das Urheberrecht auf den klaren Blick). Damit wir nicht zu tief hineingeraten und allzu deprimiert werden, bleiben wir lieber bei Joe Creed.
Nun können wir ihm wahrhaftig nicht zum Vorwurf machen, dass er nicht glauben mochte, was seine Augen ihm in jener Nacht gezeigt hatten. Im kalten Licht des Morgens neigt die Vernunft dazu, ihr zudringliches Haupt zu erheben. Und außerdem, wenn einer meint, er habe einen Vampir gesehen, besonders, wenn er nicht in der finster höflichen Maske erschien, wie wir sie von Christopher Lee oder Louis Jourdan kennen, noch in der komisch-teigigen Erscheinungsform Bela Lugosis, dann liegt es nahe, dass man vernünftig mit sich zu Rate geht und zu einer Regelung kommt, die einen Nervenzusammenbruch verhüten kann.
Sehen Sie, der ursprüngliche Nosferatu/Dracula war die wahre Schreckensgestalt. Geschaffen von Friedrich Wilhelm Murnau für seinen 1922 gedrehten Film Nosferatu, eine Symphonie des Grauens und in den Grundzügen übernommen von Bram Stokers Dracula, erschien der Vampir als ein rattenähnliches Geschöpf, mit vergrößertem Kahlkopf, langen dünnen Nagezähnen in der Mitte des Mundes (im Gegensatz zu den vergrößerten Eckzähnen späterer Filme) und gekrümmten langen Fingernägeln, die Raubvogelkrallen ähnelten. Um das grässliche Bild zu vervollständigen, war der Mann bucklig und stand auf spindeldürren, krummen Beinen. Das war der echte Artikel, der Typ, dem man nie auf der Straße zu begegnen hofft, geschweige denn allein und mitten in der Nacht. Ein Abbild völliger Widerwärtigkeit.
So war Creed nicht allzusehr zu tadeln, wenn er annahm (oder sich selbst glauben machte), dass es ein böser Traum gewesen sei. Der Einbruch selbst war freilich nicht zu leugnen, und das war ein Kapitel für sich, denn der Eindringling hatte kaum etwas mitgehen lassen. Keine Wertgegenstände, kein Bargeld, keine Foto-, Hifi- oder Videoausrüstung. Nur belichtete Filmstreifen und ein paar Abzüge. Wenn Creed im Erraten des Motivs langsamer war als Sie, dann war ihm auch das schwerlich zum Vorwurf zu machen. Als Unbeteiligter und Außenstehender ist es gewöhnlich viel einfacher, die Antworten zu sehen.“
Homepage des Autors: http://www.james-herbert.co.uk