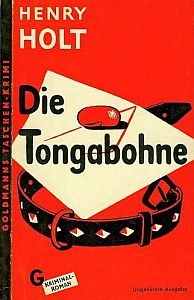
Das geschieht:
Im Verlauf einer Reise bietet Lebemann Peter Langley der schönen Auriel Maxwell galant seine Hilfe an, die wenig später in Anspruch genommen wird: Lorrimer Cranston, Auriels väterlicher Freund und Reisebegleiter, fiel einem Messer-Mord zum Opfer. Verschreckt flüchtete Auriel, die unter vagem Tatverdacht steht, nach Pinelands, dem Familiensitz in der englischen Grafschaft Surrey.
Scotland Yard überträgt Inspektor James Silver den Fall. Der erfahrene Polizist hat nichts gegen Unterstützung einzuwenden, weshalb er nicht nur Langley, sondern auch den Gerichtsreporter Andrew Collington in Pinelands duldet. Von Auriel hören die drei Männer folgende sonderbare Geschichte: Seit einiger Zeit werden ihr anonyme Briefe geschickt. Der Absender fordert die Zahlung von 500 Pfund, die angeblich Donald Maxwell, Auriels verstorbener Vater, ihm schuldig geblieben sei. Jedem Schreiben liegt ein feuerroter Samen der giftigen Tongabohne bei. Diese gedeiht in Südafrika, wo Donald einst sein Vermögen als Goldgräber machte, was wiederum den Verdacht auf Septimus Rowland lenkt, den glücklosen Vorbesitzer dieser Goldmine, der sich als Nachbar der Maxwells in Surrey niedergelassen hat. Sollte Auriel vor ihm sterben, geht das Maxwell-Vermögen an Septimus; so hat Donald testamentarisch entschieden.
Silver lässt sämtliche Freunde, die von Auriels Reise mit Cranston wussten, nach Pinelands einladen. Somit müsste sich auch der Mörder dort einfinden. Damit liegt er richtig: Auf Auriel wird ein Mordanschlag verübt, der in letzter Sekunde vereitelt werden kann. Weniger Glück hat Kenneth Rowland, Septimus‘ Lieblingssohn, der in seiner Tankstelle erschlagen wird. Neue Verdächtige tauchen auf, aber Silver folgt unbeirrt seiner Spürnase, die eine alte Familientragödie wittert, und rekonstruiert Stück für Stück einen gänzlich unerwarteten Tathergang …
Der Detektiv als Abenteurer
Schon Anfang der 1930er Jahre gab es Krimi-Freunde, die sich nicht bzw. nicht ausschließlich mit der findigen Auflösung möglichst verwickelter Übeltaten anfreunden konnten. Gedankenarbeit ist gut und schön, aber wirkt sie nicht spannender, wenn farbenfrohe Gestalten und – noch wichtiger – turbulente Action-Szenen sie ergänzen? Der Purist und vor allem der Literaturkritiker werden dies verneinen, aber sie vertreten nicht den generellen Lesergeschmack. Deshalb gab (und gibt) es Autoren, die den Spagat zwischen Sessel und Sportwagen wagen. Dass sie erfolgreich sein können, zeigen die Karrieren von Edgar Wallace, E. Phillips Oppenheim, Victor Gunn – oder Henry Holt.
Schon Arthur Conan Doyle hatte seinen Sherlock Holmes in Situationen verwickelt, in denen das Überleben nicht von Hirnschmalz, sondern von einem Fausthieb oder einem gut gezielten Schuss aus Watsons Revolver abhing. Dieser Aspekt fand vor allem in jenen Kriminalgeschichten Anklang, die als „Penny Dreadfuls“ – die zeitgenössischen Groschenhefte – oder in den „Pulp“-Magazinen veröffentlicht wurden. Hier stand die abenteuerliche Unterhaltung im Vordergrund, weshalb die Spannungskurve in Wellen verlief: In regelmäßigen Abständen musste sich etwas Unerwartetes, Überraschendes, eben Spannendes ereignen.
Geschwindigkeit statt Logik
Weniger wichtig war die Eleganz des Plots. Dies belegt Holt im hier besprochenen Roman mit unerfreulicher Deutlichkeit: Nachdem der Schurke im Verlauf einer (aufgrund der zeitgenössischen Technik heute eher drolligen als) rasanten Autoverfolgungsjagd endlich gefasst wird, benötigt Inspektor Silver vor dem Wörtchen „Ende“ viele eng bedruckte, absatzlose Seiten, um dem Leser zu erläutern, was zuvor eigentlich geschehen ist.
Den Versuch des sportlichen Mitratens kann sich der Leser sparen. „Die Tongabohne“ benutzt zwar Elemente des „Whodunits“, ohne diese jedoch genreüblich einzusetzen. So lässt Holt Inspektor Silver unter großem Aufwand und Getöse noch vor Seite 100 sämtliche Mordverdächtige in Pinelands zusammenführen. Sie werden aufgelistet und vorgestellt, und wir erfahren, was sie wo zum Zeitpunkt des genannten Mordes getan haben. Der „Whodunit“-Ermittler würde sich auf diesen Kreis konzentrieren und selbstverständlich hier seinen Täter finden.
Holt bricht jedoch mit dieser Tradition und der bis dahin entwickelten Handlung. Plötzlich befinden wir uns nicht mehr im ländlichen Surrey, sondern mitten in London und in einem Gangsterkrieg. Lange sind es die heute eher komischen als nervenkitzelnden Blicke hinter die Kulissen der zeitgenössischen Verbrechens, die das Publikum bei der Stange und bei der Lektüre halten. Der Leser ist verwirrt, denn Holt schlägt einen etwas zu weiten Bogen: Wie passt dies zur Vorgeschichte?
Verbrecher-Alltag in einer gemütlicheren Welt
Ganoven sind auch nur Menschen. In „Die Tongabohne“ leben sie in beinahe friedlicher Nachbarschaft mit der Polizei. Sie sind ähnlich wie die Beamten an ihren ‚Uniformen‘ erkennbar; wer beispielsweise professionell sein Geld durch Pferdewetten und Wettbetrug verdient, trägt grell gemusterte Anzüge und viel zu schicke Hüte.
Solange sie sich friedlich verhalten, lässt das Gesetz die Strolche in Frieden. Schlagen sie über die Stränge, indem sie morden oder sich gar am Hab und Gut gehobener Gesellschaftsschichten vergreifen, kommt die Polizei allerdings über sie. Dabei bedient sie sich gern realitätsferner aber spannender Methoden; so verkleidet sich ein besonders vom Geiste Sherlock Holmes‘ beseelter Beamter als Seemann auf Landurlaub oder blinder Bettler, um Verdächtige zu überwachen.
Die kriminelle Szene kennt und achtet das merkwürdige Gleichgewicht. Kleine Ganoven nehmen es sportlich, wenn sie erwischt werden, große Gangster sind tragisch gefallene Ehrenmänner. Frauen wollen gar nicht genau wissen, wie ihre Gatten oder Lebensgefährten den Unterhalt verdienen, solange pünktlich genug Geld auf den Familientisch gelegt wird. Die Polizei spielt auch hier mit und lässt die Familien ihrer ‚Kunden‘ in Frieden: Diese Welt ist noch in Ordnung; sie gehorcht ungeschriebenen aber bekannten und beachteten Regeln, die den zynischen Leser der Gegenwart zum Kopfschütteln bringen, jedoch gleichzeitig jenen Reiz unterstreichen, den altmodische Kriminalgeschichten ausüben.
Von Anekdote zu Anekdote
Doch was ist mit den Ereignissen in Surrey? Wer treibt dort sein Unwesen? Was hat es mit den Tongabohnen auf sich? Eigentlich gar nichts. Sie gehören zu den unzähligen Anekdoten, die von Holt um des Effektes willen in seine Geschichte eingeflochten werden. Für die Handlung sind sie in der Regel ohne Belang. Im finalen Silver-Vortrag werden sie abgehakt, falls sie der Leser nicht vergessen hat und Aufklärung fordert.
Zu Holts Gunsten sollte man nachsichtig urteilen: Was sich der Täter, seine Komplizen oder seine Rivalen einfallen lassen, müsste sie prinzipiell auf direkten Wegen ins Gefängnis führen. Sie haben Glück, dass die Polizei ebenso umständlich wie ihre Gegner vorgeht und sich auf diese Weise selbst aushebelt.
Inspektor Silver würde dies natürlich vehement abstreiten. Er gehört zu jenen Krimi-Polizisten, die offenbar lieber Privatdetektiv wären. Glücklicherweise scheint sich niemand um die Freiheiten zu kümmern, die sich Silver in Missachtung seiner (nie zur Sprache gebrachten) Dienstvorschriften herausnimmt; das Ergebnis zählt, auch wenn es unkonventionell erzielt wurde. Also darf Silver nicht nur mit einem Sensationsreporter, sondern auch mit einem Privatmann gemeinsam ermitteln. Dass Peter Langley ebenso undurchsichtig wirkt wie die tatsächlich Verdächtigen, erscheint wohl nur dem heutigen Leser so: 1933 genügt Langleys Ruf, ein „Gentleman“ zu sein, um ihn bedingungslos ins Vertrauen ziehen zu dürfen.
Alter ist Erfahrung und Freibrief
Jedenfalls denkt Silver so, und er ist es, der entscheidet. Wie eine Glucke hockt er dabei auf seinen Erkenntnissen, die er weder mit seinen Mitstreitern noch mit den Lesern zu teilen gedenkt – auch eine Methode, um Krimi-Spannung zu schüren, allerdings eine billige. Andererseits sind Untergebene wie der Land-Polizist Foß faktisch höchstens in der Lage, mit wichtiger Miene einen Tatort abzusperren. Steigen diese ‚Ermittler‘ von ihrem Dienst-Fahrrad, um selbst zu recherchieren, produzieren sie ausschließlich Unfug und Irrtümer, die offenbar für ‚komische‘ Momente im Lesefluss sorgen sowie das Genie der ‚echten‘ Ermittler unterstreichen sollen.
Auf diese Weise holpert unsere Geschichte eher ihrem Ende entgegen, statt einen sorgsam geschmiedeten Kreis zu schließen. Immerhin hat man sich auf diesem Weg nicht gelangweilt. Die Methoden, mit denen Holt für Spannung sorgt, wirken viele Jahrzehnte später naiv bis dreist. Andererseits haben sie das zeitgenössische Publikum in den Bann ziehen können. „Der Tongabohne“ gingen vier Silver-Romane voraus, und weitere neun folgten bis 1961.
Zu verfolgen, auf welche Weise ein Autor wie Henry Holt, der keine „Literatur“ oder Krimi-Klassiker schrieb, unterhaltende Fließbandware produzierte, zieht der Lektüre eine vom Verfasser unbeabsichtigte Ebene ein. Dieses (keineswegs hochmütige) Vergnügen wird durch eine Übersetzung gesteigert, die bereits 1937 entstand und folgerichtig im 21. Jahrhundert seltsam klingt. Es ist fraglich, ob eine Neuübersetzung der „Tongabohne“ die beschriebenen Verwerfungen austreiben könnte. Zu einer Henry-Holt-Renaissance wird es wohl nicht kommen. Dies ist eine Lücke, mit der wir problemlos leben (und lesen) können.
Autor
Henry Holt (1881-1955) gehört zu den vielen ‚vergessenen‘ Autoren der Kriminalliteratur. Obwohl zu seinen Lebzeiten sehr aktiv und auch erfolgreich mit actionreichen Krimis im Edgar-Wallace-Stil, fehlen seinen Romanen das gewisse Etwas, das eine Geschichte zum Klassiker aufwertet.
Über die Privatperson Henry Holt ließ sich bisher nur ermitteln, dass der spätere Schriftsteller als Polizeireporter begann – ein Job, der ihm viele Ideen für seine an Intrigen und Verfolgungsjagden reichen Kriminalromane geliefert haben dürfte.
Taschenbuch: 180 Seiten
Originaltitel: The Scarlet Messenger (London : W. Collins Sons & Co. 1933)
Übersetzung: Friedrich Freiherr von Bothmer
http://www.randomhouse.de/goldmann
Der Autor vergibt: 




