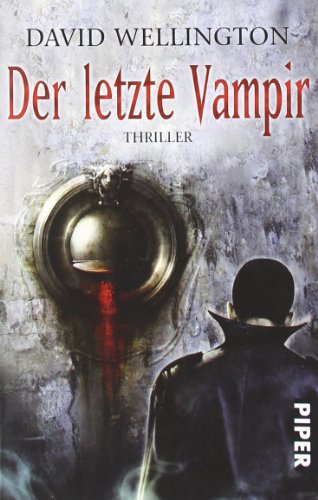Special Deputy Jameson Arkeley – und auf den |Special Deputy| legt Arkeley genauso viel Wert wie Captain Jack Sparrow auf den |Captain| – ist ein ganz harter Knochen. 1983 schaffte er es, ein ganzes Vampirnest zu vernichten, wenn man einmal von der Vampirin Justinia Malvern absieht, deren verknöcherter untoter Körper einfach nicht recht brennen wollte und die nun, der amerikanischen Justiz unterstellt, in einem leerstehenden Sanatorium als Versuchsobjekt herhalten muss. Diese eine erfolgreiche Vampirjagd ist der Knackpunkt in Arkeleys Karriere. Nicht nur macht sie ihn plötzlich zum einzigen erfolgreichen Vampirjäger der Vereinigten Staaten; sie ist auch der Beginn seines fanatischen Hasses auf die Blutsauger. Dass Malvern ihm durch die Finger geglitten ist, kann Arkeley nicht verwinden. Er will sie unbedingt tot sehen, genauso wie jeden anderen Vampir.
Zwanzig Jahre später wittert Arkeley endlich seine Chance. Bei einer Polizeikontrolle im verschlafenen Pennsylvania stößt State Trooper Laura Caxton auf einen Wagen mit drei Leichen. Schnell wird klar, dass es sich um Vampiropfer handelt. Die eingeschalteten Behörden schicken Arkeley zur Unterstützung, und der kann nicht anders als Malvern hinter den neuen Vampiraktivitäten zu vermuten.
Zusammen mit der in Vampirfragen völlig unbeleckten Caxton macht sich Arkeley also auf, den neuen Vampiren das Handwerk zu legen; eine Angelegenheit, die sich als schwieriger erweist, als man zunächst annehmen würde. Wellingtons Vampire kommen als ziemlich unbesiegbare Kampfgeschosse daher, und so haben Arkeley und Caxton ihre liebe Müh, die neue Vampirplage einzudämmen und die menschlichen Opfer in übersichtlichen Zahlen zu halten. Bis es zum endgültigen Showdown im stillgelegten Sanatorium kommen kann, ist auf beiden Seiten reichlich Blut geflossen und eine stolze Zahl von Nebencharakteren hat ihr Leben ausgehaucht.
Wenn Verlage ihre Publikationen mit Superlativen schmücken, ist in der Regel Vorsicht geboten. |Piper| bezeichnet David Wellingtons „Der letzte Vampir“ ganz unbescheiden als den „kompromisslosesten und wichtigsten Vampirroman des modernen Horrors“ und spricht dann im Klappentext auch noch vom „definitiven Vampir-Epos“. Damit stellt sich |Piper| leider selbst ein Bein, denn bei den unzähligen Veröffentlichungen zum Thema Vampire müsste Wellington schon arg von der Muse geküsst worden sein, um derartige Lobeshymnen zu verdienen. Tatsächlich hat er einen grundsoliden Actionreißer geschrieben, jedoch keinen „wichtigen Vampirroman“ und schon gar kein „Vampir-Epos“.
Bei Wellington geht es richtig zur Sache, und das macht er seinem Leser gleich auf den ersten Seiten klar. Schon die Beschreibung von Arkeleys erster Vampirjagd gibt den Kurs für die folgenden vierhundert Seiten vor. Da wird geschossen und verfolgt und gestorben, und schlussendlich kotzt der böse Vampir seine komatösen Vampirgefährten mit halbverdautem Blut voll, um sie wiederzubeleben. Das alles schildert Wellington mit echter Hingabe, und wer seine Begeisterung für das Eklige und Brutale nicht teilt, der wird sich mit „Der letzte Vampir“ wohl schwertun.
In den relativ kurzen Kapiteln reiht sich eine halsbrecherische Actionsequenz an die nächste, und Wellington gönnt seinen beiden Protagonisten kaum eine Verschnaufpause. Trotzdem schafft er es, die beiden durchaus plastisch zu schildern. Arkeley sieht mit seinen versteiften Wirbeln so aus, als hätte er buchstäblich einen Stock verschluckt – und so benimmt er sich auch. Außer seiner Rache an Malvern zählt für ihn nichts im Leben, selbst seine Ehe und sein Sohn sind für ihn nichts weiter als eine Art, die Zeit zwischen den Vampirjagden zu füllen. Arkeley ist ein Einzelgänger, und das lässt er seine neue Partnerin gern spüren. Doch Caxton ist zu sehr damit beschäftigt, sich vor den herumfliegenden Kugeln zu ducken, um Arkeley wirklich lange böse zu sein.
Überhaupt, Caxton. Wellington schreibt aus ihrer Perspektive, der Leser erkundet also mit ihr diese neue und ungewohnte Welt der Vampire. Sie hält sich ganz gut, schaut bei den übel zugerichteten Leichen immer hin und stellt sich auch bei der Jagd auf den Vampir Congreve nicht dumm. Im Gegensatz zu Arkeley hat sie auch so etwas wie ein Privatleben – eine Freundin, eine Meute Hunde und ein Haus. Deanne, Caxtons Liebste, ist der Schwachpunkt des Romans. Sie ist nie mehr als ein Plot Device, ein Kunstgriff, um die Handlung in die richtigen Bahnen zu lenken, und ein so billiger Trick erscheint als ein hässlicher Fleck auf dem ansonsten durchaus logisch gewebten Handlungsteppich des Romans.
Aber natürlich sollte man auch ein paar Worte über Wellingtons Vampire verlieren, sie sind schließlich der Dreh- und Angelpunkt der Handlung. Sie sind triebgesteuerte Monstren: große, kahlköpfige Albinos mit spitzen Ohren und mehreren scharfen Zahnreihen. Sie nippen nicht etwa gepflegt an ihrem Opfer, sondern reißen es in Stücke, und wenn es ihnen beliebt, können sie die so Getöteten als Halbtote wieder auferstehen lassen: praktische Zombies, die niedere Arbeiten verrichten können. Seltsamerweise sind Wellingtons Vampire (und das wird nie wirklich thematisiert) eine evolutionäre Sackgasse. Im Gegensatz zum normalen literarischen Vampir, der mit zunehmendem Alter immer stärker wird und immer weniger Blut benötigt, sind die Vampire Wellingtons nie so stark wie in ihrer ersten Nacht und mit zunehmendem Alter brauchen sie immer größere Blutmengen. Sicher, das verstärkt die Gefahr für die Menschen, doch gleichzeitig sorgt es auch dafür, dass eine Vampirin wie Malvern (ca. 400 Jahre alt) nur noch aus lose zusammenhängendem Gewebe besteht. Sie kann nicht mehr laufen, kommuniziert nur noch über einen Laptop und ihr fehlt ein Auge. So möchte man sich die Ewigkeit nicht vorstellen …
Und zu allem Überfluss zerfallen Vampire tagsüber auch noch in eine Art Glibber. In diesem Urschleim aus Nägeln, herumschwimmenden Knochen und halbverflüssigten Eingeweiden muss der geneigte Jäger dann das Herz finden, denn nur so kann ein Vampir vernichtet werden. Bei Wellington klingt das dann so: |“Sie sah Reyes‘ Knochen, so wie sie Malverns Skelett gesehen hatte, aber während das Fleisch der Vampirin zu einem oder zwei Litern breiigem Matsch reduziert gewesen war, stand in Reyes‘ Sarg die zähflüssige Suppe bis zur Hälfte. Nun, bei ihm gab es ja auch viel mehr Fleisch zu verflüssigen als bei Malvern. Ein paar Knochen trieben an der Oberfläche; an den knorpeligen Vorsprüngen klebten ganze Madenkolonien. Der Schädel lag völlig untergetaucht auf dem Grund, starrte sie mit weit aufgeklapptem Unterkiefer an.“| (S. 263) Für solche Szenen lebt Wellington, gepflegter Grusel ist seine Sache nicht. Bei ihm geht es deftig zu und er liebt es, sich der Schmerzgrenze Satz für Satz zu nähern, um sie dann plötzlich zu überspringen.
Wellingtons Roman ist sicher nichts für zarte Gemüter. Wohlerzogene adlige Vampire mit schwarzen Capes wird der Leser hier nicht finden. Wer aber auf der Suche nach einem Actionspektakel mit zwei taffen Helden ist, wer Vampire mal etwas anders erleben will und das Abscheuliche und Groteske sucht, der sollte Wellingtons letzem Vampir eine Chance geben. Dass Wellingtons unverwüstliche Vampire ihre Leserschaft finden, beweist wohl die Tatsache, dass die Fortsetzung, „99 Coffins“, im Dezember 2007 in den USA erschienen ist.
http://www.piper-verlag.de
http://www.brokentype.com/davidwellington/
David Wellington schreibt seine Romane zunächst als Blogeinträge, um sie später als überarbeitete Fassung in Buchform zu veröffentlichen. Das heißt, alle seine Romane sind kostenlos (und völlig legal) im WWW zu finden. Die originale Rohfassung von „Der letzte Vampir“ kann man hier lesen: http://www.brokentype.com/thirteenbullets/.