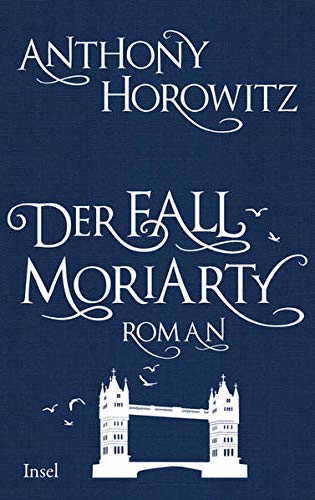Im Mai des Jahres 1891 werden sowohl die Kriminalisten als auch die Kriminellen dieser Welt von der Nachricht erschüttert (bzw. erfreut), dass Sherlock Holmes, der geniale Privatermittler, im Kampf gegen seinen Erzfeind Professor James Moriarty an den Reichenbachfällen in der Schweiz den Tod fand. Auch Moriarty starb, was für Pinkerton-Detektiv Frederick Chase einen herben Rückschlag bedeutet, hatte er doch gehofft, über den Professor einem ähnlich üblen Verbrecher auf die Spur zu kommen: Clarence Devereux plant, sein kriminelles Imperium über die USA hinaus nach England zu erweitern. Er wollte einen Pakt mit Moriarty schließen und sich deshalb mit diesem Treffen, doch Zeitpunkt und Ort dieser Zusammenkunft sind unbekannt.
Chase hofft, an der inzwischen gefundenen Leiche Moriartys eine entsprechende Nachricht zu finden. Dem ist tatsächlich so, aber sie ist kodiert. Glücklicherweise kann sein neuer Verbündeter helfen: Inspektor Athelney Jones von Scotland Yard ist ein glühender Verehrer des verstorbenen Sherlock Holmes und hat sich dessen Methoden zu Eigen gemacht. Jones entschlüsselt die Botschaft, doch in London haben sich die neuen Herren der Unterwelt bereits gut etabliert. Da Moriarty tot ist, will Devereux dessen Organisation übernehmen. Er und seine Schergen scheuen dabei vor keiner Brutalität zurück.
Dies bekommen Chase und Jones zu spüren, als sie sich gemeinsam auf die Suche nach Devereux begeben, der unsichtbar irgendwo in London die Fäden zieht. Mehrere Mordanschläge werden auf das Ermittlerduo verübt. Auch sonst treffen sie immer wieder auf schauerlich zugerichtete Leichen, denn Devereux duldet weder Widerspruch noch Verrat. Selbst Jones‘ Familie ist nicht vor ihm sicher – ein ungeheuerlicher Affront, der den Inspektor quasi Blutrache schwören lässt. Da auch Jones das Gesetz im Bedarfsfall auf seine Biegsamkeit überprüft, kommen Kriminalist und Detektiv dem Gesuchten ungemütlich nahe – und geraten in dessen Todesfalle …
In Abwesenheit des Meisters
Ein Sherlock-Holmes-Roman ohne Sherlock Holmes (oder Dr. Watson)? Ist das sinnvoll? Arthur Conan Doyle hat selbst hin und wieder auf seinen Meisterdetektiv verzichtet. Diese Geschichten gehören nicht zu den besten des Kanons. Holmes ist eine charismatische und dominante Figur, deren Genialität und Exzentrik das Leserinteresse wecken. Auch spätere Holmes-Autoren scheiterten an dieser Klippe. Selbst ein ausgewiesener Aficionado wie Michael Hardwick konnte mit „The Private Life of Dr. Watson“ (1985; dt. „Dr. Watson“) weniger fesseln als durch die Stringenz der biografischen ‚Fakten‘ beeindrucken.
Andererseits bewiesen Schriftsteller wie M. J. Trow, der zwischen 1985 und 1991 neun Romane um Inspektor Lestrade veröffentlichte, dass es möglich ist, das Holmes-Universum zu erweitern. Ist eine Geschichte wirklich gut, kann sie auch ohne den Meister und seine manchmal durchaus erdrückende Präsenz funktionieren. Wenn darüber hinaus ausgerechnet Professor Moriarty im Mittelpunkt steht, ist eine positive Erwartungshaltung gewährleistet.
Dabei taucht dieser James Moriarty bei Doyle nur zweimal persönlich (in der Story „Das letzte Problem“ und im Roman „Das Tal der Furcht“) auf und wird in fünf weiteren bloß erwähnt. Genau dies sichert ihm seine Stellung: Holmes selbst tituliert ihn als „Napoleon des Verbrechens“. Er spricht beinahe ehrfürchtig über ihn und zeigt sogar Furcht. Dazu hat er allen Grund, denn es kommt zum ultimativen Kampf zwischen Holmes und Moriarty an den Wasserfällen des Reichenbachs, der scheinbar beiden Kontrahenten das Leben kostet.
Die Attraktivität des Bösen
Moriarty ist ein Genie des Bösen und in gewisser Weise das dunkle Spiegelbild von Sherlock Holmes. Weil Doyle seine Taten nur indirekt sowie vage schildert, überlässt er es dem Leserhirn, die Lücken zu füllen. Auf diese Weise bleibt Moriarty mysteriös und wirkt deshalb besonders gefährlich.
Eigentlich kann ein Autor nur verlieren, wenn er nunmehr beschließt, dieses Phantom zur Hauptfigur eines Romans zu erheben. Glücklicherweise findet Anthony Horowitz einen Ansatz, der ihm genau dies ermöglicht, ohne Moriarty aus den schützenden Schatten treten zu lassen: „Der Fall Moriarty“ ist nicht nur eine Geschichte ohne Sherlock Holmes. Auch Moriarty glänzt durch Abwesenheit – scheinbar, denn tatsächlich ist er stets dort präsent, wo er sich am wohlsten fühlt: im Hintergrund, wo er die Fäden zieht.
Erst nach einem überraschenden Twist, der das eigentliche Finale einläutet, gibt sich Moriarty zu erkennen; schließlich trage dieses Buch als Titel seinen Namen, merkt er, der sich damit als Autor identifiziert, ironisch an. Er will seine Leser nicht betrügen. Deshalb widmet er nunmehr viele Buchseiten der Erläuterung, wo und wie er nicht nur die anderen Handlungsfiguren, sondern auch uns, das Publikum, getäuscht hat.
Getäuscht – nicht betrogen. Das ist nicht nur Moriarty wichtig, denn Horowitz legt hier einen klassischen Rätselkrimi vor, weshalb er dem Leser durchaus die Chance bietet, mit ihm gleichzuziehen und Moriarty vor dem Finale zu demaskieren. Nachträglich enthüllt ‚Moriarty‘ persönlich, wo entsprechende Hinweise in die Schilderung eingeflochten wurden. Nichtsdestotrotz dürfte die lesende Mehrheit überrascht sein, wie Horowitz es plante.
Die gedoppelte Vergangenheit
Sherlock Holmes und Dr. Watson waren bei Doyle trotz ihrer Außenseiterrollen als (bürgerliche) Verbrecherjäger treue Untertanen ihrer britischen Majestäten. Die zum Himmel schreienden sozialen Missstände der Jahrzehnte vor und nach 1900 klammerte Doyle aus; literarisch verfremdete Kritik war nicht sein Anliegen.
Solche Ignoranz kann sich heute nicht einmal ein Schriftsteller gestatten, der ein Sherlock-Holmes-Pastiche schreibt. Auch Horowitz widmet der politischen Realität des Jahres 1891 oder dem Lebensalltag der unteren Gesellschaftsschichten deutlich mehr Raum als Doyle. Dabei meidet Horowitz den erhobenen Zeigefinger, sondern lässt das Beschriebene in die Handlung einfließen, ohne es dabei seine abschreckende Wirkung verlieren zu lassen.
Dazu gehört ein Bombenanschlag auf New Scotland Yard, den Doyle nicht gutgeheißen hätte, und selbstverständlich die Existenz eines organisierten Verbrechens, dem kein mephistophelisches und damit die Ausnahme darstellendes Einzel-Genie vorsteht, sondern eine modern durchstrukturierte Gruppe, die dem Gesetz und seinen Vertretern gewachsen ist. Auf der anderen Seite ist dieses Gesetz nicht fleckenfrei: Mehrfach muss sich Frederick Chase anhören, dass Pinkerton-Detektive in den USA angeheuert wurden, um im Auftrag brutalkapitalistischer Fabrikbesitzer Gewerkschafter und Streikende niederzuknüppeln.
Falsche Spuren bei hohem Tempo
Der Plot wird eher durch ebenfalls Doyle-untypische Brutalitäten als durch Originalität modernisiert: Vormals hat Sherlock Holmes Moriarty verfolgt, nun sind Athelney Jones und Fredrick Chase Clarence Devereux auf der Spur, der freilich nicht über die Finessen eines Moriarty verfügt. So ist es kaum verwunderlich, dass Devereux trotz seiner soziopathischen Ausbrüche und seiner Agoraphobie keine besonders fesselnde Figur darstellt, sondern primär die Ansprüche eines klassischen Schurken erfüllt.
Die wahre Durchtriebenheit des Verfassers wird deutlich, als sich herauskristallisiert, wer eigentlich wem hinterherjagt. Tatsächlich besitzt die Handlung eine unsichtbare aber solide Sub-Ebene, die Horowitz mit großem Geschick einzieht. Erst wenn Moriarty das Geschehen aufrollt, wird sie sichtbar, obwohl sie stets vorhanden ist. Dieses falsche aber elegante Spiel macht den besonderen Reiz aus, obwohl Horowitz auch ‚normales‘ Krimi-Geschehen mit Geschick und Spannung zu inszenieren weiß. Verfolgungsjagden wirken bei ihm nie als Mittel zum Zweck, die Ereignisse irgendwie in Schwung zu bringen.
Zu den falschen Spuren gehören Indizien, mit denen Horowitz anzudeuten scheint, dass Sherlock Holmes die Geschehnisse heimlich überwacht oder gar lenkt. Ist womöglich Athelney Jones eigentlich Holmes? Ist es der hustende Mann im Hotelzimmer neben Chase? Oder ist Holmes Chase in genialer Verkleidung? Der Verdacht, dass jemand nicht ist, der zu sein er vorgibt, ist korrekt, doch dürfte der Leser trotzdem bass erstaunt sein.
Abgerundet wird dieses Garn durch trockenen, nie aufdringlichen Humor, der auch Doyle nicht ausspart: Ein erstes Kapitel referiert die Ereignisse an den Reichenbachfällen und legt dabei offen, wo Doyle die Logik ignoriert oder gar mit Füßen getreten hat. Dem Holmes-Freund vergeht Hören & Sehen, wenn er mit einschlägigen Belegen förmlich bombardiert wird. Doyle hätte gelacht: Er hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihm eine spannende Geschichte wichtiger als Logik war, und lag offensichtlich richtig damit.
Autor
Der am 5. April 1955 in der englischen Grafschaft Middlesex geborene Anthony Horowitz bezeichnet sich als unglückliches (und übergewichtiges) Kind, das die Schule hasste und sich nur in der umfangreichen Bibliothek seines Vaters geborgen fühlte. Seine Mutter unterstützte seine Liebe zur phantastischen Literatur; schon der junge Anthony wollte Schriftsteller werden.
Horowitz studierte Englische Literatur an der Universität von York, die er 1977 mit einem „Batchelor of Arts“ verließ. Bereits zwei Jahre später erschien sein erstes Buch. „The Sinister Secret of Frederick K Bower“ („Das finstere Geheimnis“) war ein humorvoller, spannender Abenteuerroman für Kinder – ein Publikum, das Horowitz in den nächsten Jahrzehnten ausgiebig mit Lesestoff versorgte.
1983 siedelte Horowitz nach Paris um. Hier entstand „The Devil’s Door-Bell“, der erste Teil der „Pentagramm“-Serie. Nach seiner Mitarbeit an der TV-Serie „Robin of Sherwood“ (1984-1986) konzipierte er 1987 die Serie „Crossbow“, deren Held der Schweizer Nationalheld Wilhelm Tell war. 1986 erschien „The Falcon’s Malteser“ („Die Malteser des Falken“), der erste Teil der bis heute lose fortgesetzten Krimi-Komödie um die beiden „Diamond Brothers“ Tim, einen erfolglosen Privatdetektiv, und seinen jüngeren Bruder Nick. Für „Grossham Grange“ („Schule des Grauens“), die Geschichte eines übernatürlich begabten Schülers, wurde Horowitz 1989 mit einem „Lancashire Children’s Book of the Year Award“ ausgezeichnet.
In den 1990er Jahren erweiterte Horowitz sein Schaffensspektrum. Er schrieb nun verstärkt für Fernsehkrimi-Serie wie „Agatha Christie’s Poirot“ (ab 1991), „Anna Lee“ (1994), „Crime Traveller“ (1997) oder „Barnaby“ (ab 1997). Sehr erfolgreich wurde ab 2000 seine Serie um den jugendlichen Geheimagenten Alex Rider, deren erster Band („Das Geheimnis von Port West“/„Stormbreaker“) 2006 nach Horowitz‘ eigenem Drehbuch verfilmt wurde. Ein erster Roman ausdrücklich für ein erwachsenes Publikum war 2004 „The Killing Joke“.
Seit 1988 verheiratet, lebt Horowitz in London. Über sein umfangsreiches Werk informiert diese Website.
Gebunden: 343 Seiten
Originaltitel: Moriarty (London : Orion 2014)
Übersetzung: Lutz-W. Wolff
www.suhrkamp.de
eBook: 1522 KB
ISBN-13: 978-3-4587-3922-7
www.suhrkamp.de
Hörbuch: 4 CD (= 276 min. Laufzeit; gekürzte Ausgabe), gesprochen von Uve Teschner
ISBN-13: 978-3-8337-3365-9
www.jumboverlag.de
Der Autor vergibt: