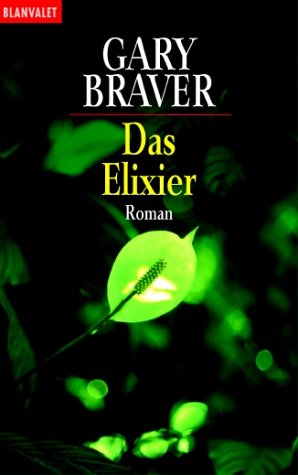1980 spürte Biochemiker Dr. Christopher Bacon im Dschungel von Papua-Neuguinea heilsamen Pilzen nach, Weil er dabei seinem einheimischen Begleiter, dem Schamanen Iwati, das Leben rettete, weihte ihn dieser in das Geheimnis der Tabukari-Pflanze ein, die dem Menschen Unsterblichkeit schenkt; er selbst sei auch schon 130 Jahre alt, eröffnete Iwati damals dem staunenden Freund.
Sechs Jahre später tüftelt Bacon immer noch an einer Version des Wundermittels, das er „Tabulon“ nennen möchte. Inzwischen werden seine Labormäuse steinalt. Bacon würde gern selbst die eigene Medizin versuchen, gäbe es nicht hässliche Nebenwirkungen gäbe: So manche Maus holt plötzlich die Zeit ein, die sie dank Tabulon betrügen konnte. Das Ende ist ebenso spektakulär wie tödlich, was Bacon klugerweise zur Zurückhaltung mahnt. Allerdings muss er erfahren, dass ihn sein alter Freund und Mitforscher Dexter Quinn, den er als einzigen ins Vertrauen zog, schnöde hinterging: Quinn hat sich heimlich Tabulon injiziert. Die Wirkung entsprach tatsächlich dem Sturz in den Jungbrunnen, bis es ihm eines Tages ergeht wie besagten Mäusen.
Bacon arbeitet für den Pharma-Konzern Darby Pharmaceuticals. Senior Ross Darby gedenkt in den Ruhestand zu gehen. Schwiegersohn Quentin Cross soll die Leitung übernehmen. Doch der hat er einen lukrativen Vertrag mit dem Drogenbaron Antoine Ducharme geschlossen. Damit hat Cross einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Als er in Zahlungsschwierigkeit gerät und Ducharme ihn in die Zange nimmt, verrät er das Geheimnis von Tabulon, das inzwischen den werbewirksamen Namen „Elixier“ trägt: Cross hatte Wind von Bacons bahnbrechender Erfindung bekommen und diesen überredet, sie für Darby Pharms zu entwickeln.
Bacon gedenkt nicht, „Elixier“ zur Mode-Medizin der Superreichen und Mächtigen werden zu lassen. Mit seiner Familie taucht er 1987 unter. 13 Jahre später lässt ein dummer Zufall die Tarnung auffliegen. Quentin Cross lässt sofort die Verfolgung durch Antoine Ducharmes Schergen aufnehmen, denn der Verbrecherboss giert ebenfalls nach dem Elixier. Eine erbarmungslose Jagd auf Christopher Bacon setzt ein, in deren Verlauf die Menschen um den ewig jungen Forscher wie die Fliegen sterben …
Den Wald vor lauter Wunderkraut nicht sehen
Tief im Wald blüht gar manches Kräutlein, das besser als jede böse Chemie-Keule der Menschheit Zipperlein kuriert: ein schöner, grüner Traum, der zur angenehmen Abwechslung hier und da sogar in Erfüllung gehen könnte, da man öfter von medizinischen Überraschungen an unerwarteter Stelle liest und hört. Echte Wunder bleiben allerdings immer noch Hollywood und dem Unterhaltungsroman vorbehalten.
Das ewige Leben gehört ganz gewiss in diese Sparte. Zwar hat sich Gary Braver die Mühe gemacht, für „Das Elixier“ einige Ergebnisse der naturgemäß hochkomplexen Forschungen zum Thema Alterung allgemein verständlich zusammenzufassen und in die Handlung einzubauen, aber selbst dem Laien schwant, dass er dabei wohl doch einige nicht gerade schmale Lücken mit selbst Erdachtem füllt. (Dies nur als Warnung für jene Zeitgenossen, die sich umgehend daran machen, im heimischen Labor die auf der Seite 113 dargestellte Elixier-Formel in die Realität umzusetzen.)
Weil er das im engen Rahmen seiner schriftstellerischen Fähigkeiten ganz gut schafft, funktioniert der (ansonsten auch nicht taufrische) Plot von Methusalem, der nicht in Frieden ewig leben kann, weil es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Das erhebt „Das Elixier“ in den Rang einer leichten Feierabend- oder Urlaubslektüre, die sich spannend liest, ohne dass es sich negativ bemerkbar macht, wenn man zwischendurch mal einnickt.
Verfolgungsjagd mit Spannungslücken
Im Detail sorgen allerdings doch einige Schwächen für Stirnrunzeln. Da ist zum einen der deutliche Handlungsbruch zwischen dem zweiten und dritten Teil. 13 Jahre nach dem Kampf um Tabulon/Elixier, der mit der Flucht der Bacons endet, beginnt praktisch eine völlig neue Geschichte – die vom Fluch des ewigen Lebens, in die eher zufällig einige Personen geraten, denen wir schon früher begegnet sind. Echte Verbindungen gibt es nicht. Stattdessen hat es den Anschein, als habe Autor Braver einige bereits geschriebene Kapitel eines viel umfangreicheren Romans gestrichen, weil ihm der Verlag nur fünfhundert Seiten zubilligte.
Seltsam bleibt dieser Sprung allemal – vor allem für einen Mann, der eigentlich wissen müsste, wie man eine Story entwickelt: Gary Braver (alias Gary Goshgarian, Dozent für Englische Sprache an der Northeastern University Boston) leitete mehr als einen Workshop, in dem er das Schreiben phantastischer Literatur lehrte, bevor er selbst zur Feder griff.
Für Sodbrennen sorgt auch die Figurenzeichnung. Hier hat sich Braver deutlich weniger Mühe gegeben als mit den Recherchen für das (pseudo-) wissenschaftliche Fundament seiner Story. Papiertiger und Pappnasen bestimmen die Szene. Noch am besten gelungen ist Christopher Bacon – glücklicherweise, denn der ist schließlich die Hauptperson. Mit seiner Unterstützung spielt der Autor logisch nachvollziehbar das Für und Wider des ewigen Lebens durch.
Achtung: Moral!
Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Argumenten, die gegen solche Methusalem-Träume sprechen. Leider gerät Braver bald auf die ethische Schiene, wird erst moralinsauer und dann auch noch rührselig: Der Mensch darf nicht ewig leben, weil der Tod im Kreislauf des Lebens als regulatives Element vorgesehen ist (und ohne ihn die Zivilisation binnen kurzer Zeit kollabieren würde), sondern weil er gegen die göttliche (oder wenigstens natürliche) Ordnung verstößt: ein Vorwurf, mit dem sich schon Dr. Frankenstein herumplagen musste.
Das war schon damals langweilig und ist es auch heute, wenn es wie hier durch die Figur der Wendy Bacon vertreten wird, einer selbstgerechten, verbohrten, weinerlich-hysterischen Inkarnation von Doris Day, die kongenial ergänzt wird durch ihren vernagelten Sohnemann, der es Daddy furchtbar übel nimmt, dass ihn dessen Probleme aus der geliebten US-Kleinstadt-Muster-Mittelstands-Spießer-Existenz mit nachmittäglichem Baseball-Spiel und anschließendem Festmahl in der Pizzahütte reißen.
Der Leser versteht nicht, wieso Bacon in seinem Denken und Handeln um diese beiden Nervensägen kreist, die allen Ernstes und ständig (bis man es nicht mehr ertragen mag) von ihm fordern, das Elixier zum Wohle der Menschheit zu vernichten. In dieses Lied stimmt ein geisterhafter Chor lachhaft verzerrter Nebendarsteller – der fanatische Sektenführer, der skrupellose Konzernchef, der vertierte Gangsterkönig, die durchgeknallte Schwester usw. – ein.
Die Schlinge um den Hals der Spannung
So kommt es schließlich, wie es kommen musste: In einem völlig überzogenen, plump inszenierten und an den Haaren herbeigezogenen Finale stirbt a) der sündhafte Forscher den Opfertod, gehen b) dabei zufällig alle Vorräte des Wundermittels mit ihm in die Luft und fällt c) an anderen Ende der Welt der Maori-Schamane, der sonst noch wusste, wie man es brauen kann, in einen Vulkan, der auch gleich alle Stauden der Tabukari-Pflanze in Asche verwandelt. So ist die Welt wieder in Ordnung: Es gibt eben doch eine höhere Macht, die den Menschen Nasenstüber verpasst, wenn sie zu vorwitzig werden!
Allerdings gibt es auch Hollywood, was uns einen untoten Schlussgag beschert: Siehe da, Frankensteins Sohn hat sich vorsorglich noch ein bisschen Elixier auf Eis gelegt! Wer hätte das gedacht – oder anders gefragt: wer nicht …? Diese holprige Unbedarftheit ist schade, denn Braver hat durchaus gute Ideen. Mit der Figur des Walter Olaffson traut er sich sogar, ohne „Tabu!-Tabu!“-Gekreisch zu beschreiben, was ein Mittel wie das Elixier eben auch sein könnte: ein Segen und die Rettung vor einem Alter, das kein Segen ist, für den wir mit Weisheit und Gelassenheit belohnt werden, wie es uns die selbst ernannten Vordenker und Tugendbolde unserer Welt einreden wollen, sondern ein von Krankheit und Einsamkeit begleiteter Horror sein kann.
Aber dann schnappt die „Politisch-korrekt!“-Schere in Bravers Kopf wieder zu, und der arme Wally wird für seine Vermessenheit, sich als wieder junger Hengst pudelwohl zu fühlen, mit einem besonders grässlichen Ende bestraft. Nur die Langeweiler überleben – und Heuchler wie Bacon jr., was wiederum interessante Rückschlüsse auf den Geist zulässt, der Romane wie „Das Elixier“ gebiert. Aber das ist wieder eine andere Geschichte; ein weiteres Kapitel in jenem nimmermüdem Lamento über das amerikanische Wesen, an dem diese Welt genesen soll …
Taschenbuch: 512 Seiten
Originaltitel: Elixir (New York : Forge, Tom Doherty Associates 2000)
Übersetzung: Georg Schmidt
http://www.randomhouse.de/blanvalet
Der Autor vergibt: