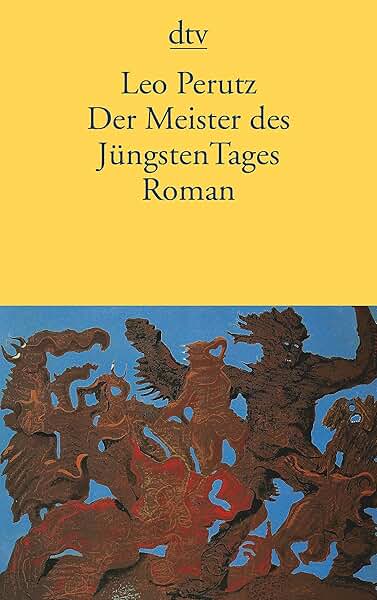
Der Roman hat schon einige Jahre auf dem Buckel – die Erstauflage erschien 1923 – und lässt sich nicht so einfach kategorisieren. Leo Perutz ist in der deutschen Literaturgeschichte kein Unbekannter – zwar kann sich seine Fama nicht mit der eines Thomas Mann vergleichen, aber seine vornehmlich historischen Romane wie „Der Marques de Bolibar“ oder „Nachts unter der steinernen Brücke“ haben einen Platz in der Ruhmeshalle der Vorreiter des modernen Romans gefunden. Und eben da hinein gehört auch „Der Meister des jüngsten Tages“. Wobei wir hier keinen historischen Stoff vor uns haben – auch wenn es einen historischen Bezug gibt. Jorge Luis Borges bezeichnete den „Meister“ als einen der besten Kriminalromane der Welt; Perutz selbst behauptete, er habe nie einen solchen geschrieben. Man kann von einem psychologischen Roman reden, von einer Detektivgeschichte oder gar im modernen Sprachgebrauch von einem „Mystery Thriller“. In dieser Aufzählung darf dann nicht die „Gothic Novel“, also der Schauerroman, vergessen werden. Oftmals gemahnt der „Meister“ an das Werk Edgar A. Poe’s – ja geradezu an eine Verquickung der rationalen Kriminalerzählungen mit den phantastischen Gruselgeschichten. Die im Buch erwähnte Farbe „Drommetenrot“ hat übrigens sogar Eingang in einige Ästhetiktheorien (z.B. Adorno) gefunden. Auf dem Buchdeckel wiederum wird „das mögliche Ergebnis eines Fehltritts von Agatha Christie mit Franz Kafka“ angekündigt. Nun, auch das ist nicht falsch…
Die Geschichte spielt im Jahre 1909 in Wien. Der Ich-Erzähler Freiherr von Yosch gerät in den Strudel einer seltsamen Selbstmord-Serie. An einem Abend wird er von seinem Freund Dr. Gorski gebeten, bei einem privaten Hauskonzert in der Villa des gemeinsamen Bekannten Eugen Bischoff als Violinenspieler auszuhelfen. Eugen Bischoff ist ein bekannter Hofschauspieler und der Mann der ehemaligen Geliebten des Freiherrn. Er berichtet der versammelten Gesellschaft die Geschichte eines Seeoffiziers, dessen Bruder völlig grundlos Selbstmord beging. Der Offizier stellte daraufhin Nachforschungen an, lebte das Leben seines Bruders mit allen Details nach und tötete schließlich sich selbst durch einen Sprung aus dem Fenster – obwohl der geladene Revolver, den er besaß, in einer Schublade greifbar nahe lag.
Nachdem Eugen Bischoff von Dr. Gorski überredet wurde, eine Kostprobe seiner neuen Theaterrolle zu geben, benimmt sich der Schauspieler sonderbar erregt und verschwindet in seinem Pavillon, um sich zu schminken. Unser Ich-Erzähler geht während dessen draußen im nächtlichen Garten spazieren, da die Anwesenheit seiner ehemaligen Geliebten in ihm intensive schmerzliche Gefühle erweckte. Plötzlich fallen zwei Schüsse. Der Schauspieler hat Selbstmord begangen – den ersten Schuss feuerte er allerdings auf die Wand des Pavillons ab. Bei dem Toten wird die Tabakspfeife des Freiherrn von Yosch gefunden. Sofort verdächtigt ihn der Bruder des Toten, den Selbstmord des Eugen Bischoff forciert zu haben. In der Verwirrung behält als Einziger der Ingenieur Solgrub einen klaren Kopf – begabt mit einem ausgeprägten analytischen Verstand übernimmt er sozusagen die Rolle des Sherlock Holmes in diesem Buch. Solgrub und Dr. Gorski forschen parallel zu dem von Selbstzweifeln gequälten Freiherrn nach einer Lösung des Rätsels und stoßen auf ein uraltes Geheimnis…
Dass die Lösung des Falles nicht im Bereich des Gewöhnlichen liegt, wird schon im Vorwort deutlich, in dem der Ich-Erzähler sagt: „Und es ist nicht vorüber, nein, noch immer ist es nicht vorüber, aus ihren Tiefen steigen die Bilder auf und dringen auf mich ein, nachts und am hellen Tage – jetzt freilich, dem Himmel sei Dank, nur blass und schattenhaft, nur wesenlose Schemen. Er schläft, der Nerv in meinem Hirn, aber sein Schlaf ist noch immer nicht tief genug. Und manchmal fasst mich eine jähe Angst und treibt mich ans Fenster, es ist mir, als müsse dort oben das furchtbare Licht in ungeheuren Wellen über den Himmel rauschen, und ich kann es nicht fassen, dass über mir die Sonne steht, von silbernem Dunst verhüllt, von purpurnen Wolken umdrängt oder einsam in der unendlichen Bläue des Himmels, und rings um mich her, wohin ich blicke, die uralten, ewigen Farben, die Farben der irdischen Welt. Niemals mehr hab’ ich seit jenem Tag das grauenvolle Drommetenrot gesehen. Aber die Schatten sind da, sie kommen immer wieder, sie haben mich umstellt, sie greifen nach mir – werden sie niemals aus meinem Leben verschwinden?“ (S. 8 f.)
Aber mehr sei an dieser Stelle nicht verraten, denn schließlich will ich euch nicht die Spannung nehmen. Vielleicht noch so viel: Die Aufhellung des Rätsels lässt ebenfalls ganz unterschiedliche Deutungen zu. An dieser Stelle kommt es auf den Leser an: Wie will er diesen Roman lesen? Ich habe mich entschieden, in ihm vor allem eine Aussage über die Verbindung von Religion und Kunst zu erblicken – über die Sehnsucht des Künstlers nach den Visionen und „Gesichten“…
Taschenbuch: 208 Seiten
www.dtv.de
