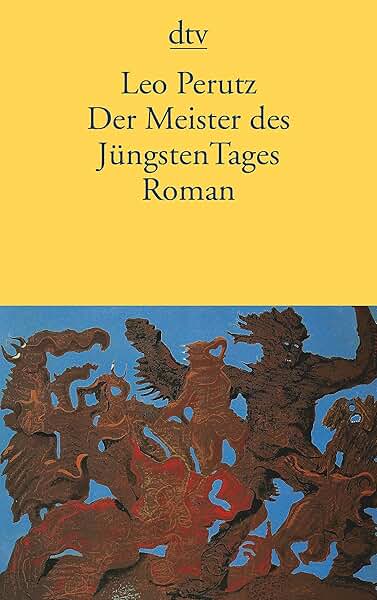Puh – eine ziemliche Fülle an Material schüttet die Wiener Germanistin Christa Tuczay hier vor uns aus, so dass man sich manchmal ganz schön durchgraben muss. Die meisten werden, wenn sie die Begriffe „Magie“ und „Mittelalter“ hören, sicher zuerst an die Zauber-Grimoires wie den „Schlüssel Salomons“ oder an die alte Faustsage denken, die als Vorlage für Goethes berühmtes Theaterstück diente. Ja, jener Pakt mit dem Teufel, um sich tiefes Wissen und ungeahnte Erfahrungen anzueignen, ist gemeint – ein wahrhaft europäisches Motiv! Nicht umsonst hat der Kulturphilosoph Oswald Spengler vom faustischen Menschen gesprochen und damit den Abendländer gemeint. Es ist die geistige Unruhe, die gestillt werden muss, und sei es um den Preis eines Todes auf dem Scheiterhaufen oder ewiger Qualen in der Hölle.
Auch für die Autorin waren die Vorläufer des Faust der Ausgangspunkt ihrer Beschäftigung mit den Magiern im Mittelalter. Magie definiert sie nach Karl Beth als „die einfache und unverhüllte Objektivierung des Wunsches in der menschlichen Vorstellung“ oder wie es in den Märchen der Brüder Grimm heißt: „Es war einmal in jener Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat…“. Die mittelalterliche Magie beruhte auf dem Grundsatz der „Wesensidentität von Mensch und All, d.h. der Allbeseelung“. Nach dem Sympathieprinzip „Gleiches bewirkt Gleiches“ und dessen Umkehrung „Gegenteiliges bewirkt Gegenteiliges“ zauberte man z.B. einen Regen durch das Ausschütten von Wasser in einer bestimmten Zeremonie herbei, während das Verdunsten des Wassers Trockenheit hervorrufen sollte. Desweiteren galt, dass ein Teil für das Ganze stehen konnte. Der Fingernagel eines Menschen repräsentierte also diesen selbst, und es war möglich, ihn durch Manipulationen mit einem solchen ehemaligen Körperbestandteil zu beeinflussen.
Vieles, was sich in unseren heutigen Vorstellungen vom Zauberer findet, entstammt dem Mittelalter. Im Buch wird das Beispiel eines Priesters geschildert, der einen nicht an Zauber glaubenden Ritter überzeugen will. Er zieht mit dem Schwert einen Schutzkreis und befiehlt dem Ritter um jeden Preis innerhalb dieses Kreises zu bleiben. Der Magier beschwört nun die Dämonen herauf, bis der Teufel selbst erscheint und den Ritter aus dem Kreis zu locken sucht. Im Mittelalter galten die durch Magie erzeugten Phänomene in der Regel bei ihren Gegnern nicht etwa als Betrügerei – sondern als Illusionen, die durch die Dämonen hervorgerufen worden. Der Magier rief allerdings vorher die Hilfe des christlichen Gottes an, bevor er sich mit den Höllenmächten einließ.
Wie es scheint, verblieb die Magie des Mittelalters innerhalb eines christlichen Weltbildes. Doch man muss differenzieren. Im vorher erwähnten Beispiel findet die Beschwörung um die Mittagszeit statt. Diese Zeit aber war in der Antike die typische Geisterstunde. Christa Tuczay widmet gleich das erste Kapitel den Wurzeln der mittelalterlichen Vorstellungen, die in die griechische und römische Antike reichen. Dort finden wir schon die Angst vor dem Schadenszauber, eine Handlung, die im römischen Gesetz mit dem Feuertod bedroht wurde. Sogar heute noch glaubt man vielerorts an den sogenannten „Bösen Blick“.
Der Begriff „Magus“ geht auf altpersische Vorstellungen zurück. Dort durfte laut Cicero keiner König sein, der nicht vorher die Magie studiert hatte. In der Antike sind die magische und religiöse Sphäre ursprünglich nicht getrennt. Der Magier wird als von göttlichen Kräften besessen betrachtet, die seinen Handlungen die Weihe eines initiierenden Mysteriums geben.
Erst in der Spätantike kommt es zu einer Verbindung des Magus mit dem Maleficus (Schadenszauberer), die für das Mittelalter bestimmend wird. Davon trennt sich der Zweig der Theurgie – im Prinzip ist das die weiße Magie, die eben mit den Göttern in Verbindung steht, während sich andere Zweige der Magie der Dämonen bedienen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Figur des Jesus Christus in einigen Stellen der Überlieferung als Magier erscheint, z.B. im apokryphen Evangelium des Nicodemus, in dem die Juden Jesus als Dämonenbeschwörer verklagen. Besonders extrem in dieser Hinsicht ist die arabische Kindheitsgeschichte Jesu. Als ein Spielkamerad einen von Jesus gebauten Abflusskanal zerstört, bedient sich Jesus eines Sympathiezaubers, der das Leben des Spielkameraden in jener Geschwindigkeit verlöschen lässt, in der das Wasser aus dem zerstörten Kanal fließt.
Im Mittelalter wurden die Sakramente und viele Bibelstellen als Zaubermittel bzw. Zaubersprüche benutzt. Diese Entwicklung wurde von der Kirche als Missbrauch bekämpft. Dass dieser Kampf gegen die Zauberer durchaus ambivalent zu sehen ist, zeigt Christa Tuczay in den Kapiteln über die Zauberei der Päpste und Bischöfe. Zwischen einem Exorzisten, der den Teufel austrieb und einem Magier, der ihn herbeirief, bestand eine nur sehr sehr verschwommene Grenze. Insofern überrascht es nicht, wenn wir in diesem Buch hören, dass es viele Legenden über Kirchenobere gab, die sich der Schwarzkunst verschrieben. Beispielsweise existieren Sagen über den Papst Sylvester II. (gest. 1003), der ein gestohlenes Zauberbuch in Besitz gehabt haben soll und schließlich von Dämonen bei der Kirchmesse zerstückelt wurde.
Die Zauberbücher umgab im Mittelalter ein Schleier aus Unheimlichkeit und Ehrfurcht. Der Kraft des Wortes wurde große Bedeutung beigemessen. Ein Großteil der Zauberbücher kursierte vor allem in herrschaftlichen und höfischen Kreisen, die dem Zugriff der Kirche entzogen waren. So soll Friedrich II. von Hohenstaufen seinen Hofastrologen Michael Scotus zum Verfassen eines Buches über die Schwarzkunst und Arnold von Villanova zu einer Abhandlung über Sigillenmagie veranlasst haben. Einen hohen Bekanntheitsgrad erlangte das auf arabische und griechische Quellen zurückgehende Zauberbuch „Picatrix“, welches Wissen über Talismane, die Planeten und Beschwörungen enthielt. Der Gott Hermes galt als Verfasser einiger vornehmlich alchemistischer und astrologischer Traktate – manchmal identifizierte man ihn mit dem ägyptischen Gott der Schreibkunst, Thot. Oftmals wurden die Bücher berühmten Persönlichkeiten zugeschrieben wie etwa dem griechischen Philosophen Aristoteles. Geschichten über solche Persönlichkeiten erfreuten sich im Mittelalter hoher Beliebtheit. Die Autorin berichtet beispielsweise über den römischen Schriftsteller Vergil, der im Mittelalter zum „Dichter, Magier und Meisterkonstrukteur“ wurde. Ebenso setzt sie sich mit dem Zauberer Simon von Samaria, dem Gegenspieler der Apostel Paulus und Petrus, auseinander.
Hierbei ist vor allem die Geschichte vom missglückten magischen Flug erwähnenswert, den Simon mit Hilfe der Dämonen ausführt und dabei durch die Kraft eines Heiligen zu Fall gebracht wird. Diese Geschichte verweist auf eine andere Frage, die Christa Tuczay diskutiert: Inwieweit ist die Magie des Mittelalters von schamanistischen Praktiken durchsetzt? Der magische Flug gehört zu den typischen Merkmalen des Schamanen. Daran schließt sich die Problematik der Unterscheidung des Magiers von den späteren Hexen an. Auch wenn im Hochmittelalter die Zauberer bereits verfolgt wurden, handelt es sich im Ganzen gesehen doch um Einzelfälle, die man nicht mit den in der Zeit von 1450 bis 1750 ca. 40000 bis 50000 hingerichteten Menschen vergleichen kann. Interessant ist der Hinweis der Autorin, dass in der kirchenrechtlichen Schrift Reginos von Prüm die „nachtfahrenden Weiber“ von der Göttin Diana angeführt werden, welche ähnlich wie Hermes in der Spätantike zu einer hauptsächlichen Gottheit der Zauberei (siehe auch Hekate) wurde. Andere mittelalterliche Überlieferungen weisen auf „ekstatische Kulte“ hin.
Ein besonderes Augenmerk richtet Christa Tuczay auf das Verhältnis von Magie und Naturwissenschaft. Fakt ist, dass die Gelehrten des Mittelalters (und auch noch der frühen Neuzeit) selten beide Künste voneinander trennten oder zumindest einzelne Teildisziplinen wie die Astrologie, bestimmte magische Heilpraktiken (z.B. die Alraune, auf die im Buch ebenfalls eingegangen wird) oder Planetenbeschwörungen als zur Wissenschaft gehörig betrachteten. Vielfach wurde zwischen der „magia naturalis“, die die geheimen Kräfte hinter der Natur erforschte, und der Dämonenmagie, die auf dem Teufelspakt beruhte, unterschieden – allerdings wiederum mit sehr verschwommenen Grenzen.
Gesonderte Kapitel behandeln die weiteren Einflüsse, die neben der klassischen Antike die Vorstellungen des Mittelalters bestimmten. Einerseits haben die alteuropäischen germanischen und keltischen Motive und Traditionen in der mittelalterlichen Magie fortgelebt. Andererseits wurde sie stark durch die Zauberpraktiken der Juden und arabische Gelehrsamkeit beeinflusst. Neben der antiken Überlieferung transportierte gerade letztere auch die gnostischen und neuplatonischen Einflüsse, die sich vor allem in den astralmagischen Vorstellungen wie den Planetensphären usw. niederschlugen.
Damit ist die Themenvielfalt des Buches aber immer noch nicht erschöpft. Christa Tuczay widmet sich ebenfalls der Frage nach dem Zusammenhang von Magier und Ketzer, dem Strafprozess, den Gauklern, den Beschreibungen wunderbarer Automaten, dem Bild- und Liebeszauber, den magischen Gestalten der höfischen Literatur, wie dem Nectanebos des Alexanderromans, der Morgana aus dem Artus-Zyklus, dem Klingsor aus der Parzivalsage, den Feenrittern usw. usf.
Unterm Strich
Ich hoffe, dass ich euch ein wenig für das Thema erwärmen konnte. Mit diesem Buch liegt eine faszinierende religionswissenschaftliche Studie vor, die zeigt, wie ambivalent die Magie im Mittelalter betrachtet wurde und woher viele unserer eigenen Vorstellungen von diesem Gegenstand kommen. Die Autorin legt sich dabei nicht auf einen bestimmten Blickwinkel fest, sondern beleuchtet das Thema von verschiedenen Seiten. Das Buch ist im Ton immer sachlich und gut verständlich geschrieben.
Letzteres muss ich allerdings mit einer kleinen kritischen Einschränkung versehen. Mich irritiert häufig der Umgang mit den Übersetzungen der Zitate. Finden sich am Anfang des Buches noch alle lateinischen Stellen ausnahmlos mit Übersetzung, so tauchen zum Ende hin plötzlich solche ohne Übersetzung auf. Genauso unlogisch ist, dass alle altfranzösischen Zitate unübersetzt bleiben.
Ich frage mich, wer unter den Lesern wohl des Altfranzösischen mächtig sein wird. Mit einigen längeren Zitaten in frühneuhochdeutscher Sprache dürfte kaum jemand Schwierigkeiten haben. Allerdings bin ich mir da bei den mittelhochdeutschen Texten nicht so sicher – klar, mit einiger Mühe versteht vielleicht auch ein Laie auf diesem Gebiet zumindest die Grundaussage…
Trotzdem wäre eine Übersetzung leserfreundlicher. Englische Zitate werden gar nicht übersetzt, was für die meisten heutzutage verschmerzbar sein dürfte.
Rein quantitativ betrachtet fallen die unübersetzten Zitate nicht sonderlich ins Gewicht, so dass ich das Buch bedenkenlos empfehlen kann.
Taschenbuch: 395 Seiten
ISBN-13: 9783423340175
www.dtv.de
Der Autor vergibt: