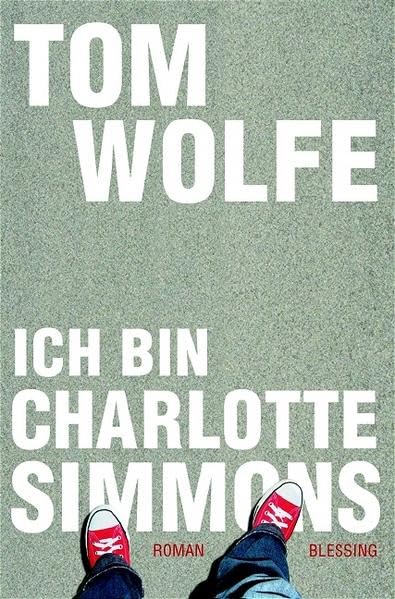Gerne wird Tom Wolfe als Amerikas „Mr. Zeitgeist“ tituliert. Ein Autor, der seinen Finger in die Wunden der heutigen Gesellschaft legt, der die gesellschaftlichen Strömungen auseinander nimmt und dadurch tiefere Einblicke vermittelt. Genau das will er auch mit seinem neuesten Roman „Ich bin Charlotte Simmons“ wieder erreicht haben. Ein Buch, das schon seinem äußeren Anschein nach den Eindruck vermittelt, dass Wolfe durchaus ein literarisches Schwergewicht ist – und das nicht nur, weil der Schmöker ein stolzes Kilo auf die Waage bringt.
Charlotte Simmons ist jung, beneidenswert intelligent und der Stolz von Lehrerschaft und Eltern. Sie schafft mittels Stipendium den Sprung aus einem kleinen 900-Seelen-Kaff in den Bergen North Carolinas an die traditionsreiche Elite-Uni Dupont in Pennsylvania. Für Charlotte geht damit ein Traum in Erfüllung. Endlich findet sie die richtige Heimstatt für ihren überragenden Intellekt. Sie wird auf den Olymp des Wissens ziehen, um mit unzähligen Gleichgesinnten Wissenschaft, Kultur und Bildung zu frönen.
Doch kaum hat das Provinzmädchen sein Studium angetreten, wird es auch schon von der grausamen Realität eingeholt. Der erhoffte Olymp des Wissens entpuppt sich als Paradies der Stumpfsinnigen, die Sex und Alkohol „studieren“. Charlotte ist entsetzt. Hier bringen nicht gute Noten Ansehen und Respekt, sondern nur die angesagtesten Klamotten, ungehemmter Alkoholkonsum bis zur Besinnungslosigkeit und sexuelle Freigiebigkeit. Charlotte, im so genannten „Bible-Belt“ aufgewachsenen und religiös erzogen, ist selbstverständlich noch Jungfrau und würde niemals auf die Idee kommen, Alkohol zu trinken.
Doch auch das Mauerblümchen Charlotte bleibt zu ihrem eigenen Entsetzen vor den Avancen männlicher Studenten nicht verschont, und so sieht sie sich schon nach wenigen Wochen von drei Verehrern umgarnt: Hoyt, dem coolsten Typen auf dem Campus, Jojo, dem weißen Star der Basketballmannschaft, und Adam, der sich für den letzten Intellektuellen am Campus hält. Charlotte entscheidet sich für den Falschen und braucht lange, um sich von der daraus resultierenden Depression zu erholen …
Der Plot klingt zunächst sehr vielversprechend. Wolfe verspricht schonungslos die vorherrschende Jugendkultur zu demaskieren und ganz nebenbei noch mit dem aktuell in Amerika schwelenden Kulturkampf zwischen dem Konservativismus des Mittleren Westens und dem Liberalismus von Ost- und Westküste abzurechnen. Damit packt Wolfe wieder mal ein heißes Eisen an und wird seinem Ruf als „Mr. Zeitgeist“ gerecht.
Wolfe, dessen Wurzeln im Journalismus liegen und der in den Sechzigern zu den Begründern des sogenannten „New Journalism“ gehörte, der den vorherrschenden Reportagestil mit literarischen Stilelementen versetze, scheint hier einen Themenkomplex gefunden zu haben, der genau nach seinem Geschmack ist. Allein optisch könnte der Kontrast zwischen dem Autor und seinen Figuren kaum größer sein: cremefarbene Maßanzüge gegen Schlabberhosen und schief sitzende Baselballkappen.
Der Stoff, der „Ich bin Charlotte Simmons“ zugrunde liegt, bietet in jedem Fall eine Menge Potenzial für eine gleichsam kritische wie auch provokante und ironische Betrachtung. Die ersten Kapitel scheinen dann auch diesen Eindruck zu bestätigen. Wolfe betrachtet zunächst Charlotte in der Provinz und vor allem die Distanz, die dort zwischen Charlotte und ihren Mitschülern herrscht: die Intelligente und der Provinz-Pöbel.
Schon Charlottes Umzug an den Campus von Dupont offenbart ganz neue Gegensätzlichkeiten. Charlotte tritt in eine völlig neue, völlig fremde Welt ein. Schon in ihrem Zimmer trifft sie auf einen Gegensatz, der größer kaum sein könnte. Zimmergenossin Beverly ist all das, was Charlotte nicht ist: reich, weltmännisch, attraktiv, ständig umworben, mit allem neumodischem Schnick-Schnack ausgerüstet und beliebt. Wie Wolfe diese beiden gegensätzlichen Charaktere und ihre Familien aufeinander prallen lässt, wie die Handelnden miteinander umgehen, das macht die ersten Kapitel durchaus zu einem gewissen Lesevergnügen.
Wolfe beobachtet des bunte Treiben am Campus von Dupont mit geradezu pedantischer Genauigkeit und mit einer Detailbesessenheit, die manchmal schon an die Grenze des Vertretbaren stößt. Seitenweise widmet er sich der Dynamik eines einfachen Basketball-Trainingsspiels. Haarklein nimmt er jede Bewegung der Spieler auseinander, seziert ihr Innerstes und beweist damit, dass er sich auf genaues Schildern versteht und dass er dem Leser damit tiefe Einblicke ermöglichen kann.
Dennoch hat man manchmal das Gefühl, er würde in seiner Pedanterie ein wenig über das Ziel hinausschießen. Viele Szenen wiederholen sich, bestimmte Themen werden immer wieder ausführlichst durchgekaut, wie z. B. die Verwunderung der Intellektuellen über die Sportbegeisterung der Mitstudenten. Manchmal hat man dabei das Gefühl, dass Wolfe irgendwie immer seinen eigenen Intellekt heraushängen lässt. Unzählige Beschreibungen durchtrainierter Basketballerkörper, in denen immer wieder alle möglichen Muskelpartien einzeln benannt werden. Ist ja schön, dass Tom Wolfe so gut Bescheid weiß, aber manchmal täte er gut daran, das nicht immer krampfhaft in die Geschichte einbinden zu wollen, um die Handlung mit einem etwas dynamischeren Erzählfluss zu versehen.
Die Thematik an sich bietet Stoff für jede Menge provokanten Witz, für die Ironie der Gegensätzlichkeiten des Alltags, aber durch Wolfes übertriebene Genauigkeit in seinen Schilderungen gerät der Erzählfluss mitunter ein wenig zäh. Seine genauen Beschreibungen mögen noch so meisterhaft sein, sein Blick mag noch so gnadenlos die Mechanismen des Campusgeschehens sezieren, irgendwie fehlt dem Ganzen in letzter Instanz dann doch der gewisse Biss. Etwas schnellere Schnitte und eine etwas flottere Gangart hätten sicherlich Wunder gewirkt und dem Roman seine teilweise kaum zu leugnende Langatmigkeit genommen.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Figuren. Wolfe wechselt immer wieder die Perspektive, schlüpft mal in die Rollen der drei Charlotte-Verehrer Hoyt, Jojo und Adam und erzählt dann wieder aus Charlottes Sicht. Alle vier Hauptfiguren wirken wie wandelnde Klischees: Hoyt, der Aufreißer, Jojo, der „Anabolika-Trottel“, Adam, der intellektuelle Streber und Charlotte, das Mauerblümchen und naive Landei. Eine Entwicklung lässt sich an den Hauptfiguren nur zum Teil und dann auch nur in Ansätzen ablesen, die meisten bleiben stumpfe Stereotypen.
Ein weiteres Problem bringt die Figur der Charlotte mit sich. Man mag ihr das Entsetzen über die ach so grausame, freizügige Realität des Campuslebens nicht so recht abkaufen. Wie weltfremd muss ein Mensch sein, um beim Anblick Tanzender auf einer Party schockiert festzustellen, dass auf der Tanzfläche quasi Geschlechtsverkehr simuliert wird? Auch die Simmons haben zu Hause schließlich einen Fernseher. Wie kann eine Charlotte also entsetzt sein, wenn jemand „Scheiße“ oder „Fuck“ sagt? Man wird das Gefühl nicht los, dass in Charlottes Kopf ein alter Mann hockt, der ihr das schockierte Entsetzen souffliert. Und dieser alte Mann kann dann eigentlich nur Tom Wolfe sein, der ja schließlich auch schon jenseits der Siebzig ist.
Diese Diskrepanz zwischen der konservativen Hauptfigur und der liberalen Realität mag vielleicht den aktuell in den USA tobenden Kulturkampf karikieren, aber ihn anhand einer Charlotte Simmons in dieser Form zu vollziehen, nimmt ihm ein wenig von der provokanten unterschwelligen Kritik. Und so wirkt das Ganze mehr wie der mahnende Zeigefinger der Großeltern, die über den Verfall von Kultur und Sittsamkeit der Jugend besorgt sind. Der Roman selbst verliert so einiges von seiner Schärfe.
Bleibt zusammenfassend ein etwas durchwachsener Eindruck im Gedächtnis. Tom Wolfe weiß mit Worten umzugehen, besitzt eine außerordentlich genaue Beobachtungsgabe und versteht sich darauf, das gesellschaftliche Leben messerscharf zu sezieren. Dennoch wird die Freude an „Ich bin Charlotte Simmons“ auch durch einige Schwächen getrübt. Stellenweise wirkt der Roman ein wenig langatmig, die Figuren sind wandelnde Klischees und bleiben auch am Ende nur als Stereotype in Erinnerung, und Wolfes „schonungsloses Demaskieren der Jugendkultur“ wirkt aufgrund der übergroßen Portion Naivität einer Charlotte Simmons nicht immer ganz glaubwürdig und bissig genug.