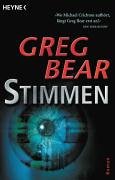Eine neue Kommunikationstechnik zapft bislang unausgelotete Dimensionen des subatomaren Raums an. Klingt kompliziert, doch die Vorteile sind einfach: Man braucht keine Telekom mehr als Vermittler, zahlt keine Vermittlungs- und Leitungsgebühren und muss keine Zeitverzögerung berücksichtigen, außerdem ist die Sprachqualität erste Sahne. Es gibt nur einen Haken: Die Toten melden sich zurück …
Der Autor
Greg Bear wurde 1951 in San Diego, einer wichtigen US-Marinebasis, geboren* und studierte dort englische Literatur. Unter den Top-Hard-SF-Autoren ist er der einzige, der keine naturwissenschaftliche Ausbildung hat. Seit 1975 als freier Schriftsteller tätig, gilt er heute dennoch als einer der ideenreichsten wissenschaftlich orientierten Autoren. Sein zuletzt veröffentlichter Roman „Das Darwin-Virus“, der hierzulande in einem Wissenschaftsverlag erschien, wurde zu einem preisgekrönten Bestseller. Erst damit konnte sich Bear aus dem Science-Fiction-Ghetto herausschreiben, so dass man ihn heute ohne weiteres mit Michael Crichton vergleicht. Nur dass Bear da anfängt, wo Crichton aufhört. Dieses Jahr erschien bei uns „Die Darwin-Kinder“, die Fortsetzung von „Darwin-Virus“, im Dezember wird der Roman „Stimmen“ bei |Heyne| veröffentlicht.
* Einer der Hauptakteure in „Jäger“ ist Weltkriegsveteran und Marinehistoriker in der Nähe von San Diego.
Bear hat eine ganze Reihe von Science-Fiction- und Fantasyzyklen verfasst. Die wichtigsten davon sind (HSF = Heyne Science-Fiction):
– Die Thistledown-Trilogie: „Äon“ (HSF 06/4433), „Ewigkeit“ (HSF 06/4916); „Legacy“ (bislang unübersetzt).
– Der Amboss-Zyklus: „Die Schmiede Gottes“ (HSF 06/4617); „Der Amboss der Sterne“ (HSF 06/5510).
– Der Sidhe-Zyklus: „Das Lied der Macht“ (06/4382); „Der Schlangenmagier“ (06/4569).
Weitere wichtige Werke: „Blutmusik“ (06/4480), „Königin der Engel“ (06/4954), „Slant“ (06/6357) und „Heimat Mars“ (06/5922). Er hat zudem Beiträge für die Buchreihen des Foundation-, Star-Trek- und Star-Wars-Universums geschrieben.
Mehr zu Greg Bear unter: http://www.gregbear.com
Handlung
Peter Russell, 58, war früher mal ein Schriftsteller, Fotograf und halbwegs erfolgreicher Softpornoregisseur in Los Angeles, aber das ist schon eine Weile her. Seitdem er nämlich vor über einem Dutzend Jahren den reichen Filmproduzenten und Immobilienhändler Joseph Benoliel und dessen schöne, freundliche Gattin Michelle kennen gelernt hat, ist er nur noch deren Laufbursche. Diese Aufträge als Mädchen für alles sind lukrativer als das Filmen. Zumal er eine Frau und Tochter zu ernähren hat: Helen und Lindsey.
Das Bedauern über die verlorenen Träume der Jugend wächst sich für Peter zu einer seelischen Krise aus, als am selben Tag sein Jugendfreund Philip stirbt und er eine geheimnisvolle Frau namens Sandaji trifft. Diesem Medium soll er in Benoliels Auftrag nur eine einzige Frage stellen: „Kann jemand ohne Seele leben?“. Kurz darauf sieht er den Geist eines Jungen in einer hundert Jahre alten Tracht in Sandajis Haus. Er erinnert sich an seine tote Tochter Daniella, die auf grausame Weise ermordet wurde, ohne dass diese Tat bislang aufgeklärt worden wäre. Helen und Lindsey, Daniellas Zwillingsschwester, sind ausgezogen, als Peter nach dem Verlust seines Lieblings dem Alkohol verfiel.
Diese Vision ist ihm – zunächst – ebenso unerklärlich wie das, was ihm in Phils Haus nahe San Francisco widerfährt. Dort findet eine kleine Totenfeier statt, an der natürlich auch Phils Ex-Ehefrau Lydia teilnimmt. Phils Haus ist bis zur Decke vollgestopft mit Comicheften und Büchern, aber das ist es nicht, was Peter stört. Als er übernachtet, wird er von einem Schrei geweckt: Eine Vision von Lydia beklagt Phils Tod, doch ihre Geistergestalt ist umgeben von schwarzen Schatten, die über sie herfallen …
Doch wo ist Phil eigentlich gestorben? Im Wohnmobil findet Peter endlich eine letzte Botschaft seines besten Freundes – und schon wieder Schatten. Als einziges Erinnerungsstück nimmt Peter ein schönes Schachspiel mit populären Figuren mit, das u. a. Monster, eine wunderschöne Marsprinzessin und Detektive im Trenchcoat umfasst.
Lydia hat sich seine letzten paar Kröten geschnappt, deshalb ist er total froh über den Anruf von Stanley Weinstein, dem Marketingmanager von Trans, einer Firma mit einem neuartigen Telekommunikationssystem. Schon bei Benoloiel hat Weinstein Peter eine ganze Ladung von seinen handyartigen Endgeräten („Nennen Sie es nie ein Handy!“) in die Hand gedrückt, und Peter hat ständig eines bei sich. Wenn er mit seinem Kumpel Hank, der gerade in Prag dreht, telefoniert, ist die Sprachqualität fantastisch.
Weinstein will, dass Peter eine Werbekampagne mit Spots und so konzipiert. Zunächst ist Peter begeistert: ein rettender Strohhalm! Doch als er den Trans-Firmensitz begutachtet, kommen ihm erste Bedenken: Es handelt sich um den Todestrakt des aufgelassenen San-Andreas-Gefängnisses. Und der Transponder, der die Trans-Kommunikation ermöglicht, steht im Zentrum des Komplexes: in der ehemaligen Gaskammer. Nur der Cheftechniker, ein Ukrainer mit deutsch-ungarischem Namen, scheint in Ordnung zu sein. Peter macht, dass er wegkommt – mit einem dicken Vorschussscheck.
Ist Peters Seelenleben schon ein wenig in die Schieflage geraten, so gibt ihm das nächste Ereignis quasi den Rest: Seine Tochter Daniella meldet sich aus dem Totenreich zurück. Das erschüttert ihn umso mehr, als er sie zunächst für ihre Schwester Lindsey gehalten hat, die er erwartet hatte. Daniella sieht so lebensecht aus, dass er sie streichelt und mit ihr spricht. Kein Wunder, denn Daniella ist stets in seinen Gedanken und seinem Herzen, denn er kann sie nicht loslassen, bis das Geheimnis ihres Todes gelöst ist.
Erst als er die furchtbare Wahrheit erkennt, bemerkt er auch die Schatten, die in den Ecken des Zimmers lauern und darauf warten, sich auf das Gespenst zu stürzen. Etwas geht vor sich, und es scheint nicht gut für die Lebenden zu sein. Peter ist keineswegs der einzige, der Gespenster sieht.
Nach einem weiteren Gespräch mit dem Medium Sandaji und ihrem 105 Jahre alten Mann Schelling, der im 1. Weltkrieg ebenfalls solche Gespenster oder Wiedergänger sah, wird Peter einiges über den Zusammenhang zwischen Trans und der Rückkehr der Toten (und ihrer dunklen Feinde) klar. Er sieht einen Weg, alle Rätsel um Daniellas Tod zu lösen und sie zu rächen.
Mein Eindruck
Zunächst liest sich „Stimmen“ wie ein Gesellschaftsporträt-Krimi von Raymond Chandler. Man erinnere sich auch an die riesigen Anwesen und Herrenhäuser, die in Roman Polanskis Film „Chinatown“ vorkommen. Das ist die mondäne Seite von Los Angeles, aber auch die morbide Unterseite des Glamourstädtchens Hollywood. Warum sollte ein reicher, mächtiger Mann wie Joseph Benoliel anfragen lassen, ob es möglich sei, ohne eine Seele zu leben?
Nicht nur die Gemütsverfassung, auf die diese Frage schließen lässt, gibt Peter Russell Anlass zur Sorge. Es ist auch die makabre Vergangenheit des Benoliel-Anwesens Salammbo: Hier sind etliche Menschen gestorben, ein Brand ist ausgebrochen und der Tunnel, der zwei Häuser verbindet, begrub bei seinem Einsturz Leute unter sich. Manche davon waren Filmsternchen, die sich bei den Filmproduzenten, die hier residierten, die Klinke in die Hand gaben. Wo sind sie geblieben?
Fotograf und Regisseur Peter Russell weiß aus eigener Erfahrung, was aus Filmsternchen wird, aus Fotomodellen und Pornodarstellerinnen. Er hat selbst mit einigen davon zusammengelebt. Sie scheinen alle etwas von ihrer Substanz, ihrer Seele zu verlieren, während sie in den Filmhimmel aufsteigen. Und in einem Studio für Computergrafik (CGI) bekommt er vorgeführt, was die moderne Technik mit ihnen anstellt: Jane Russell, Bettie Page und Jean Harlow stehen auf Knopfdruck in jeder Weise zu Diensten und reagieren per interaktiver Spracherkennung auf jeden Befehl ihres „Meisters“.
Lovecraft reloaded
Doch die Trans-Technik geht noch einen unheimlichen Schritt weiter. Es gibt Gespenster bzw. Wiedergänger, die über den Kanal, den das Trans im subatomaren Bereich geöffnet hat, zurückkommen. Und sie sind nicht allein. Unheimliche Wesen stürzen sich auf sie, Räuber, deren Aufgabe darin besteht, die aus Erinnerungen aufgebauten Wiedergänger zu vernichten. Und es erscheint Peter Russell – und Daniella – möglich, dass diese schwarzen Aasfresser es nicht bei den Toten belassen, sondern sich ihr Appetit auch auf die Lebenden erstreckt …
Ist die Raymond-Chandler-Atmosphäre schon zunehmend in ein Dean-Koontz- und Richard-Matheson-Szenario umgeschwungen, so bringt das letzte Drittel eindeutigen den Eintritt in das unheimlichste aller Horroruniversen: das von H. P. Lovecraft. Hier bleibt es nicht mehr bei Wiedergängern und ihren Ghulen, sondern die sich daraus ergebenden Kombinationsmöglichkeiten drohen Peter den Verstand zu rauben – oder zuerst die Seele?
Eine Art Erlösung
Das klingt, als würde sich Peter Russell als „John Sinclair, Geisterjäger“ oder „Buffy the Vampire-slayer“ versuchen. Nichts könnte ferner liegen. Dafür ist Peter ist viel zu erfahren und zu bodenständig. Das wären Jobs für Halbwüchsige und Twens, doch Peter ist fast sechzig und steht wohl kurz vor einem Herzinfarkt.
Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, warum der Autor so viel Wert auf die Schilderung des Innen- und Außenlebens seiner Hauptfigur legt. Erst ganz allmählich beginnt man sich zu fragen, was mit ihm nicht stimmt. Und eine Menge Fragen müssen eine nach der anderen, aber hübsch der Reihe nach beantwortet werden. Daniella heißt der Poe’sche Alb, der Peter auf der Seele liegt. Und erst wenn dieses Problem gelöst ist, können Peter und seine Familie Erlösung finden und in die Zukunft blicken. Vorausgesetzt, Peter geht einen langen Weg durch Schmerz und Horror und befreit dabei Daniella ebenso wie sich und Lindsey.
Dass dies auf glaubwürdige Weise gelingt und der Prozess den Leser ebenso bewegt wie die Figuren, hinterlässt eine sehr befriedigendes Gefühl.
Unterm Strich
Anders als in dem überdrehten [„Jäger“ 487 lässt der Autor es hier langsam angehen – vielleicht zu langsam für Leute, die sich Actionhorror erhoffen. Die Ahnenliste, die vor Beginn des Buches steht – Fritz Leiber, Arthur Machen, Richard Matheson usw. – deutet es bereits an: Hier geht es um subtilen, unheimlichen Horror, der weit tiefer unter die Haut geht als die gängige John-Sinclair- und Buffy-Serienkost.
So schräge Konzepte, wie sie in Spike Jonze’s Film „Being Malkovich“ zur Sprache kommen, oder auch Ideen, die sich in Dan Simmons‘ fabelhaftem Geister-Thriller „A Winter haunting“ finden – die hat Bear sich offenbar zu Herzen genommen und ein Garn gestrickt, das zwar ganz im Diesseits angesiedelt ist, uns aber den Einbruch des Jenseits, der Geisterwelt, als eine reale und sehr erschreckende Möglichkeit ausmalt. Und nur der Wechsel der Perspektive reicht aus, um aus dem Gezeigten ein Wunderland zu machen. Man denke etwa an „The Others“.
Die Episode aus dem 1. Weltkrieg, die Schelling so lebensnah und plastisch schildert, hat mich an den Anfang von Tad Williams‘ [„Otherland“ 603 erinnert. Auch dort erscheinen seltsame Geister im Schützengraben. Doch wenn die ganze Welt – eben „Otherland“ – virtuell ist, macht das nichts aus. In „Stimmen“ hingegen ist die Welt real, und das Auftreten der Wiedergänger ist um daher um einige Grade bedrohlicher.
Ich konnte „Stimmen“ in einem Rutsch durchlesen, weil es einerseits spannend wie ein Chandler-Krimi und genau recherchiert ist, sich aber andererseits – erfolgreich, wie ich meine – bemüht, den Leser am Schicksal und den Kämpfen der Hauptfigur teilhaben zu haben. Das erfordert psychologisches Feingefühl, denn es ist so leicht, beispielsweise eine Empfindung falsch zu schildern oder zu interpretieren, und schon war alle Mühe umsonst: Die Figur erscheint unglaubwürdig. Zum Glück umschiffte Bear diese Klippen und verschaffte mir ein schönes Leseerlebnis: ein Gleichnis auf die Geister, die in Hollywood erzeugt werden, jeden Tag.
Die Übersetzung
Usch Kiausch ist eine sehr gute Kennerin der Sprachen und Dialekte, die in Großbritannien und den Vereinigten Staaten gesprochen werden. Sie hat zahlreiche Interviews mit amerikanischen Science-Fiction-Schriftstellern geführt und veröffentlicht. „Stimmen“ ist keineswegs ihre erste Übersetzung.
Sie lässt die Sätze, die die Figuren sprechen, natürlich klingen und zwar so, wie sich auch ein Deutscher in der Umgangssprache ausdrücken würde – wenn er gut erzogen ist und über ein gewisses Bildungsniveau verfügt. Hier wird kaum je geflucht, und viele Ausdrücke werden zusammengezogen.
Erfreulich sind nicht nur die genauen Entsprechungen der gebrauchten Stilfiguren und Redensarten, sondern zudem die Fußnoten, in denen zum Beispiel erklärt, warum an dieser Stelle Humpty Dumpty eine besondere Bedeutung hat. Diese Figur aus „Alice hinter den Spiegeln“ ist ein Symbol für eine Sache, die unwiederbringlich verloren ist. Auch der Filmtitel „All the President’s Men“ – deutsch „Die Unbestechlichen“ – bezieht sich darauf (und ersetzt die Zeile „all the king’s men“) und assoziiert so, dass Richard Nixon wie Humpty Dumpty ist: Er saß auf einer hohen Mauer und tat einen tiefen Sturz.
Postskriptum: Fast hätte ich es vergessen: Ihr seid die nächsten! Ihr habt doch alle ein Handy, oder?
Taschenbuch: 384 Seiten.
O-Titel: Dead Lines (2004)
Aus dem Englischen von unbekannt.
ISBN-13: 9783453400115
Der Autor vergibt: