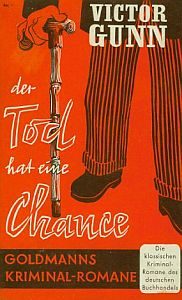
Das geschieht:
Great Bassington, ein Dorf in der englischen Grafschaft Essex: Herbert „Bertie“ Cartwright, ein gefeierter Flieger und Versuchspilot, hat sich in die blutjunge Jill Anderson verliebt. Gern würde er sie bitten seine Frau zu werden, doch zuvor möchte er sein unstetes Leben ändern und eine Flugschule eröffnen. Das Startkapital soll ihm Sir Herbert Cartwright, sein Erbonkel, vorschießen, der indes, Landjunker der ganz alten Schule, von solchem neumodischen Unsinn gar nichts hält.
Eine Wette soll ihn umstimmen. Gerade wurde Bertie vom übereifrigen Inspektor Vickery zu Unrecht eines Verbrechens beschuldigt. Zwar konnte die Angelegenheit zu seinen Gunsten aufgeklärt werden, doch Sir Herbert ist dennoch empört über die Anmaßung des Beamten. Deshalb ist er einverstanden, als Bertie Vickery foppen will: Der Neffe wird vorgeben den Onkel zu ermorden. Am nächsten Morgen wird Sir Herbert Bassington Hall ohnehin verlassen und zur Jagd nach Schottland reisen. Aus dem Urlaub soll er später quicklebendig zurückkehren und Vickery, der sicherlich Bertie verhaften wird, als Dummkopf bloßstellen. Glückt der Streich, will Sir Herbert die Pilotenschule finanzieren. Dr. John Handie und Willy Shotter, zwei alte und vom Alkohol befeuerte Freunde des Hauses, besiegeln die Wette.
In der Nacht produziert Bertie eifrig Beweise und ‚streitet‘ laut mit dem Onkel. Die Rechnung geht auf, Inspektor Vickery wird gerufen und bringt sogar Polizeirat Ingles, seinen Chef, mit. Bertie lässt sich festnehmen und frohlockt – bis man Sir Herbert mit eingeschlagenem Schädel aus einem nahe gelegenen Teich zieht. Jetzt sieht es übel für Bertie aus, denn er war allzu tüchtig als Verdächtiger. Zu seinem Glück machen zwei berühmte Beamte von Scotland Yard, Chefinspektor Bill Cromwell, genannt „Old Iron“, und sein Assistent Johnny Lister, Urlaub in Great Bassington. Von Jill, die an Berties Unschuld glaubt, zu Hilfe gerufen, mischt das Duo sich in die Ermittlung ein …
Feudale Späßchen mit der Staatsmacht
Kryptische Plots sind im klassischen Kriminalroman nicht nur keine Seltenheit, sondern geradezu typisch für das Genre. Die Jagd auf den Mörder will schließlich so verschleiert werden, dass die finale Auflösung möglichst überraschend ausfällt. Realitätsnähe ist dagegen weniger verpflichtend, obwohl die Ermittlung der Fairness halber den Gesetzen der Logik zu gehorchen hat. Um der Spannung willen dürfen diese aber durchaus ein wenig gestreckt und verbogen werden.
Was sich Victor Gunn in „Der Tod hat eine Chance“ leistet, ist allerdings starker Tobak: Da tun sich in geselliger Runde gleich mehrere gestandene und prinzipiell vorbildhafte Mitglieder der Gesellschaft zusammen und hecken zu ihrem Vergnügen einen Plan aus, der eindeutig den Tatbestand dessen erfüllt, was das Gesetz „Vortäuschung einer Straftat“ nennt und als solche hart bestraft.
Dies war im England des Jahres 1945 anders, wenn man Gunn Glauben schenken möchte. Der (mit keinem Wort erwähnte) II. Weltkrieg ist gerade verstrichen, doch zumindest in Great Bassington scheint die Zeit zu einem deutlich früheren Zeitpunkt stehengeblieben zu sein. Der Adel treibt seine Possen mit dem Pöbel, zu dem die niederen Ränge der Polizei eindeutig zählen. Furcht vor eventuellen Konsequenzen hat die fröhliche Runde nicht; mehrfach erwähnt Sir Herbert seine persönliche Bekanntschaft mit hochrangigen Gesetzeshütern, die den ‚Spaß‘ decken werden.
Von hinten durch die Brust ins Auge
Das seltsame Treiben der Reichen & Mächtigen ist notwendiges Element eines Plots, für den das Adjektiv „konstruiert“ geradezu erfunden wurde. Kein Problem für Victor Gunn, der unter seinen zahlreichen Pseudonymen zu den produktivsten Autoren aller Zeiten gehören dürfte: Er beginnt mit einer Idee, hält an ihr fest und trotzt unerschütterlich allen Einwänden. Routine und Tempo sind seine Gegenmittel, irgendwie wird er die Kurve schon wieder kriegen – und siehe da: Es funktioniert!
„Der Tod hat eine Chance“ ist als Roman weder raffiniert noch elegant. Der Plot ist grotesk, die Umsetzung schwerfällig, der Stil – zumal in der deutschen Übersetzung – gestelzt und oft unfreiwillig komisch. Auf der anderen Seite sind die Jahre dem Roman (unverdient) gut bekommen. Die Vergehen gegen die Regeln des Genres sind verjährt, die Künstlichkeit der Kulisse ist plötzlich von Vorteil. Unterhaltung ist dem Gros der Krimifreunde zudem seit jeher wichtiger als Originalität. In diesem Punkt siegt Gunn nach Punkten: Das naive Geschehen amüsiert als ‚typischer‘ Krimi einer versunkenen Ära.
Gunns handwerkliches Geschick trägt seinen Teil bei. Immer wenn man der Leser glaubt, jetzt sei es der unwahrscheinlichen Wendungen und aufgesetzten Effekte aber genug, überrascht der Verfasser mit echten „Whodunit“-Elementen. In der zweiten Hälfte wird „Der Tod hat eine Chance“ zum Krimi. Indizien werden gefunden und entweder ignoriert (Ingles) oder klug ausgewertet (Cromwell). Das Tempo zieht an, die Spannung steigt. Geschickt lässt Gunn die ermittelnden Beamten (und Konkurrenten) „Glatzkopf“ Ingles“ und „Old Iron“ Cromwell dabei zu gänzlich unterschiedlichen Deutungen gelangen.
Alte Bekannte aus dem Reich Schema F
Ein eiliger Autor wie Gunn setzt auf Routine. Dazu gehören Figuren, die aus der Klischee-Kiste gezogen werden. Ihre Eindimensionalität gilt es gegen den Aufwand anzurechnen, den es kosten würde originell zu sein. Gunn bleibt ökonomisch. Viele Zeilen füllt er mit den üblichen Geplänkeln zwischen „Old Iron“ Cromwell und Johnny Lister. Der eine ist der Archetyp des knarzigen Ermittler-Genies, das sich – ein wenig zu aufgesetzt – als Exzentriker tarnt, der andere erledigt – eher Archie Goodwin als Dr. Watson – die Lauf- und Rauf-Arbeit und lässt den Meister erst recht glänzen.
Zweieinhalb Jahrzehnte trat das Duo Cromwell/Lister praktisch unverändert auf, während (und obwohl) die Welt sich weiter drehte; Gunn muss also etwas richtig gemacht haben bzw. seine Nische gefunden haben. Nostalgie dürfte neben der leicht variierten Wiederkehr des Geläufigen ein Erfolgsfaktor gewesen sein. Die unerfreulich reale Welt bleibt erfreulich fern in den ‚Thrillern‘ des Victor Gunn. Vor unserem geistigen Auge nehmen kuriose Charaktere wie Sir Herbert Cartwright oder Neffe Bertie mühelos Gestalt an. Sie gesellen sich zu den biederen Dorfpolizisten, schlichtgeistigen Bediensteten, schwatzhaften Gastwirten und vielen anderen Witzfiguren, mit denen (nicht nur) Gunn die britische Krimi-Provinz bevölkert.
Frauen sind in diesem Kosmos entweder Mutter, Schwester, Kind oder potenzielle Gattin. Jill Andersons Freigeistigkeit erschöpft sich darin, im heißen Sommer nackt baden zu gehen. Dass ein mehr als doppelt so alter Mann um sie freit, findet sie keineswegs merkwürdig. Wieso auch, halten doch alle Beteiligten den guten Bertie für eine „gute Partie“ und einen „Mann in den besten Jahren“.
Fassen wir zusammen: Einen Klassiker kann man diesen Roman beim besten Willen nicht nennen. Er lebt von der Attraktion einer lang laufenden Serie, die von ihren zeitgenössischen Lesern lieb gewonnen wurde. Heute mag primär das schamlose (und legitime) Vergnügen am Schwelgen in einer Krimi-Märchenwelt im Vordergrund stehen. Das ist kein grundsätzliches Verdikt, denn viele altehrwürdige Krimi-Klassiker funktionieren so. Um den genannten Klassiker-Status zu erreichen fehlt den Gunn-Thrillern indes jener geniale Funke, der sie zeitlos machen würde.
Autor
Der Engländer Victor Gunn (1889-1965), dessen richtiger Name Edwy Searles Brooks lautete, war als Unterhaltungs-Schriftsteller ein Vollprofi. Er verfasste für Zeitschriften und Magazine über 800 (!) Romane und unzählige Kurzgeschichten – genaue Zahlen werden sich vermutlich nie ermitteln lassen – unterschiedlichster Genres, wobei er sich diverser Pseudonyme bediente. Der nome de plume „Victor Gunn“ blieb jenen 43 Romanen und Storysammlungen vorbehalten, die Brooks zwischen 1939 und 1965 um den knurrig-genialen Inspektor William Cromwell und seinen lebenslustigen Assistenten Johnny Lister verfasste.
In Deutschland ist Gunn vom Buchmarkt verschwunden. Dabei ließ sich sein Erfolg einmal durchaus mit dem seines Schriftsteller-Kollegen Edgar Wallace messen. Eine stolze Auflage von 1,6 Millionen meldete der Goldmann-Verlag, der Brooks als Victor Gunn hierzulande exklusiv verlegte, schon 1964 – eine Zahl, die sich in den folgenden Jahren noch beträchtlich erhöht haben dürfte, bis ab 1990 die Flut der ständigen Neuauflagen verebbte.
Taschenbuch: 190 Seiten
Originaltitel: Nice Day for a Murder (London : Collins 1945)
Übersetzung: Gisela Böttcher
http://www.randomhouse.de/goldmann
Der Autor vergibt: 




