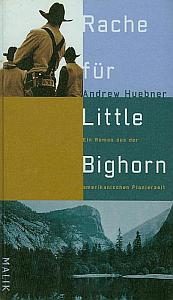
Das geschieht:
An einem heißen Sommertag lernt eine Kompanie junger Kavallerie-Soldaten in den Black Hills, einer hügeligen Landschaft im Süden des US-Staats Montana, das Grauen kennen. General George Armstrong Custer, der arrogante und erfolgssüchtige ‚Held‘ diverser Bürgerkriegsfeldzüge und Indianerkriege, hat sich von den vereinigten Stämmen der Sioux und Cheyenne in eine Falle locken lassen. Am Little Bighorn lassen die Häuptlinge Gall und Crazy Horse Custer und das gesamte 7. Kavallerieregiment aufreiben – am 25. Juli 1876 sterben 265 Männer. (Politisch korrekte Anmerkung: Die Zahl der gefallenen Indianer ist unbekannt; sie wird ungleich höher gewesen sein.)
Am Tag danach stoßen Armeescouts auf das Schlachtfeld. Die Leichen wurden von den nach zahlreichen Vertragsbrüchen wütenden Indianern ausgeraubt und zerstückelt. Die jungen Soldaten müssen die Überreste ihrer Kameraden bergen und bestatten. Der Horror, den sie dabei erleben, wird für den Rest ihres Lebens ihr Begleiter bleiben und sie auf unterschiedliche Weisen prägen. In einem Punkt sind sich die Soldaten einig: Diese Bluttat der „Wilden“ muss gesühnt werden!
Der Krieg gegen die Indianer gewinnt eine fatale neue Dimension. Rache und Mordlust lassen eventuelle Vorbehalte schwinden. Unbarmherzig setzen die Männer den „roten Mördern“ nach. Sie finden nur jene, die nicht schnell genug flüchten können: Frauen, Kinder, Alte – Unschuldige, die in ihren Dörfern für den Triumph der Krieger bitter bezahlen. In einer Gewaltorgie metzeln die Soldaten ihre „Gegner“ nieder. Sie kennen keine Gnade, und nur wenige bemerken, dass sie jene an Grausamkeit weit übertreffen, die sie strafen wollen …
Geschichte als Strudel
Dieses Buch ist ebenso historischer Roman wie der Versuch einer Beschwörung: In der Familie des Verfassers Andrew Huebner gilt der Ur-Ur-Großvater als mythische Gestalt, die vom Atem der wahren amerikanischen Geschichte gestreift wurde: August Huebner gehörte zu den ersten Soldaten, die den Little Bighorn nach dem verhängnisvollen 25. Juli 1876 betraten und sahen, was geschehen war. Leicht hätte der ältere August selbst zu den Opfern gehören können; offenbar hatte ein gnädiges Schicksal ihn gerettet – und seine späteren Nachkommen ebenfalls, die es sonst natürlich nicht gegeben hätte, wie sie sich immer wieder erzählten.
Ansonsten gibt es wenige Details über das Leben von August Huebner, was Andrew zu Gute kam, denn ihm blieb die Freiheit, die Überlieferungslücken mit einer eigenen Geschichte zu füllen. Die hält sich mehr oder weniger an die historischen Fakten, ist aber keine historische Rekonstruktion und Interpretation, sondern vor allem eine Lektion über die Gewalt und wie sie die Menschen verwandelt, dies veranschaulicht am Beispiel dreier junger Männer.
Mit Erklärungen halten sich die Zeitgenossen und Zeugen von Little Bighorn nicht auf. Mancher ahnt die wahren Zusammenhänge – das Indianer-Problem soll letztlich durch die Ausrottung der lästigen „Rothäute“ gelöst werden; die Soldaten haben diese Drecksarbeit zu übernehmen. Huebner spart dies weitgehend aus und konzentriert sich auf das Geschehen. Seine Protagonisten sind Teil der Ereignisse, steuern sie jedoch nicht, sondern geraten in ihren Sog und werden von ihnen bestimmt.
‚Gut‘ oder ‚böse‘ aber auf jeden Fall tot
Huebner ergreift keine Partei. Er beschränkt sich auf die Fakten. Die haben es – präsentiert in der nüchternen, fast dokumentarischen Sprache des Verfassers – freilich in sich. Die Schlacht am Little Bighorn wird heute politisch korrekt gern als ‚verdiente‘ Lektion für die verlogenen Weißen durch die edlen, geknechteten, in die Enge getriebenen Ureinwohner gedeutet.
Tatsächlich war es ein Massaker durch die Indianer und als solches eine Reaktion auf frühere Massaker der Soldaten, die Little Bighorn wiederum weitere Massaker folgen ließen; eine endlose Kette des Mordens. ‚Täter‘ und ‚Opfer‘ wechselten dabei ständig ihre Rollen, aber bekanntlich waren es die Indianer, die schließlich den Kürzeren zogen – nicht weil sie nicht mehr kämpfen wollten, sondern weil sie es nicht mehr konnten.
„Weiß“ und „Rot“ vereinigten sich zu einer Nation: Sie wurden „Amerikaner eines Blutes“; nicht des Blutes, das gemeinsam durch ihre Adern floss, sondern des Blutes, das auf beiden Seiten vergossen wurde. Auch dieses Blut ist dicker als Wasser, sodass die Erinnerung an Little Bighorn und an die Indianerkriege – nur eine von vielen gewaltreichen Episoden der US-Geschichte – weiterhin präsent ist. Das betrifft – Huebner stellt es heraus – nicht nur das Verhältnis zwischen den Ureinwohnern und den Neuankömmlingen, sondern eben auch die „separaten“ Geschichten der ehemaligen Gegner: Die Soldaten sind alles andere als eine Gemeinschaft verschworener Waffenbrüder, und die Indianer bringen einander um, weil sie selbst alte Rechnungen miteinander zu begleichen haben.
Hilflos im Strom der Ereignisse treibend
Drei junge Männer in der Krise: Voller Elan und Ideale sind sie in einen ‚gerechten‘ Krieg gegen die „Wilden“ gezogen, die sich gegen die wohlmeinende Vorherrschaft der weißen Herren wehren, welche faktisch sowieso nicht mehr in Frage zu stellen ist. Wieso beugen sich die offenbar unbelehrbaren Indianer nicht und machen stattdessen weiterhin Besitzrechte an kostbarem Weide- und Ackerland geltend, das die ‚neuen‘ Amerikaner viel produktiver nutzen können und wollen?
Dass es so einfach nicht ist, müssen James H. Bradley, William Gentle und Augustus Huebner auf die denkbar härteste Art lernen. Bradley fällt dies am schwersten, denn er ist besonders anfällig für den Wahnsinn, der dem Krieg innewohnt. Er leidet psychisch, verändert sich, entwickelt ein Trauma, das ihn nicht wieder loslässt. Gentle ist geistig scheinbar schlichter gestrickt. Als Waisenkind, das sein Alter gefälscht hat, um sich in die Armee einschreiben zu können, sucht er die Anerkennung der älteren Kameraden. Gleichzeitig kann er seine Faszination für die Indianer, die er verfolgt und tötet, nicht verhehlen. Huebner kennt die Städte des Ostens, in denen die Industrialisierung die Menschen zu gefährlicher, schmutziger, schlecht bezahlter Schwerarbeit zwingt und in üblen Slums zusammenpfercht. Er hasst die Hoffnungslosigkeit dieser modernen Arbeitssklaverei und bringt lieber Indianer um.
Huebner verlässt seine Figuren ein Jahr nach Little Bighorn. Da ist einer aus dem Trio tot, ein anderer zum frömmelnden, verwirrten Mörder geworden, der dritte hat resigniert und fügt sich immer neuen Mordeinsätzen der Armee. Ein düsteres Finale ohne Auflösung; es wird deutlich, dass die Überlebenden weitermachen werden wie bisher; kein Wunder, dass „Rache für Little Bighorn“ eher von der Kritik als vom lesenden Publikum geschätzt wird! Wer sich vom komplexen Stoff nicht schrecken lässt, wird jedoch mit einer nachdenklich stimmenden, aber niemals langweiligen Lektüre belohnt.
P. S.: Der Übersetzer hat gute Arbeit geleistet, aber selbst der im Militärischen Unbewanderte wundert sich über Ränge wie „Rittmeister“ oder gar „Wachtmeister“, die es angeblich in der US-Kavallerie gegeben haben soll. Hier hätten die ursprünglichen Bezeichnungen übernommen werden sollen bzw. wären einige einschlägige Recherchen ratsam gewesen.
Gebunden: 281 Seiten
Originalausgabe: American by Blood (New York : Simon & Schuster, Inc. 2000)
Übersetzung: Karl-Heinz Ebnet
http://www.piper.de/verlag/malik
Der Autor vergibt: 




