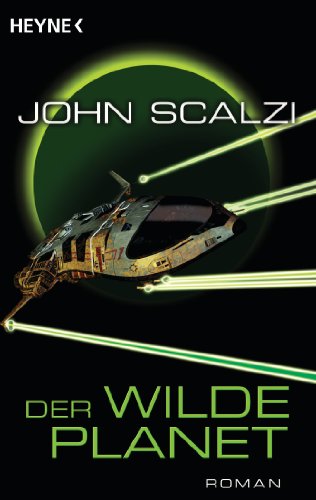
Das geschieht:
Nachdem er in seiner Karriere als Jurist auf der Erde Schiffbruch erlitten hat, hält sich Jack Holloway dem Heimatplaneten lieber fern. Er verdient sich den Lebensunterhalt als Prospektor. Im Auftrag der mächtigen Zarathustra Corporation untersucht er Planeten auf Bodenschätze, die lukrativ im großen Maßstab abgebaut werden können.
Derzeit ist Holloway auf Zara XXIII tätig, einem erdähnlichen Planeten, dessen Fauna vor allem aus raubgierigen Reptilien besteht. Die daraus resultierenden Gefahren werden durch die Chance auf enorme Gewinne ausgeglichen. Holloway findet zufällig eine Ader der wertvollen Sonnensteine, die ihn zum Milliardär machen werden.
Über diese Entdeckung vergisst Holloway zunächst eine seltsame Begegnung. In seiner Prospektoren-Hütte bekommt er Besuch von einer Spezies, von der niemand bisher wusste. Die „Fuzzys“, wie Holloway sie nennt, sind katzengroße, affenähnlich geschickte Wesen, die rasch Zutrauen zu ihm fassen und durch einen erstaunlichen Nachahmungstrieb verblüffen.
Als freundliche Geste informiert Holloway die Biologin Isabel Wangai, eine ehemalige Lebensgefährtin, über die Fuzzys. Sie kommt zu dem Schluss, dass diese Intelligenzwesen sind, was fatale Auswirkungen hätte, weil die Zarathustra Corporation den Planeten räumen müsste. Doch Wheaton Aubrey VII., der Eigentümer, gedenkt dies keineswegs zu tun. Sollte ein Heer gekaufter Anwälte Wangai nicht mundtot machen können, gibt es immer noch Joe DeLise, einen korrupten Sicherheitsmann, der Holloway hasst und dem Skrupel unbekannt sind: Keine Fuzzys – kein Förderungsstopp, kein Holloway – kein Wissen über die Fuzzys, so Aubreys brutale Logik, der rasch entsprechende Mordtaten folgen. Auf Zara XXIII steht Holloway mit einer kleinen Schar aufrechter Verbündeter auf verlorenem Posten, bis Unterstützung aus gänzlich unerwarteter Richtung naht …
Fuzzy 2.0
Als „Star Trek“ sich im Reboot neu erfand, wurde eine Saat gelegt, die nun austreibt. Man kann eine alte Geschichte einfach noch einmal erzählen. Die Filmindustrie kennt und liebt das „Remake“: die Neuverfilmung eines Erfolges, wobei zwischen Original und Neufassung in der Regel mehrere Jahre liegen. Die Story hat sich bereits bewährt und dürfte auch als zweiter Aufguss funktionieren, zumal sie diversen Modifikationen unterzogen wird.
Doch wäre es nicht noch besser, wenn man sich diese Arbeit sparen und eine Neuversion auf den Markt bringen könnte, die das Produkt – den Film oder in unserem Fall das Buch – einfach nur dem aktuellen Kundengeschmack anpasst? Nachdem Gus van Sant 1998 mit seiner Eins-zu-eins-Kopie von Hitchcocks „Psycho“ vorgeführt hatte, wie man es nicht machen darf, gehört John Scalzi zu einer Generation von Nacherzählern, die begriffen haben, dass ein Mindestmaß an Innovation (= Einsatz von Hirnschmalz) auch beim Reboot (leider) nicht gänzlich unvermeidbar ist. Wird dies berücksichtigt, eröffnen sich der Unterhaltungsindustrie neue Welten: Sitzt man nicht auf einem Schatz toller, aber schon erzählter Geschichten, die man im Stil des 21. Jahrhunderts wieder aufrollen kann?
Höre ich da das Wort „Plagiat“? Das streiten alle Rebooter selbstverständlich entrüstet ab. Sie verbeugen sich ostentativ vor den eigentlichen Schöpfern und verstehen ihre Nachbauten stets als „Hommage“. Auch John Scalzi beeilt sich, in einem Vorwort das Genie seiner ‚Vorgängers‘ H. Beam Piper zu loben, mit dem er sich selbstverständlich weder messen kann noch will. (Dieses Vorwort ist interessant: Obwohl es kaum eine Seite ‚lang‘ ist, eiert Scalzi in seiner Argumentation wild & vage umher, weil es ihm einfach nicht gelingt zu begründen, wieso es dieses Buch gibt.)
Originalität wird ohnehin überschätzt …
Geschrieben hat Scalzi es trotzdem. Nun kann (und muss) festgestellt werden, wie sich die alten von den runderneuerten Fuzzys unterscheiden. H. Beam Piper (1904-1964) schrieb „Little Fuzzy“ (dt. „Der kleine Fuzzy“) 1962. Vor seinem frühen Tod verfasste er noch zwei Fortsetzungen, erlebte aber den Erfolg seines Spätwerks nicht mehr. Pipers Roman beschäftigte sich ebenso unterhaltsam wie ernsthaft mit Themen wie Diskriminierung, Umweltzerstörung und Kapitalgier, die in dieser Intensität erst in den 1970er Jahren ihren Weg in die breite Öffentlichkeit fanden. Nachträglich ließe sich „Der kleine Fuzzy“ als ‚grüner‘ SF-Roman bezeichnen, wobei positiv hervorzuheben ist, dass Piper auf den berüchtigten erhobenen Zeigefinger verzichtete.
Seine Geschichte erzählte er auf weniger als 200 Seiten: konzentriert auf das Wichtige, frei von Abschweifungen. Scalzi bläst seine Version (mit freundlicher Unterstützung des Setzers) auf die doppelte Länge auf. Er hat nicht mehr zu erzählen aber offensichtlich mehr zu sagen. Damit ist er ein sehr aktueller Autor, denn (nicht nur) SF muss heute seitenstark sein; der Leser wünscht handfeste Quantität, wenn er seinen Obolus für ein Buch entrichtet. Die Frage nach dem Sinn eines Fuzzy-Reboots wird sich zumindest die Mehrheit der jüngeren Leser sowieso nicht stellen. 1962 liegt für sie gefühlt etwa so lange zurück wie der Bau der Pyramiden. Anders ausgedrückt: Das Original kennen sie nicht und würden es wohl auch als Neuauflage meiden.
Glattes, schwungvolles Abenteuer
Nachdem dieser Aspekt geklärt ist, widmen wir uns objektiv Scalzis Geschichte als solcher, d. h. unter Ignorierung der Vorlage. In dieser Hinsicht dürften Puristen melancholisch werden: Er macht seinen Job nämlich ausgezeichnet! Scalzi ist ein schneller und sehr versierter Erzähler. „Der wilde Planet“ stellt keine Ausnahme dar. Zumindest die ersten beiden Drittel sind ein schnelles, simples, spannendes Planeten-Abenteuer, das nie durch Originalität aber durch einen stets flüssigen Stil auf- und gefällt.
Es wird sogar (aus Sicht der angenommenen Puristen) noch schlimmer: Die Figurenzeichnung ist Scalzi deutlich besser als Piper gelungen. Im 21. Jahrhundert dürfen und müssen auch Helden Schwächen haben. Also ist Holloway ein Zyniker und höchst unbotmäßiger Angestellter, der aus Prinzip gegen Vorschriften verstößt und dem die Fäuste durchgehen, wenn er sich aufregt. Dabei zieht er nicht selten den Kürzeren und bekommt kräftig aufs Maul, was ihn noch sympathischer wirken lässt.
Zumal Holloway gegen die Richtigen rebelliert: Die Zarathustra Corporation und ihre Schergen stellt Scalzi als Märchenbuch-Schurken dar. Jedes Klischee über Konzerne, Anwälte, Sicherheitsleute u. a. glattes, gleichgültiges, gieriges Pack wird freudig aufgegriffen und durchgespielt. Das normalerweise herz- und gesichtslose Kapital erhält ein böses Gesicht, in das kräftig geschlagen wird. Ebenfalls anders als in der Realität endet diese Geschichte mit einem Sieg der Gerechtigkeit, was (vermutlich besonders das US-amerikanische) Leserherz deutlich höher schlagen lässt.
Ruhe vor Gericht!
Weniger gut als Idee aber weiterhin schwungvoll in der Ausführung ist das letzte Drittel: Das Geschehen spielt sich weiterhin auf einem Dschungel-Planeten voller seltsamer Kreaturen ab, aber nun geht es – in einen Gerichtssaal! „Der wilde Planet“ wird zum „court drama“, und Scalzi bedient abermals alle entsprechenden Klischees. Also wird das Recht nach Herzenslust verdreht, kommen faule Tricks zum Einsatz, erhebt ständig irgendein Anwalt Einspruch. Als Justizias Waagschale sich bedenklich nach unten neigt und unsere Helden plus Fuzzys verloren scheinen, zieht Holloway – siehe da, er ist bzw. war selbst Anwalt – einen (vom Verfasser zwar fair angedeuteten aber geschickt vertuschten) Trumpf aus dem Ärmel und reißt das Steuer hochdramatisch herum!
Wer Gerichtsdramen nicht schätzt, wird sich langweilen. Andererseits vermeidet Scalzi ein noch schlimmeres Klischee: den in der Science-Fiction gern geführten, mit Brutalität & billigen Action-Effekten gespickten ‚Freiheitskrieg‘ (mit „Viva la Revolución!“ skandierenden Fuzzys?). Wenn „Papa Fuzzy“ plötzlich das Wort ergreift, wirkt dies naiv, aber es funktioniert, zumal Scalzi die Fäden fest in der Hand behält und allzu gefühlsduselige Momente ausklammert bzw. beherrscht.
Niedlich und schlauer als gedacht
Auf den ersten Blick mag es erstaunen, dass die Fuzzys, die diesem Buch doch (im Original) ihren Namen gaben, in ihrer eigenen Geschichte bloß eine Nebenrolle spielen. Tatsächlich geht es um Menschen. „Der wilde Planet“ thematisiert ein uraltes Dilemma: die Entscheidung zwischen „richtig“ und „falsch“. Scalzi schürft dabei nie tief, was seinen Roman zur idealen Basis eines Drehbuchs macht. Es ist schon auffällig, wie gut es ihm gelingt, das Kopf-Kino des Lesers in Gang zu setzen!
Irritationen gibt es dabei nicht. Scalzi erzählt flüssig aber auch aalglatt. Holloways Hinterlist ist Mittel zum Zweck in einem Kampf für wahre Werte und außerdem primär Behauptung; zwielichtig wirkt er nur, wenn man das flache Gutmenschentum seiner Mitstreiter als Maßstab nimmt. Die einzige Überraschung bleibt, dass Holloway trotz seines Kreuzzuges für die Fuzzys das Herz der schönen Isabel eben nicht zurückgewinnt, sondern stattdessen gut Freund mit dem Nebenbuhler wird.
Die Fuzzys bleiben blass. Meist sind sie niedlich und benehmen sich auch so. Wie kann man solche herzigen Wesen nicht mögen und verfolgen? Schließlich haben sie keinerlei Ecken und Kanten. Selbst die Miniatur-Speere, mit denen Piper sie 1962 bewaffnete, sind verschwunden. Plüschig wartet Papa Fuzzy auf seinen großen Auftritt im Finale. Großherzig verzichtet er auf eine Bestrafung derer, die seinen Planeten ausbeuteten und sein Volk dezimierten. Ihm genügen die roten Köpfe und schuldbewussten Mienen seiner Zuhörer. Selbst die Ewoks waren glaubwürdiger in ihrem Verhalten – und das will etwas heißen!
Letztlich ist es nicht Scalzi vorzuwerfen, dass „Der wilde Planet“ ’nur‘ eine spannende Abenteuergeschichte wurde. Wo Piper zu früh kam, ist Scalzi zu spät: ‚Grünes‘ Denken ist heute dort, wo die Bilanzen nicht im Vordergrund stehen, durchaus verbreitet. Scalzi geht nicht so weit, ein Feld zu beackern, auf dem längst geerntet wird. Er möchte unterhalten. Auf diesem Level funktioniert „Der wilde Planet“ ausgezeichnet.
Autor
John Scalzi (geb. 1969) begann schon auf dem College zu schreiben. In den 1980er Jahren arbeitete als Filmkritiker für eine kalifornische Zeitung. Außerdem verfasste er in den folgenden beiden Jahrzehnten, wofür man ihn bezahlte; u. a. schrieb er jene kurzen Zusammenfassungen, die auf Buchdeckel- oder Einbandrückseiten zu lesen sind und ab 2000 CD- und DVD-Kritiken für das „Official US Playstation Magazine“. Für „America Online“ führt er einen Blog.
Mit „Old Man’s War“ (dt. „Krieg der Klone“), dem Vorgängerband zu „The Ghost Brigades“, versuchte sich Scalzi 2005 höchst erfolgreich als Romanautor. Sein Debüt wurde für den „Hugo Award“ als bester Science-Fiction-Roman des Jahres, für den „Locus Award“ als besten Romanerstling sowie für den „John W. Campbell Award“ als bester Jungautor nominiert; diesen Preis hat er 2006 gewonnen.
Mit seiner Familie lebt John Scalzi in der Kleinstadt Bradford, Ohio. Über seine zahlreichen Aktivitäten informiert er auf seiner Website.
Taschenbuch: 382 Seiten
Originaltitel: Fuzzy Nation (New York : Tor 2011)
Übersetzung: Bernhard Kempen
http://www.randomhouse.de/heyne
eBook: 682 KB
ISBN-13: 978-3-641-06976-6
http://www.randomhouse.de/heyne
Der Autor vergibt: 




