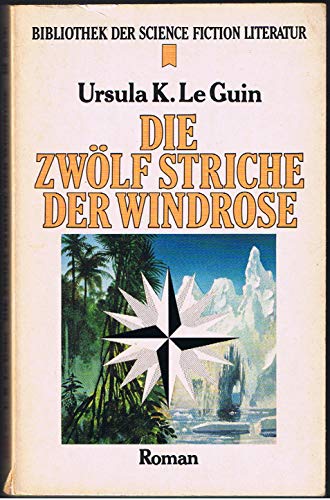
Die Sammlung „Die zwölf Striche der Windrose“ (Band 25 der Heyne Science-Fiction-Bibliothek) stellt den außerordentlichen literarischen Rang der Autorin unter Beweis. Eine ganze Reihe dieser Erzählungen aus der Zeit zwischen 1962 und 1972 wurden mit Preisen ausgezeichnet, darunter „Der Tag vor der Revolution“, für die die Autorin den Nebula Award erhielt. Die Autorin begann also vor rund sechzig Jahren zu veröffentlichen.
Die Autorin
In Kalifornien als Tochter eines Kulturanthropologen geboren, studierte Ursula K. Le Guin am Radcliffe College und an der Columbia University, lebt aber seit 1962 als freie Schriftstellerin in Portland, Oregon, wo sie an der Uni lehrt. 1962 erschien ihre erste Story („April in Paris“) und 1966 ihr erster Roman, „Rocannons Welt“. Die ersten Romane zeigen bereits Le Guins Verfahren, eine Geschichte über einer (mythologischen) Grundstruktur um bestimmte Metaphern herum anzulegen.
Viele ihrer Geschichten und Romane spielen in einem fiktiven Universum, dem der Ekumen (dt. „Ökumene“). Botschafter und Agenten tauchen auf, die neue Welten für die Planetenliga der Ekumen gewinnen sollen, so etwa in ihrem berühmten Roman „Die linke Hand der Dunkelheit“. In der Fantasy ragt ihr „Erdsee“-Zyklus über die Masse der Produktion turmhoch hinaus. Erst 2002 erhielt sie für ihren neuesten „Erdsee“-Roman den World Fantasy Award.
Wiederholt wurde Le Guin mit den wichtigsten Preisen der Science-Fiction, der Fantasy, aber auch des Mainstream ausgezeichnet. „Sie gehört zu den führenden und formenden Kräften der Science-Fiction in den 70er Jahren, und sie fand [als eine der wenigen AutorInnen] auch außerhalb der Science-Fiction breite Anerkennung.“ (Reclams Science-Fiction Lexikon, 1982) So erhielt sie beispielsweise den National Book Award der USA.
Auf Deutsch sind erschienen:
– Erdsee 1-4 (Sammelband, Heyne) und drei weitere „Erdsee“-Bücher
– Hainish (3 SF-Romane: Rocannons Welt, Stadt der Illusionen, Das zehnte Jahr)
– Winterplanet / Die linke Hand der Dunkelheit (Heyne)
– Das Wort für Welt ist Wald (Argument)
– Planet der Habenichtse / Die Enteigneten (Heyne, Ed. Phantasia)
– Malafrena (Heyne)
– Die zwölf Striche der Windrose (Heyne)
– Die Kompassrose (Heyne)
– Geschichten aus Orsinien (Heyne)
– Die wilde Gabe (bei Festa)
– Ein Fischer des Binnenmeeres (Ed. Phantasia)
– Die Geißel des Himmels (Ed. Phantasia)
– Das Wunschtal (Heyne)
– Die Regenfrau (Heyne)
– Die Erzähler (Heyne, Ed. Phantasia)
Diese Bücher machen lediglich etwa 50 bis 60 Prozent des Gesamtwerks aus!
Die ERZÄHLUNGEN
Semleys Geschmeide (1963)
Auf einer Welt, die der Liga-Forscher Rocannon in dem Roman „Rocannons Welt“ erforschen wird, gibt es eine Legende – von einer jungen Frau, die das kostbarste Geschmeide ihrer Sippe für ihren geliebten Gatten wiedererlangen wollte, doch trotz ihres Erfolgs unglücklich wurde.
Semley ist die Gattin Durhals von Hallan, eines Prinzen, und Mutter der kleinen Haldre, die von ihr das goldblonde Haar geerbt hat. Doch ein Kummer nagt an der ansonsten glücklichen Frau, und sie offenbart sich Durossa, der zweiten Frau des Burgherrn Hallan, Semleys Schwiegervater. Sie hat ihrem geliebten Gatten nichts in die Ehe eingebracht. Dabei hat die Sippe Leynen, der sie angehört, einst das schönste Schmuckstück besessen, den großen Saphir „Auge des Meeres“, der an einer Goldkette prangte. Wo mag es sein? Sie will es wiedererlangen.
Doch weder die Leynens noch die feenhaften Fiia wissen, wo das Geschmeide ist. Nur die Gdemiar, die als Schmiede unter der Erde leben, könnten dies wissen, meint ein Angehöriger der Fiia. Und in der Tat gelangt Semley in den dunklen, furchteinflößenden Labyrinthen der Zwerge an das Wissen, dass sie das Auge des Meeres einst besaßen, doch es an die Gebieter von den Sternen (= Menschen wie Rocannon)weggaben, um etwas einzuhandeln.
Deshalb macht sich Semley mutig auf den Weg an den Ort, wo sie tatsächlich das Geschmeide aus der Hand Rocannons empfängt. Doch als sie zurück, erweist sich die Niedertracht der Gdemiar: Als sie sagten, die Reise dauere nur eine Nacht, sprachen sie nicht von den Nächten, an die Semley gewohnt ist, sondern von kosmischer Nacht. Als Semley erfolgreich ihre Burg wieder erreicht, sind nicht weniger als lokale Jahre vergangen und vieles hat sich verändert. Durhal fiel in der Schlacht, und vor Kummer wirft Semley ihrer nunmehr erwachsenen Tochter das verhexte Geschmeide vor die Füße und läuft verzweifelt in die Wälder …
Mein Eindruck
Dies ist der Prolog zu dem späteren Debütroman „Rocannos Welt“ (siehe dazu meinen Bericht). Was zunächst wie eine sehr romantische Fantasygeschichte anmutet, entpuppt sich zunehmend als SF-Story. Insbesondere der Perspektivwechsel von Semley zu Rocannon trägt dazu bei, dem Leser dies deutlich zu machen. Wenn am Schluss Semley heimkehrt, offenbar sich aber ein reiner SF-Effekt: die Zeitdilatation, die schon Einstein postulierte: Während auf ihrer Heimatwelt Jahrzehnte vergehen, erlebt Semley nur eine kurze Zeitspanne. Subjektive und objektive Zeit sind also keineswegs deckungsgleich. Die Folgen dieser Diskrepanz sind tragisch. Und der Wert des Geschmeides erweist sich als ebenso relativ: Vom höchsten Juwel der Sippe ist es zu wertlosem Plunder verkommen, einfach sein Empfänger verstorben ist.
April in Paris (1962)
Prof. Barry Pennywither aus Indiana weilt am 2.4.1961 zu Studienzwecken in Paris, genauer gesagt, auf der Ile St. Louis, unweit von der Kathedrale Notre Dame. Er ist einsam und unglücklich. Plötzlich erfasst ihn eine Gewalt, die ihn durch die Zeit schleudert. Dr. Jehan Lenoir aus dem Jahr 1486 ist ebenfalls einsam und unglücklich, wohnt im gleichen Zimmer wie Pennywither und hat ihn mit einem Zauberspruch herbeigerufen.
Da der Professor Experte für das französische Spätmittelalter ist, findet er sich mit Lenoirs Akzent sofort zurecht. Nachdem sie sich gegenseitig versichert haben, dass sie nicht aus der Hölle kommen, tauschen sie ihre Kentnisse aus. Pennywither kehrt kurz in seine eigene Zeit zurück, doch kommt er mit einer goldenen Taschenuhr und vielen Büchern zurück: Endlich hat er einen guten Freund gefunden. Sie verbringen viele Stunden miteinander und nachdem sie die Uhr für ein Jahresgehalt verkauft haben, kosten sie zudem die Schönheiten des Lebens aus.
Doch Pennywither sehnt sich nach weiblicher Gesellschaft, und so tut ihm Lenoir den Gefallen, eine Frau herbeizurufen: Es ist die gallische Sklavin Bota, die im Lutetia der spätrömischen Zeit nichts zu lachen hatte. Doch in Pennywithers liebevollen Armen blüht sie auf, auch wenn ihr Latein einiges zu wünschen übriglässt. Nun fühlt sich nur noch Lenoir einsam und vernachlässigt. Ein kleiner Hund ist zwar ein Anfang, aber eine Frau wäre ihm lieber, und so ruft er eine herbei.
Wie sich herausstellt, handelt es sich um eine Archäologin, die von der Erdkolonie Altair stammt, in einer fernen zukünftigen Zeit. Auch sie war einsam und fühlte sich unter Ihresgleichen fremd. Doch hier bei Pennywither und Lenoir kommt sie sich heimisch vor. Das Quartett plus Hund beginnt ein gemeinsames Leben. Schließlich ist es April in der Stadt der Liebe, und die Kastanien blühen …
Mein Eindruck
Dies ist natürlich eine sehr romantische, etwas naive Geschichte. Aber sie hat bereits wichtige Grundmerkmale vieler Geschichten Le Guins. Die beiden Doctores dürsten nach Wissen und ergründen die Welt, deshalb haben sie keinerlei Problem damit, sich mit Angehörigen anderer Völker anzufreunden und ebenfalls auszutauschen: den Frauen Bota und Kislk. Auch Kislk dürstet nach Freundschaft und Wissen, Bota sucht Freiheit, Zuneigung und Liebe. Sie bilden das, was man heute auf Facebook und Instagram eine kleine Community nennen würde. Es ist wirklich eine sehr schöne Geschichte.
Die Meister
Vierzehn Generationen nach dem „Höllfenfeuer“ (= Atomkrieg) hat sich die Stadt Edun wieder so weit berappelt, dass sie eine Art mittelalterliche Gesellschaft besitzt, die sogar über Industrie in Gestalt einer Dampfmaschine verfügt. Doch die göttliche Sonne verhüllt stets ihr Antlitz hinter einer dichten Wolkendecke, und um Gott nicht zu erzürnen, ist jegliche Ketzerei verboten und wird mit dem Tod auf dem Scheiterhaufen bestraft.
Der junge Mann Ganil wird in einer feierlichen Zeremonie in den Orden der Meister aufgenommen. Es gibt nur eine Stimme, die ihm einflüstert, nicht zu schwören, und diese gehört Mede Fairman, der sich mit Ganil anfreundet. Wie sich herausstellt, hegt Mede in der Tat ketzerische Gedanken, so etwa über die Idee der „schwarzen Zahlen“, mit denen man viel besser und leichter rechnen kann als mit den abgesegneten lateinischen Zahlen. Allein der Begriff einer Zahl für das Nichts liegt schon jenseits des Erlaubten. Doch da fängt Mede mit seiner neuen Algebra erst an, und Ganil entwickelt sie weiter. Zusammen mit dem alten Yin, dem die rechte Hand amputiert wurde, entwickeln sie die Physik der Bewegungen – auch für die göttliche Sonne.
Und so kommt es, wie es kommen muss. Als Sympathisant des Ketzers Mede, der „die Entfernung zwischen der Erde und Gott messen wollte“, lassen die Meister auch Ganil verhaften und befragen ihn durch Folter. Nun droht auch er seine Hand zu verlieren. Wie wird er sich entscheiden?
Mein Eindruck
Dies ist die Story über eine Revolution, die aus dem Wissen geboren ist, nicht aus dem Glauben. Die Physiker um Mede, Ganil und Yin schauen weiter als über den Umkreis des Erlaubten, was sie zu Ketzern macht. Interessant ist, dass ihre Widersacher sowohl Priester als auch die Meister, die Hüter des erlaubten Wissens, sind. Hier hat sich also die Wissenschaft in den Dienst des Glaubens gestellt.
Die Ganil-Revolution kommt somit einer Rebellion vom Format eines Galileo Galilei gleich, der auf der Kopernikanischen Wende (Sonne als Zentrum des Universums) aufbaute. Natürlich spielt auch die Option einer Ehe eine gewisse Rolle, aber für Ganil Wissen und dessen Freiheit offenbar wichtiger als Ehe und Kinder.
Ein Kasten voll Dunkelheit
In einer Welt ohne Sonne kann es ekeinen Schatten geben, und so läuft Dicky, der Sohn der Hexe, schattenlos über den Strand. Er will seiner Mutter bringen, was er gefunden hat: einen Kasten voll Dunkelheit. Sie sagt ihm, er soll darauf achtgeben, kocht, isst mit ihm und legt sich wieder aufs Ohr. Doch da läuft ihr Sohn wieder mit seiner Katze über die Dünen und trifft dort Prinz Rikard, den Sohn des Königs. Er schenkt ihm den Kasten. Doch alles, was im Reich gefunden wird, gehört dem König, und so reitet Prinz ins Schloss …
Jeden Vormittag schlägt der Prinz eine Schlacht gegen seinen Bruder, der mit drei Schiffen am Strand landet, um sein Erbe zu beanspruchen. Jeden Vormittag kehrt der Prinz siegreich zu seinem Vater zurück. Jeden Vormittag ist es zehn Minuten vor zehn Uhr, als er er das Schloss erreicht.
Der König, der auf einem Thron zwischen Chimären sitzt, erkennt den Kasten warnt – er warf ihn einst selbst ins Meer, doch dieses verweigert die Annahme. Der König gibt den Kasten Rikard zurück, warnt ihn aber davor, ihn zu öffnen. Doch in seinem sonnenlosen, kerzenhellen Zimmer ohne Schatten sackt der Prinz müde in seinen Sessel. Des Kampfes überdrüssig leert er den Kasten über sich aus: Dunkelheit und Schatten breiten sich aus. Als er einen Greif erschlägt, bleibt das Tier tot. Die Uhr schlägt dröhnend zehn.
Als Rikard diesmal in die Schlacht reitet, weiß er, dass nur einer von beiden Brüdern zurückkehren wird – endlich …
Mein Eindruck
Diese märchenhafte Welt ist zunächst anders als unsere: sonnen- und todlos, unsterblich, aber in einer Endlosschleife der Wiederholungen gefangen. Doch die Dunkelheit ändert alles, und als der Tod endlich herrscht, scheint auch die Sonne. Man weiß nicht, welches die Bedingung für das andere ist, doch eins ist klar: Dies ist unsere Welt der Sterblichkeit, und wir sehen, dass es wahrscheinlich besser ist als die Alternative. Nur eine Sache wird nicht geklärt: Wer erschuf die Dunkelheit?
Das lösende Wort (Erdsee 1)
Diese Geschichte spielt irgendwie im Erdsee-Archipel. Der Zauberer Festin, der die Bäume liebt und hütet, ist von einer unbekannten Macht niedergeschlagen und in einen von Trollen bewachten Kerker gesperrt worden. Doch wie sich befreien? Ohne seinen Zauberstab ist Festin nur halb so stark. Die üblichen Zaubersprüche wirken nicht, denn den Kerker bewachen Bannsprüche. Selbst die schwierigsten Verwandlungszauber vermögen ihn nicht zu befreien: als Fledermaus, Luftstrom, Falke, Ring – nichts hilft. Er wird im Gegenteil mit jedem Versuch schwächer.
Schließlich merkt er, was er sein Gegner, bei dem es sich gewiss um Voll den Fell handelt, nicht bedacht hat: Alle anderen Zauberer versuchen, am Leben zu bleiben. Was, er dies nicht täte? Er spricht das lösende Wort, das nur einmal gesprochen werden kann, und seine sterbliche Hülle stirbt. Als Geist wandelt er ins Land jenseits der Mauer, ins Land der Toten. Dort ruft er Voll, der diesem Ruf gehorchen muss. Festins Geist verfolgt Voll, bis dieser nicht mehr kann und um Gnade fleht. Festin bannt ihn in das Skelett eines alten Mannes, das sofort zerfällt. An dieser Stelle wacht Festin fortan über den Zugang zum Land der Lebenden, bis die Berge zerfallen.
Mein Eindruck
Diese frühe Erdsee-Geschichte kennt noch einen anderen Zauberer als Ged als Hauptfigur, aber schon hier wird das Thema aus dem dritten Erdsee-Roman mit Ged, „Das ferne Ufer“, angeschnitten. Darin muss Ged ins Land der Toten wandern, um den Störenfried zu finden, der Erdsee bedroht.
Der besondere Reiz an der vorliegenden Urform liegt in den zahlreichen Methoden, sich zu befreien und zu verwandeln. Außerdem ist Festin als Freund der Bäume und Pflanzen charakterisiert, quasi ein Baumhüter, wenn auch kein Ent. Diese Figur findet sich zum Revolutionär gewandelt in Le Guins Roman „Das Wort für Welt ist Wald“.
Die Namensregel (Erdsee 2)
In Erdsee gibt es die Weißen Magier, die nicht so netten Zauberer – und es gibt die Hexenmeister, die jeder auf den vielen Inseln zum täglichen leben braucht, so wie man einen Schreiner braucht. So ein Hexenmeister ist auf Sattins Island der krummbeinige dicke Mr. Underhill. Er ist besser als gar keiner, aber nicht viel von einem Zauberer.
In der Schule fragt die Lehrerin Palani ihre Fünfjährigen, warum Mr. Underhill diesen Namen trägt, wo doch jeder weiß, dass niemand einfach so seinen Namen verrät. Ganz richtig sagen die Kinder, dass dies nicht sein Wahrname sein könne, denn wer den wahren Namen eines Dinges wissen, der beherrsche es auch. Also gebe es den Rufnamen, den ein Mensch annehme, ganz bestimmt aber ein Hexenmeister. Mr. Underhill nickt beifällig, denn genauso ist es. Underhill heißt er, weil er in einer Höhle unter einem Hügel wohnt. Und ein Bann verschließt den Zugang gegen allzu neugierige Zeitgenossen auf der Insel.
Eines Tages trifft ein junger schwarzbärtiger Mann allein mit einem Boot ein. Das kann nur ein Zauberer sein, und einen großen Stab trägt er auch. Gespannt warten die Dorfbewohner, was passiert, denn der alte Käptn Fegano sagt, dass zwei Zauberer auf einer Insel schlecht sei: zu viel Konkurrenz. Tatsächlich dauert es nur eine Woche, bis Blackbeard sich eingehend nach Mr Underhill erkundigt. Zusammen mit dem dümmlichen Fischer Birt macht er sich zu Underhills Höhle auf. Weil er nämlich den wahren Namen von Mr Underhill kenne, werde er ihn zwingen, den Schatz, den er ihm, dem Seelord von Pendor, gestohlen, wieder herauszurücken.
Tatsächlich entbrennt ein Wettstreit der Verwandlungen, bis der Seelord es schließlich wagt, den wahren Namen Underhills auszusprechen: „Yevaud!“ Doch die Wirkung ist keineswegs die erwartete, und bald ändert sich das Leben auf der Insel auf verhängnisvolle Weise. Nur der Fischer Birt entkommt, denn er hat die Lehrerin in sein Boot gepackt und ist sofort wie wild in Sicherheit davon gerudert …
Mein Eindruck
Die abenteuerliche Geschichte, die zunächst so harmlos beginnt, dient lediglich dazu, einen grundlegenden Aspekt der Erdsee-Magie zu illustrieren: dass das Wissen über den wahren Namen eines Dinges Herrschaft über dieses Ding verleiht. Diese Idee ist keineswegs neu, sondern war in Kriegergesellschaften wie den nordamerikanischen Prärierindianern und schon bei den alten Kelten weit verbreitet. Es gab sogar vielfach Rufnamen, die wie Ehrentitel vom Vater auf den Sohn vererbt wurden, so etwa auch „Crazy Horse“.
Die Autorin verleiht der Enthüllung des Wahren Namens von Mr. Underhill (den Tarnnamen Frodos in Band 1 des „Herrn der Ringe“) eine ironische Wendung, allerding nicht zum Guten, sondern zum Schlechten: denn Yevaud ist wirklich ein räuberischer Drache. Und er hat seit langer Zeit keine ordentliche Drachen-Mahlzeit mehr gehabt …
Der König von Winter
Der Winterplanet Gethen ist in zwei Reiche aufgeteilt, in Karhide und Orgoreyn. Die Bewohner sind androgyn und entscheiden erst in der Zeit der Kemmer, welchem Geschlecht sie angehören wollen. (Deshalb kann ein männlicher Titel ein weibliches Pronomen besitzen!) Die Abgesandten der Ökumene der Welten (Ekumen) beobachten die politischen Verhältnisse auf der kalten Welt, die sich laufend verändern, mit angespannter Sorge.
In Karhide ist die brutale Herrschaft des Königs Erman mit seinem Tod zu Ende gegangen, und König Argaven XVII ist ihr Nachfolger. Doch eines Nachts stellt eine Wache in Erhenrang, der Hauptstadt, den jungen König Argaven, der angeblich in den Bergen weilt, auf der Straße und identifiziert sie anhand einer Münze. Sofort wird Argaven ins Schloss gebracht und von Arzt Hoge und Lordkanzler Gerer betreut. Beide sind bestürzt über die Einstiche in Argavens Ellenbeugen: Gehirnwäsche! Es wundert sie nicht, als Argaven lauthals verlangt abzudanken.
Steckt Orgoreyn dahinter? Der Ekumen-Gesandte Axt eilt von Orgoreyn nach Erhenrang in Karhide, um einen möglichen Krieg zu verhindern. Doch der Täter bleiben weiterhin unbekannt, und so gibt es keine Vergeltungsaktionen. Vielmehr muss sich Axt Sorgen um die liebe Argaven machen. Der König hat Angst, psychologisch so programmiert worden zu sein, dass er sein eigenes Reich vernichtet wird. Er hat zwei Alternativen: Selbstmord oder Flucht. Weil Argaven bereits einen einjährigen Erben hat, lässt sich Axt zu letzterem überreden: Argaven reist nahezu lichtschnell zur Zentralwelt Ollul, um sich dort den Hirnklempnern anzuvertrauen. Bei dieser Reise vergehen auf Gethen 25 Jahre, für Argaven aber nur 15 Stunden.
Nach ihrer „Reparatur“ lernt Argaven zehn Jahre lang auf Ollul, wo alle ihre Kommilitonen krampfhaft bemüht sind, die zweigeschlechtliche Studentin nicht als pervers anzusehen. Beim Abschluss der Uni bittet der oberste Sektorchef der Ekumen Argaven, nach Gethen zurückzukehren, denn dort werde sie gebraucht. Auf dieser nahezu lichtschnellen Reise vergehen für Gethen weitere 25 Jahre, für die Passagierin aber nur wenige Stunden.
Als sie auf dem Ekumen-Stützpunkt ankommt, hat sich binnen rund 50 Jahren viel auf Gethen verändert. Ihr Sohn Emran hat Karhide zugrunde gerichtet und die Westprovinz mitsamt der alten Hauptstadt Erhenrang an Orgoreyn verloren. Doch es gibt Rebellen, allen voran die Anhänger der ehemaligen Königin, die mittlerweile sehr betagt sind, aber mit Tränen in den Augen ihre junge Gestalt willkommen heißen. Der Widerstandskampf der Königsmutter Argaven gegen ihren eigenen Sohn beginnt – und der Kreis schließt sich …
Mein Eindruck
Eine absolut geniale Erzählung! Die Autorin benutzt wieder einmal die Effekte der Zeitdilatation wie schon in „Semleys Geschmeide“. Dadurch wird die Geschichte eindeutig als SF erkennbar. Soweit so gut. Doch nun kommt noch ein Faktor hinzu: die Fähigkeit der Vorhersage.
Diese spezifische Fähigkeit der Gethenianer erweist sich zur Verblüffung des Lesers als von vornherein, bereits in der ersten Szene, wirksam: Der „alte König Emarn“ ist nämlich kein anderer als Argavens eigener Sohn, den sie als Säugling verließ! Dadurch schließt sich der Kreis der Geschehnisse. Und wer sich bislang gefragt hat, was die erste Szene sollte, erkennt nun, dass es sich um einen Vorausverweis auf den Schluss der Geschichte – und somit der geschilderten Ereignisse – handelt.
Diese Novelle vermittelt einen kleinen Vorgeschmack auf die Wunder, die der Roman „Winterplanet / Die linke Hand der Dunkelheit“ für den Leser und die Leserin bereithält. Und die Sache mit den weiblichen Pronomen für männliche Titelträger wie „König“ oder „Lordkanzler“ erklärt die Autorin in ihrer Vorbemerkung, so dass sie nicht schwer zu kapieren ist.
Der gute Trip
Lewis Sidney David hat kürzlich seine geliebte Frau Isobel verloren. Nun sucht er einen Ausweg oder Vergessen oder Ablenkung, indem er eine Pille LSD/a nimmt. Oder er bildet sich dies nur ein. So ganz eindeutig ist dies nicht. Auf jeden Fall aber sehnt er sich nach Befreiung, nach einer höheren Wahrheit und Klarheit. Deshalb beginnt er, die Hänge des Mount Hood zu besteigen. Dort oben ist es ziemlich kalt, denn der Berggipfel ist stets schneebedeckt. Auf halbem Weg begegnet ihm Isobel und nimmt ihn an der Hand, um ihn hinabzuführen. Er begegnet seinen Freunden, von denen er dachte, sie hätten ihn verlassen. Einem davon, Rick, steckt er seinen LSD-Vorrat in die Tasche und geht weiter. Jetzt ist Lewis froh, dass er das LSD doch nicht alles genommen hat. Aber der Trip zum Berg war gut.
Mein Eindruck
Die Geschichte bedeutet stilistisch und inhaltlich einen überraschenden und für meinen Geschmack enttäuschenden Ausflug in das modische Thema Drogen und psychedelische Zustände. Dem Leser stellt sich das Problem, dass die Erzählperperspektive dem subjektiven Erleben der Hauptfigur entspricht, die zugleich der Erzähler ist. Dadurch sind alle gezeigten Phänomene ungesichert, so etwa die Einnahme einer LSD-Pille, aber auch die Erscheinung eines Geistes: Isobel. Diese Erzählperspektive hat also Vor- und Nachteile. Sie verlangt einen erfahrenen Leser, der mit so etwas umgehen kann.
Neun Leben
Auf dem Planeten Libra bebt regelmäßig die von Vulkanen geprägte Erde. Daher sind die zwei intergalaktischen Bergbauingenieure Alvaro Martin und Owen Pugh froh, als sie endlich Verstärkung kriegen. Zu ihrer Überraschung sehen die zehn Neulinge aber alle genau gleich aus: gut genährt, schwarzhaarig, golden gebräunt, sechs Männer und vier Frauen – ein Klon aus zehn Einheiten. Sie sind andersartig, verständig sich beinahe telepathisch, so als wären sie schon seit ihrer Geburt zusammen – was auch tatsächlich der Fall ist.
Zunächst machen sich die zehn Klone gut und rackern in der Mine „Höllenmund“ für zwanzig, so dass sich Martin und Pugh um intelligentere Arbeiten kümmern können. Doch es kommt zur Katastrophe, als Mutter Libra mal wieder heftig die Hüften schwingt und Polka tanzt: Die Mine stürzt ein. In einem Luftschlitten überlebt von zwei Passagieren nur ein Mann schwerverletzt den Absturz.
Doch dieser Kaph will gar nicht weiterleben, wozu auch, „wenn der größte Teil von mir gestorben ist?“, fragt er. In schweren Anfällen durchlebt er den Tod jedes einzelnen Klon-Mitglieds selbst, bis nur noch er selbst übrigbleibt: erstmals im Leben allein. Nun gleicht er den beiden anderen, Pugh und Martin. Doch erst muss er seine Apathie überwinden.
Einen Tag vor der endgültigen Ablösung erkundet Martin eine gefährliche Erdspalte und wird prompt von einem weiteren Erdbeben überrascht. Felsen zerschmettern sein Vehikel, und sein Anzug sendet ein Signal, das nicht aufgefangen wird. Als Pugh losfliegt, ihn zu retten, und lange ausbleibt, beginnt Kaph, sich wirklich Sorgen zu machen. Das ist neu für ihn. Passt er sich wirklich diesen beiden Fremden an?
Mein Eindruck
Was wie eine der Standardsituationen aus der naturwissenschaftlich orientierten Abenteuer-Zukunftsliteratur à la Heinlein beginnt, entwickelt sich in Le Guins Händen allmählich zur Erkundung einer neuartigen psychologischen Konfrontation. Martin und Owen Pugh sind noch Männer der alten Generation, doch der Klon, eine Art Gestaltwesen, ist etwas völlig anderes – und die Zukunft. Diese Klonwesen, beschrieben nach Le Guins damaligem Wissensstand, agieren wie ein vielgliedriger Organismus. Pugh fragt sich, wie man den Sex zwischen zwei von diesen Wesen bezeichnen müsste: Inzest oder Masturbation?
Das psychologische Problem des plötzlich vereinsamten letzten Klonmitglieds wird in aller Schärfe geschildert, so dass wir wirklich Mitleid mit Kaph bekommen. Ein Mensch, der zeit seines Lebens stets in der Gesellschaft von seinesgleichen gelebt hat, ist plötzlich unter lauter Fremde geworfen, einsam und verletzlich. Doch die Geschichte endet auf einer hoffnungsvollen Note: Freundlichkeit hat noch eine Zukunft, und Kaph wird lernen, dadurch zu überleben, genau wie die alte Generation.
Ständig musste ich bei dieser Story an Theodore Sturgeons Roman „Baby ist drei / Die Ersten ihrer Art“ (O-Titel „More than Human“, 1954) denken. Auch Sturgeon beschreibt ein Gestaltwesen, dessen telepathische Mitglieder verschiedene Aufgaben übernehmen und daduch überleben können. Der Unterschied ist natürlich, dass die Mitglieder nicht geklont sind.
Dinge
Schon bald wird das Land vom Meer überschwemmt werden. Das Ende ist gewiss. Alle Küstenbewohner außer drei Menschen finden sich in dieses Schicksal. Die Weiner klagen und jammern, die Wüter sorgen dafür, dass alle Dinge zerstört werden und dem Meer nichts als Beute übrigbleibt. Folglich darf auch nichts Neues gebaut werden.
Einer der drei Menschen ist Lif, der Ziegelbrenner. Wozu soll er noch Ziegel brennen, wenn niemand mehr bauen darf? Doch Lif hatte einen Traum von den Inseln jenseits des Meeres, die Frage ist deshalb, wie er dorthin gelangt. Er kann nicht fliegen und nicht schwimmen noch tauchen. Sein Volk kennt keine Boote, die auf dem Wasser schwämmen; seine Behälter sind zu leicht oder zu schwer, Holz ist hier unbekannt. Also tut er das einzige, was ihm übrigbleibt: Er baut einen Dammweg.
Die zwei anderen Zurückgeblieben, die weder Weinern noch Wütern ins Gebirge gefolgt sind, sind eine Witwe und ihr Kleinkind. Sie hilft Lif, gibt ihm zu essen, denn er ist der einzige, der ihrem Kind eine Perspektive bietet. Misstrauisch beäugt von den Sprechern der Wüter baut Lif seinen Dammweg unter der Wasseroberfläche: Es sieht aus, als würde er alle seine überflüssigen Steine wegwerfen.
Dann kommt der letzte Tag, als es weder Steine mehr noch Essen gibt. Sie müssen aufbrechen. Alle anderen sind schon fort. Sie gehen nicht in die Berge und nicht die Küste entlang, sondern auf Lifs Dammweg hinaus. Am Ende des Weges wartet der Abgrund und der letzte Schritt. Just in diesem Moment erblicken sie das weiße Segel …
Mein Eindruck
Dies ist eine Sisyphus-Geschichte über Hoffnung angesichts des sicheren Endes. Das Milieu vom Meeresstrand kennt die Autorin aus dem Bundesstaat Washington von der wilden Pazifikküste des Nordwestens. Deshalb wirkt es besonders realistisch geschildert, obwohl wir so gut wie nichts über die Gesellschaft an der Küste erfahren, geschweige denn darüber, warum das Ende nahe sein soll. Dadurch liest die Geschichte wie ein Gleichnis oder eine Parabel. Aber es ist eine Vision von der Bedeutung des stillen Widerstandes (Lif) und der Hoffnung ohne Aussicht auf Erfüllung. Dass diese Hoffnung dennoch erfüllt wird, ist ein Geschenk – das von Gott, dem Schicksal oder was auch immer. Insofern lässt sich die Geschichte als Prolog zu der Story „Der Tag vor der Revolution“ am Ende dieses Bandes lesen.
Reise in die Erinnerung
Zwei menschliche Wesen erscheinen auf einer Waldlichtung. Ist dies die Erde, fragt der eine. Vermutlich, antwortet der andere. Dann vergisst der Erste seinen Namen und wird ein Nichts. Plötzlich kann er die Dinge nicht mehr beim Namen nennen. Da er dies nicht aushält, nennt er sich Ralph. Unvermittelt fühlt er sich in die Südstaaten versetzt und macht einer Frau namens Amanda, die in strahlendes Weiß gewandet ist, einen romantischen Liebesantrag, den sie gerne annimmt. Sie küssen sich. Das reicht ihm nicht und er dreht die Uhr 20 oder 30 Jahre vor: Sie treiben es unter einem Baum, wild. Er hört auf, Ralph zu sein und wird wieder Nichts.
Vielleicht ist er ja Jean-Paul Sarte, schlägt der andere vor. Das wäre schrecklich, findet Nichts. Dann vergessen sie alles wieder. Und Nichts läuft in den Wald, wo namenlose Tiger brennen.
Mein Eindruck
Die Autorin wendet hier den Existenzialismus Jean-Paul Sartres auf zwei Menschen ohne Erinnerung an. Sie dürfen keine Erinnerung haben, weil sie in die Welt geworfen wurden: Das ist eine Grundvoraussetzung der Existenzphilosophie Sartres. Die Geworfenen sind frei, alles zu tun und alles zu werden. Leider können sie sich an nichts erinnern, was das Unterfangen schwierig bis lächerlich macht. Sogar Sex à la Sartre (er hatte ja die Beauvoir) ist auf die Dauer nicht befriedigend, wenn man Nichts ist. Die Tiger, die im Wald brennen, hat William Blake erfunden, auch ein großer Philosoph und Schriftsteller. Sie ebreiten dem Spuk wohl ein Ende.
Unermesslich wie ein Weltreich – langsamer gewachsen (1971)
Das Forschungsschiff Gum wird von der Liga der Welten ausgesandt, um in einem kosmischen Gebiet, das von den Hainish noch nicht besiedelt wurde, nach einer bestimmten grünen Welt zu suchen, Nr. 4470. Die zehn Besatzungsmitglieder sollen herausfinden, ob die Welt für die Ausbeutung oder Besiedlung geeignet ist. Um sie geeignet für diese zeitlich sehr umfangreiche Exkursion zu machen, weisen sie alle – Terraner wie Hainish, Cetianer wie Beldener – besondere Charaktermerkmale auf, die man unter anderen Umständen als „neurotisch“ bezeichnen würde, die ihnen aber helfen, die Einsamkeit zu überwinden, insbesondere nach der Heimkehr, wenn nach 250 Jahren keiner ihrer Verwandten mehr am Leben sein wird.
Schon auf dem nahezu lichtschnellen Hinflug verbünden sich die neun anderen Crewmitglieder gegen die Nummer 10, Mr. Osden, den einzigen Empathen an Bord. Sie nennen ihn ein Ekelpaket. Dazu gehört nicht viel Gehässigkeit, denn Osden tut alles, um diesen Eindruck noch zu bestätigen: Es ist seine Art, die Aggression, die man ihm entgegenbringt, zurückzuwerfen. Dass durch diese sich selbst verstärkende Feedbackspirale die Aggressionen nicht gerade abgebaut werden, versteht sich von selbst.
Kaum ist man nach der ersten Erkundung und Kartierung gelandet, schickt die Kommandantin Osden in den nahen Wald, und Osdens Entfernung löst bei allen sofortige Erleichterung aus. Die Emotionen können wieder frei strömen und Olleroo, die promiske Beldenerin, hat mit allen Sex. Doch dann bleiben eines Vormittags Osdens Meldungen aus. Als die Kommandantin mit einem Helfer nachschaut, finden sie Osdens Camp verlassen vor. Sie suchen im dichten Gebüsch und finden Bewusstlosen mit dem Gesicht im Dreck. Er wurde mit einem stumpfen Gegenstand fast der Schädel eingeschlagen. Kaum fasst sie ihn an, wird die Kommandantin von einer Welle der Angst und Panik erfasst, so dass sie fast ohnmächtig wird. Mit Müh und Not reißt sie sich am Riemen, so dass sie Osden mit ihrem Helder ins Flugboot schaffen kann.
Das, was Osden vor und in seiner Bewusstlosigkeit empathisch gefühlt hat, geht über das Vorstellungsvernögen so manchen Crewmitglieds hinaus: Könnte es sein, dass die Wurzeln, Bäume, Grashalme alle den den Neuronen, Sensoren und Synapsen eines Gehirn entsprechen? Wenn ja, dann besteht die ganze Welt aus einem einzigen großen Organismus, der in der Lage ist, Gefühle zu empfangen und zu senden! Das Problem: Da es bislang das einzige Wesen in seinem Universum war, empfindet es Angst, wenn es dem Anderen, dem Fremden begegnet, und sendet diese Abwehrreaktion derart stark, dass, durch Osden verstärkt, alle Besatzungsmitglieder in Panik verfallen.
Aber wie ließe sich diese negative Feedbackspirale durchbrechen, fragt die Kommandantin den auf einmal so kooperativen Osden. Osden muss an seinen eigenen Werdegang vom autistischen Kind-Empathen hin zum verantwortungsbewussten, aber abweisenden Erwachsenen denken, den sein Psychiater ihm ermöglicht hat. Vielleicht gelingt ihm so die Heilung dieser Beziehung: Er muss sich dem Anderen, dem Planetenbewusstsein, gänzlich hingeben, so dass es ihn nicht wieder abwehrt, sondern in sich aufnimmt …
Mein Eindruck
Der Titel der Erzählung von 1971 geht auf das Gedicht „To his Coy Mistress“ des englischen Barockdichters Andrew Marvell zurück: „Our vegetable love should grow / Vaster than empires, and more slow …“. Der zweite Vers lieferte auch den Originaltitel. Dabei spielt besonders das Wort „vegetable“ eine Schlüsselrolle: In der Geschicht ist damit wohl das pflanzliche Gehirn der Welt 4470 gemeint, die „vaster than empires“ erscheint, und doch langsamer ist.
Die Story ist im Hainish-Universum platziert, das die Autorin mit drei ersten Romanen sowie dem Kurzroman „Das Wort für Welt ist Wald“ (1972) schon eindrucksvoll entworfen und geschildert hatte, bevor sie mit „Die linke Hand der Dunkelheit“ einen preisgekrönten Roman veröffentlichte, der bis heute zu den SF-Klassikern gehört (siehe oben unter „Der König von Winter“).
Sowohl in „Unermesslich …“ als auch „Das Wort für Welt ist Welt“ schickt die Autorin Forschungsexpedition auf Welten, in denen Pflanzen die dominante Spezies darstellen. Doch wie können bewegliche Organismen wie Menschen und Hainish mit diesen Wesen koexistieren, lautet die Frage, wenn doch beide so unterschiedlich sind. Hier treffen Welten der Psychologie aufeinander. Doch wieder kommt Le Guins Philosophie zum Tragen, die dem fernöstlichen Taoismus nähersteht als der westlichen Dialektik: Gegensätze müssen aus These und Antithese nicht eine Synthese bilden, sondern lernen, in einer Balance zu koexistieren, ohne dass ein Kampf stattfindet. Man denke beispielsweise an das Paar Yin und Yang und die damit verbundenen Kräfte.
In der Geschichte gibt es jedoch einen mächtigen Störfaktor, der die Entstehung der Balance fast verhindert. Es handelt sich nicht etwa um Osden, sondern um Porlock, einen Hainish, der von einer Art Paranoia gepackt wird, als er auch nur den Gedanken an ein Weltgehirn aus Pflanzen fassen soll. Schließlich stirbt er in der Begegnung mit diesem Wesen vor Angst, während sich Osden dem Weltgehirn ergibt und Frieden findet. Die Autorin deutet damit an, dass diejenigen, die sich dem Tao-Prinzip nicht beugen, sondern in Furcht und Ablehnung verharren, schließlich geistig zerbrechen werden.
In „Das Wort für Welt ist Wald“ wendet sich das scheinbar so friedliche Tao-Prinzip in einen Widerstandskampf gegen jene terranischen Ausbeuter, die den Wald vernichten wollen. Die Novelle wurde als ein Gleichnis auf den Vietnamkrieg der USA gelesen. Folgerichtig erschien sie in Harlan Ellisons provokativer Anthologie „Again, Dangerous Visions“ (1972).
Die Sterne unten
Die Geschichte beginnt wie eine Fortsetzung von „Die Meister“: Der Astronom Guennar wird wegen angeblicher Ketzerei beinahe in seinem Observatorium verbrannt, doch durch einen Unterschlupf überlebt er, so dass Graf Bord anderntags findet. Bord ist kein Strenggläubiger, sondern hilft dem verwirrten jungen Mann, sich in einer alten Silbermine in Sicherheit zu bringen, und versorgt ihn dort mit Essen usw. Außerdem muss er ihm klarmachen, wieso die Soldaten des Bischofs hinter Guennar her sind.
Doch Guennar fehlt die Große Uhr des Universums und er sucht wieder Sterne, wie von jeher. Als er, wie von Bord geraten, tiefer in die Mine vordringt, stößt er auf glimmendes Gestein – und auf alte Bergleute, die ihn mit Proviant unterstützen. Zunächst ahnen sie nicht, dass er ein Gelehrter ist, doch seine Fähigkeiten werden durch das Bauen von Geräten offensichtlich. Dennoch sind sie weiterhin freundlich und tolerant ihm gegenüber. Aber er ihnen auch noch sagt, dass er mithilfe seiner Linse und des speziellen Geräts dafür die Sterne im Stein sehen können, halten sie ihn für ein klein wenig durchgeknallt. Das kommt davon, wenn man nie an die Oberfläche geht.
Kurz bevor er auf Nimmerwiedersehen verschwindet, bezeichnet er dem Ältesten eine Stelle in einem aufgegebenen Teil der Mine, an der er die Sterne in der Tiefe finden werde. Und tatsächlich: Als sie an der bezeichneten Stelle, die wie mit einem Sternbild verziert ist, graben, stoßen sie einen Fuß unter der Oberfläche auf eine reiche Silberader: unermesslicher Reichtum …
Mein Eindruck
Was wie ein Remake von „Galileo Galilei“ beginnt, wendet sich unversehens in eine Erkundung von Moria, mit den Bergleuten als Zwergen. Nur dass diesmal Galileo die Sterne nicht im Himmel findet, sondern unter der Erde, als wären sie Mithrilsilber. Die Aussage ist jedoch klar: Für den, der sich zu sehen und zu suchen traut, hält die Schöpfung überall Wunder und Erkenntnisse bereit – egal wo. Und das ist eine optimistische Botschaft, die man gerne unterschreibt. Das Dumme ist nur, dass es immer mehr Leute gibt, die einem das ungehinderte Sehen verbieten wollen.
Sehbereich
Die Mars-Expedition Psyche 14 ist zurückgekehrt, doch der unvermittelte Abbruch der Funkverbindung kurz vor der Landung im Pazifik lässt die Bodenkontrolle in Houston nichts Gutes ahnen. Ihre Mitarbeiter werden nicht enttäuscht: Commander Rogers ist bereits seit zehn Tagen tat, und es ist klar, warum die anderen beiden Astronauten seinen Raumanzug nicht geöffnet hatten (er ist schon etwas angegammelt). Aber auch Temski und Gerry Hughes haben ihre Probleme, wie im Militärhospital bald klar wird. Hughes ist funktionell blind und Temski funktionell taub. Das heißt, dass ihre Sinnesorgane zwar intakt und funktionstüchtig sind, ihr Gehirn aber so überlastet ist, dass es die Wahrnehmung blockiert. Die Frage nach der Quelle dieser Überlastung soll erstaunliche Antworten liefern.
Die Mission der drei Astronauten bestand darin, auf dem Roten Planeten rätselhafte Formationen zu erkunden, die als eine vorzeitliche „Stadt“ angesehen werden konnten, und an Ort D, der als „Zimmer“ bezeichnet wurde, befanden sich „Briefkästen“ – allesamt hilflose Versuche, menschliche Begriffe dem Unbegreiflichen aufzuzwingen. Hughes, der Geophysiker, weigert sich, diese Versuche anzuerkennen. Er ist einfach zu intelligent, ein richtiger Intellektueller. Was kann man von so einem schon erwarten, fragen sich die Militärs.
Aber das Rätsel um Temski und Hughes muss gelöst werden, nicht nur wegen der Forschungsmittel, sondern auch wegen der Angehörigen der beiden, die ihre Lieben zurückhaben wollen. Dr. Sidney Shapir erzielt mit unendlicher Geduld einen Durchbruch – und doch wieder nicht. Temski kann er die Ohren verstopfen, und plötzlich ist dessen Gehirn nicht mehr blockiert, sondern empfangsbereit für andere Wahrnehmungen. Temski lernt, seine Gedanken niederzuschreiben, und der blinde Hughes kann mit ihm per Schreibmaschine kommunizieren. Ihr Dialog ist faszinierend.
Bei einem Ausflug ans Tageslicht auf dem Dach des Hospitals bricht Hughes angesichts der Lichtflut und eines unbekannten Anblicks zusammen – ein herber Rückschlag. Aber was ist es, was ihn ständig so überwältigt? Und was ist es, was Temski, der sich mittlerweile geradezu normal verhält, als überirdisch schöne Musik bezeichnet?
Mein Eindruck
Wie mag es wohl, das Antlitz Gottes wahrzunehmen? Psyche 14 hat Gott in den Ruinen einer 700 Mio. Jahre alten Siedlung entdeckt. Kein Wunder also eigentlich, dass die Sinne der drei Astronauten völlig überlastet sind. Aber wer glaubt schon an ein solches Wunder? Es widerspricht jeder Art von Vernunft. Allein schon der Glaube an die Existenz Gottes verlangt einen Sprung hinweg von der Vernunft. Das kann jeder in der Bibel nachlesen und braucht dazu nicht mal ein Damaskus-Erlebnis wie Saulus, der zu Paulus wurde, der wichtige Apostel, der das Christentum erfand (denn vorher war Jesus bloß ein weiterer jüdischer Prophet gewesen).
Was Le Guins Story so überaus faszinierend macht, ist erstens die Tatsache, dass sie sich streng an die Methode der naturwissenschaftlichen Science-Fiction hält, diese aber mit höchst psychologischen Einsichten und sogar philosophisch-religiösen Gedanken auflädt. Dadurch wird die Suche nach jener Ursache, die Hughes geblendet und Temski betäubt hat, zu einer spannenden Ermittlung, die zu einem unerwarteten Ergebnis führt. Lapidar erfahren wir am Schluss, dass die Nachfolgemission Psyche 15 quasi die Gesetzestafeln eines neuen Evangeliums gefunden hat.
Wegrichtung
Die Ich-Erzählerin ist eine Eiche, die schon fast 200 Jahre auf dem Buckel hat, aber immer noch, das aus einer stolzen Familie stammen, stramm ihren anstrengenden Dienst verrichtet. Zu Anfang des Jahrhunderts gab es in ihrer Gegend nur Menschen mit Kutschen und Pferden. Für diese konnte sie gemächlich wachsen und wieder schrumpfen. Aber dann gab es schon das erste Auto: eine ältere Dame wurde von einem Mann chauffiert. Da musste die Eiche schon schneller wachsen und schrumpfen. Einen Monat gab es Ruhe. Aber dann gings richtig los! Eine Auto nach dem anderen tauchte auf, und die Straße füllte sich, wurde ausgebessert, verbreitert, eine Umgehungsstraße.
Dieser Stress! Aber was tut man nicht alles, um die Ordnung der Dinge aufrechtzuerhalten? Die stolze Eiche wächst und schrumpft, bewegt sich auf ein Auto zu – und von einem anderen Weg. Ein kleines Kunststück, nicht wahr, diese Aufteilung in zwei oder mehr verschiedene Richtungen? Die Eiche ist stolz auf diese Leistung.
Doch dann tötet sie. Wird zum Mörder. Notgedrungen. Und das kommt so: Eines der Autos überholt, trifft aber auf unerwarteten Gegenverkehr. Was ist zu tun? Die Eiche tritt ihm in den Weg, und es kommt zur Kollision. Ihr macht das nicht viel aus, aber das Auto erleidet Totalschaden, der Fahrer stirbt. Aber bevor er die Existenz des Todes anerkennt, erblickt er die Eiche so, wie sie ist. Und er erblickt in ihr die Ewigkeit. Das geht ihr völlig gegen den Strich, denn sie steht für die Sterblichkeit, und protestiert – daher diese Eingabe, um auch mal die andere Seite zu Wort kommen zu lassen.
Mein Eindruck
In dieser kuriosen kurzen Story wendet die Autorin die Relativität des Blickwinkels, ja, den Wechsel der Perspektive, um: Nicht der Fahrer bewegt sich, so dass die Dinge perspektivisch zu wachsen und zu schrumpfen scheinen, sondern es sind diese Dinge selbst, nämlich die Eiche, die tatsächlich wachsen und schrumpfen, sich nähern und wieder entfernen.
Die Dinge werden durch diese Umkehrung aus passiven Objekten zu aktiven Subjekten. Die Eiche ist denkendes und fühlendes Wesen – die Autorin beweist immer wieder ihre Empathie für Bäume. Und daher kann die Eiche auch töten. Sie will die „Ordnung der Dinge“, wie sie sie versteht, aufrechterhalten. Ein Opfer muss dafür gebracht werden. Leider geht dabei etwas schief. Immer wieder stellt Le Guin „die Ordnung der Dinge“ in Frage und legt so die Grundprinzipien der menschlichen Existenz bloß.
Die Omelas den Rücken kehren. Variationen über ein Thema von William James
Omelas, die Stadt der Freude und des Glücks, liegt zwischen den Bergen und dem Meer, behütet vom strahlend blauen Himmel. Heute ist wie fast jeden Tag ein Fest, und Musik und Lachen erklingen. Die Leute auf den Straßen und Plätzen sind jedoch nicht auf Drogen, wie man vielleicht meinen könnte, sondern einfach nur happy.
Dies sind sie, weil sie alle ein dunkles Geheimnis kennen, das jeder von ihnen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren kennenlernt: Dass es in einem Keller oder Untergeschoss ein nacktes Kind gibt, das in einer kleinen, fast lichtlosen Zelle eingesperrt ist und nur einmal am Tag zu essen und zu trinken erhält. Nie lässt der Besucher es frei, nie spricht jemand mit ihm, obwohl es um seine Freiheit fleht.
Das Bewusstsein dieses schrecklichen Geheimnis befeuert die Freude, die Tiefe der Kunst, die Inbrunst der Anstrengungen und Beziehungen. Und sicherlich könnte man nicht verantworten, das Glück der vielen dem Glück jenes einzelnen Kindes zu opfern, nicht wahr. Doch es gibt unter den Besucher auch ein paar wenige, die sich nicht damit abfinden, das leid dieses Kindes hinzunehmen. Sie sind jene, die Omelas, der Stadt des Glücks, den Rücken kehren und hinausziehen in das Unbekannte, allein und ohne Ziel.
Mein Eindruck
„Variationen über ein Thema von William James“, heißt diese berühmte kurze Geschichte. James wird von Le Guin in der Einleitung zitiert: Der Moralphilosoph wirft die Frage auf, ob es moralisch vertretbar ist, die Mehrheit ein Verhalten A tun zu lassen, wenn dies bedeutet, dass eine Minderheit oder ein Einzelner durch dieses Verhalten A zugrunde gerichtet wird. Er ist der Sündenbock, ein dostojewskisches Konzept aus den „Brüdern Karamasow“. Ist seine Existenz gerechtfertigt? Und wenn ja, wodurch? Kann es dadurch zu einem verhalten B kommen?
Die moralische Schuld des Westens gegenüber den armen Entwicklungsländern – sagen wir, Mosambik oder Haiti – spiegelt sich in der Situation von Omelas. Die meisten von uns wissen oder ahnen zumindest, dass wir von der Ausbeutung der Leute in der Dritten Welt ein nahezu fürstliches Leben führen können. Und keiner ist daher willens, dies zu ändern – aus purem Egoismus. Aber was sagt dies über unsere moralische Verfassung aus und was über unsere Berechtigung, mit dem Finger auf Missstände in jenen ausgebeuteten Ländern zu zeigen?
Die Autorin wartet vielleicht jeden Tag auf neue Leser und andere Menschen, die dem glücklichen Omelas den Rücken kehren und andere Wege gehen, weil sie die Schuld nicht mittragen wollen. Eine dieser Dissidentinnen ist Odo, die Begründerin des Anarchismus auf dem Planeten Urras, den die Autorin in ihrem Roman „Planet der Habenichtse / Die Enteigneten“ so eindringlich beschreibt. Es ist der erste und einzige Roman über Anarchismus in der Science-Fiction, wenn nicht sogar überhaupt.
Der Tag vor der Revolution (In Memoriam Paul Goodman 1911-1972)
Die Revolution der Anarchisten dauert immer noch an, doch sie begann an einem Tag vor einem Vierteljahrhundert, als Odo Laia ihren Freund Taviri Asieo suchte, der gerade auf einem Platz gegen Steuern wetterte. 1400 Anhänger Taviris und Odos wurden damals eingesperrt und viele starben im Gefängnis. Doch heute ist Odo wieder frei, hat mit ihrem in der Zelle geschriebenen politischen Schriften die Revolution ausgelöst. Sie ist eine alte Frau von 72 Jahren und nach einem Schlaganfall behindert, aber immer noch aktiv.
Ihr Sekretär Noi schreibt jetzt die Briefe an die Rebellen in abtrünnigen Provinz des Staates Thu. Er und viele weitere Anhänger verehren Odo Laia für das, was sie erreicht hat. Aber sie bemitleidet sich ob dieses gebrechlichen Körpers, in dem sie sich nun eingesperrt vorkommt, und bricht zu einem Spaziergang auf die Straße auf. Sie kommt bald ins Schnaufen. Wer bin ich jetzt, fragt sie sich. Eine Anhängerin findet sie, bringt sie zurück. Im Haus, der ihrer Bewegung als Hauptquartier dient, freut man sich auf den Generalstreik: Morgen beginnt die Revolution! Doch ohne sie, entscheidet Odo müde …
Mein Eindruck
Die Autorin ist eine hochdekorierte Wissenschaftlerin, Tochter eines Anthropologen, und hat sich intensiv mit der Idee der Anarchie und den Theoretikern des Anarchismus beschäftigt. Daraus destillierte sie den bahnbrechenden Roman „Planet der Habenichtse“ und die vorliegende Erzählung.
Wenig passiert, doch etwas geht zu Ende und etwas anderes beginnt. Auch das ist notwendiger Teil einer Revolution. Odo erinnerte mich an Mahatma Gandhi, der ja auch den Prozess der Umwälzung in Gang setzte, erst in Südafrika, dann in Indien, das von den Briten beherrscht wurde. Als 1947 die Unabhängigkeit ausgerufen wurde, ging dieser Wandel fast spurlos an ihm vorüber, obwohl er ihn in Gang gesetzt hatte.
Die Story ist ein Porträt des Revolutionärs als alter Mensch, der dem Wandel unterworfen ist wie alles andere auch. Doch statt des Triumphs angesichts der bevorstehenden Erreichung des Ziels zieht sich der Revolutionär müde zurück: sollen andere den Stab übernehmen.
Die Übersetzung
Die Übersetzung ist stilistisch auf einem angemessen hohen Niveau, so dass die gedankliche Tiefe der Autorin durchschimmert. Doch in den Text haben sich zahlreiche Fehler eingeschlichen, die von vergessenen Buchstaben über Kommafehler bis zu falschen Schreibweisen („Country“ statt „County“, S. 197, „der“ statt „des Astronomen“, S. 247) reichen.
Richtig ärgerlich werden die Fehler aber erst, wenn etwa auf S. 204 von einem „gründlichen“ statt eines „grünlichen“ Planeten die Rede ist (in „Neun Leben“).
In die gleiche Kerbe hauen die drei Übersetzerinnen in der Novelle „Unermeßlich …“: Auf Seite 231 steht der zweifelhafte Satz: „Dass Empfindungsfähigkeit oder Intelligenz nicht etwas Dringliches sind, dass man sie nicht in den Gehirnzellen finden oder analysieren kann, ist mir bewusst.“ Der Satz ergibt erst dann einen Sinn, wenn man „Dringliches“ durch „Dingliches“ ersetzt: Die Intelligenz ist kein dinglicher Inhalt von Zellen, sondern eine von deren Funktionen.
Solche Stolpersteine tragen nicht gerade zum Lesevergnügen oder zum Verständnis der wichtigen Erzählungen bei. Sie zu eliminieren, wäre die Aufgabe einer modernisierten Ausgabe.
Unterm Strich
Mit hohem Einfühlungsvermögen, sozialem Engagement und intellektueller Brillanz greift die Autorin spekulative Themen der Fantasy und der Science-Fiction ebenso souverän auf wie zeitgenössische und historische Stoffe. Daher verwundert es nicht, dass manche dieser Texte keinen Bezug zu Science-Fiction oder Fantasy haben. Die Autorin fordert ihr Publikum jedenfalls zum Mit- und Nachdenken heraus, denn jede dieser Geschichten will gedeutet, nachbearbeitet werden und entzieht sich dem sofortigen Verständnis. Der Stil, in dem jede Geschichte erzählt wird, ist sehr ausgefeilt und dem Thema jeweils angemessen.
Die Glanzstücke dieser frühen Sammlung sind in meinen Augen die zentralen Novellen „Der König von Winter“, „Neun Leben“ sowie „Unermeßlich …“. Sie legen Einfallsreichtum ebenso wie eine einleuchtende psychologische Wendung mit philosophischem Hintergrund an den Tag, die den Leser mit neuen Erkenntnissen zurücklässt. Auch „Sehbereich“ fand ich beeindruckend, denn es ist eine spannende Ermittlung über die Ursachen der Offenbarung, einer Begegnung mit Gott.
Eintrittskarte zu Le Guins Welten
Die Sammlung bietet dem Einsteiger in die Welt der Phantastik nicht nur bemerkenswerte Erzählungen, sondern zugleich auch den Zutritt zu Le Guins eigenen Welten, die sie in den „Erdsee“-Romanen, den SF-Romanen „Rocannons Welt“, „Die linke Hand der Dunkelheit“ sowie „Planet der Habenichtse“ ausgebaut hat (siehe dazu meine Berichte). Auf dieser Ebene ist eindeutig eine Entwicklung der Autorin abzulesen: Ausgehend von relativ einfacher Fantasy über komplexere SF mit Fantasy-Schauplatz hin zu vielschichtigen SF-Erzählungen wie „Unermeßlich …“, was dann in einer Verschmelzung von SF und Sozialutopie gipfelt.
Wie die kurze Story „Die Omelas den Rücken kehren“ belegt, muss Kürze keineswegs mit gedanklicher Seichtheit einhergehen, ganz im Gegenteil: Diese kleine Skizze, die keine Handlung vorweisen kann, stellt eine schmerzhafte moralphilosophische Frage. In der Frage, ob sich Freude und Glück vieler angesichts des Leids eines Einzelnen rechtfertigen lässt, manifestiert sich das Schuldgefühl des Westens gegenüber den vormals ausgebeuteten Länder der Dritten Welt. Doch der moderne Raubtier- und Casino-Kapitalismus hat sich binnen 40 Jahren dieses Schuldgefühls entledigt. Heute ist überall Omelas, und es scheint keinen Ort mehr zu geben, wohin sich jene, die ihm den Rücken kehren wollen, noch wenden können.
HINWEIS
Ich möchte auf zwei weitere Erzählungssammlungen hinweisen. Die Erzählungen in „Die Kompassrose“ sind experimentell, feministisch und vielseitig. Von Le Guins erfundenem Phantasieland Orsinien erzählen die „Geschichten aus Orsinien“. Eine spätere gute Sammlung trägt den Titel „Ein Fischer des Binnenmeeres“, verlegt in der Edition Phantasia, Bellheim, die noch weitere Veröffentlichungen dieser wichtigen Autorin plant.
Taschenbuch: 334 Seiten
Originaltitel: The Wind’s Twelve Quarters (1975)
Aus dem US-Englischen übertragen von Gisela Stege, Birgit Reß-Bohusch und Margot Kempf
ISBN-13: 9783453309647
www.heyne.de
