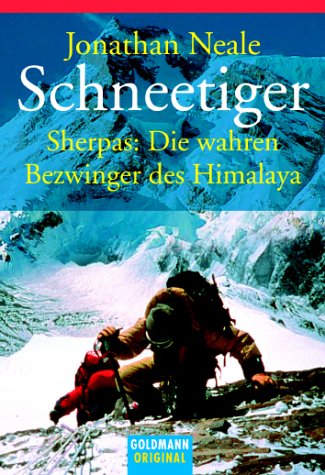
Schneetiger zunächst wider Willen
Wer hätte gedacht, dass die Sherpas, die wir in jedem Filmbericht über den Bergtourismus im Himalaya kopfstark durch das Bild wandern sehen, ursprünglich gar keine Ahnung hatten, wie hohe Berge zu besteigen sind? Andererseits überrascht dies nicht, denn sie hatten keinen Grund dazu, bis die weißen Bergsteiger aus dem Ausland zu ihnen kamen. Sherpas lebten im Gebirge, aber sie stiegen mit ihrem Vieh nur so hoch wie es nötig war. 8000 Meter hohe Gipfel stellten aufgrund eines gesunden Menschenverstandes keine Verlockung dar und wurden außerdem von Geistern bewohnt, die Besuch nicht schätzten.
Auftritt der britischen Gentleman-Kraxler. Sie kamen aus der Kolonie Indien in den Himalaya und besaßen von daher gewisse Standortvorteile gegenüber der Konkurrenz. Die gab es reichlich, denn das Bergsteigen gewann in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts stetig an Bedeutung. Nachdem die meisten weißen Flecken auf der Erdkarte verschwunden und zuletzt die Pole erobert waren, ging es nun darum, die höchsten Berge zu erklimmen. Da deren Zahl begrenzt ist, wurden diese Ruhm verheißenden Gipfel eifersüchtig gehütet.
Abgesehen davon war es verteufelt schwierig sie zu besteigen – und noch schwieriger lebendig wieder zurückzukehren. Die europäischen Bergsteiger kannten sich inzwischen gut aus mit den Gebirgen ihrer Heimatländer. Doch so ein Berg in den Alpen ist kaum halb so hoch wie sein Gegenstück im Himalaya. Was das bedeutet – nämlich einen Ausflug in weltraumnahe Gefilde -, wusste keiner dieser kühnen Eroberer.
Hinterher getrottet, aber unverzichtbar
Also wurde experimentiert und dabei das eigene Leben aufs Spiel gesetzt; noch mehr freilich die Leben derer, die im Hintergrund die weniger glamouröse Kärrnerarbeit leisten und den Gipfelstürmern Lebensmittel, Tabak oder Toilettenpapier hinterher tragen mussten. Als „Kulis“ kamen die starken, aber angeblich ungebildeten und ‚unterlegenen‘ Sherpas gerade recht. Diese hießen In ihrer kargen Heimat wiederum die Möglichkeit willkommen, sich ein Zubrot zu verdienen, auch wenn dies ein frühes Ende in Kälte, Schnee und Gletscherspalten mit sich bringen konnte, so wie es 1922 während der britischen Everest-Expedition gleich sieben Sherpas erwischte. (Kommentar des Ausstatters der Expedition: „Gott sei Dank ging kein europäisches Leben dabei zugrunde.“)
Neale schildert, wie Herren (vorn) und Träger (hinten) gleichermaßen ahnungslos in den Himalaya vorstießen. Mit den zu erwartenden katastrophalen Ergebnissen, da diese Hochwelt Fehler und Selbstüberschätzung nicht verzeiht. In der Not rückten Sahibs und Sherpas näher zusammen, der Berg ließ Dünkel und Klassenunterschiede wanken. Es dauerte nicht lange, bis die Sherpas bemerkten, dass a) ohne sie nichts ging im bergsteigenden Himalaya und sie sich b) die Frage stellten, was sie eigentlich abhielt mitzutun im sportlichen Wettkampf.
Vom Träger zum Bergsteiger
Mit ihrem Wissen und dem Erlernten wurden sie den Gästen vom Kuli zum Partner und Bergkameraden. Noch später ließen einige Sherpas die Ausländer ganz außen vor und kletterten selbst. Tensing Norgay (s. u.) gründete das „Himalayan Mountaineering Institute“ in Darjeeling, das Generationen einheimischer Bergsteiger ausbildete.
Aus Trägern wurden so im Laufe von Jahrzehnten die „Schneetiger“. Als eigentlichen Wendepunkt dieser Entwicklung macht Neale die nazideutsche Expedition zum Nanga Parbat im Jahre 1934 fest. Die überforderten, unter Erfolgsdruck stehenden Sahibs brachten sich während eines Schneesturms in Sicherheit und ließen ihre Träger auf über 7000 m Höhe im Stich. Den Sherpas gelang es, sich ohne Lebensmittel oder Zelte in einem siebentägigen Martyrium zu retten. Diese Episode vergaßen sie weder im Bösen wie im Guten. Vorbei waren die Zeiten, in denen sie sich herumscheuchen ließen.
Hilfreich war es, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eine andere Generation europäischer Bergsteiger in den Himalaya kam. Hier waren es besonders die berufsmäßigen Bergführer aus der Schweiz, die in den Sherpas von vornherein Gefährten sahen. Dies war der Nährboden, auf dem sich die „Schneetiger“ entwickelten, bis 1958 der Mount Everest, höchster Berg der Erde, von Edmund Hillary und Sherpa Tensing Norgay bezwungen wurde – Seite an Seite.
Geschichte im Bergschatten
Wie aus der ausführlichen (aber – dies zur Beruhigung der Leser – das Werk nicht einmal annähernd ausschöpfenden) Inhaltsangabe hervorgeht, stellt sich der Verfasser seinem Thema aus einem bisher sträflich vernachlässigten Blickwinkel. Zwar muss die Geschichte des Himalaya-Bergsteigens nunmehr nicht etwa neu geschrieben werden, aber sie erfährt doch eine Reihe wichtiger Korrekturen, vor allem aber Ergänzungen.
Die Sherpas haben nicht nur eine eigene Kultur, sondern eine Stimme. Auch Ehrgeiz ist ihnen nicht fremd. Dem zivilisationsfeindlichen Weltverbesserer, der sie ökologisch korrekt lieber in yetimistbeheizten Yakfellzelten sitzen sieht, mag dies missfallen, aber Sherpas sind halt auch nur Menschen. In der Gegenwart wünschen oder fordern sie ihren Anteil am Bergtourismus – am Geschäft und am Ruhm. Außerdem wollen sie ihre Rolle in der Geschichte gewürdigt wissen, in der sie sich zu Recht bisher unter Wert verkauft fühlen.
Insofern stieß Autor Neale offene Türen auf, als er sich daran machte, die wahre Geschichte der „Schneetiger“ zu erzählen. Nun ließe sich wiederum darüber philosophieren, wieso sich kein Sherpa fand, der dies übernahm. Ist halt nicht geschehen, und Neale hat gute Arbeit geleistet.
Jemand musste einfach fragen
Das fängt schon damit an, dass er sich nicht nur in den Archiven diverser Bergsteigerclubs und -vereine des Westens aufgehalten, sondern sich an den Ort des Geschehens begeben hat. Viele Monate war Neale in Indien und im Nepal, hat sich den Sherpas vorgestellt, mit ihnen gelebt und sich sogar bemüht, die komplizierte Landessprache zu lernen. Wie das meist so ist, wurde dies von den Einheimischen mit Freundlichkeit und Offenheit honoriert.
Nicht dass sich die plötzlich zahlreich auf der Bildfläche erscheinenden Überlebenden diverser Hochgebirgs-Expeditionen bisher versteckt gehalten hätten; es hatte sich nur niemand die Mühe gemacht nach ihnen zu fahnden oder sie zu fragen. Aber Neale fand sie, die sich zum Teil an Ereignisse erinnern konnten, welche sieben Jahrzehnte in der Vergangenheit lagen – und sie redeten!
Wer nun – zumal im Zusammenhang mit unseren nazideutschen Bergrecken – mit saftigen Skandalen rechnet, wird freilich enttäuscht sein: „Schneetiger“ erzählt die Geschichte einer ganz normalen Ausbeutung, wie sie in den Kolonien und später in den ‚selbstständigen‘ Regionen der dritten und vierten Welt an der Tagesordnung war und ist. Die Himalaya-Besteiger aus dem fernen Westen waren in der Regel nicht vorsätzlich anmaßend, die Sherpas auf der anderen Seite durchaus keine naturgeborenen Engel, sondern beide Seiten bis zu einem gewissen Punkt Gefangene ihrer Zeit und der herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Der Punkt ist, dass die Sherpas es früher als andere ‚Naturvölker‘ und aus eigener Kraft schafften sich zu emanzipieren. Sie nutzten dies u. a., um eine eigene nepalesische Oberschicht zu gründen und den Zorn der nicht am Bergtourismus partizipierenden Landsleute zu erregen, aber das steht auf einem anderen Blatt …
Autor
Jonathan Neale wurde 1949 in New York geboren. 1971-1973 nahm er an anthropologischen Feldforschungen mit Nomadenstämmen in Afghanistan teil. Seither bereist er die ganze Welt.
Ein ‚anderer‘ Jonathan Neale ist seit den späten 1960er Jahren sehr aktiv in der Zivilrechts- und Antikriegsbewegung der USA. Seiner Karriere als Universitätsdozent war dies ebenso wenig förderlich wie sein ausgeprägter Reisedrang. So begann Neale die Menschen quasi vor Ort zu studieren, was ihn u. a. Jobs als Krankenhaustechniker, Zimmermann, Abtreibungsberater, AIDS-Tester oder Redakteur annehmen ließ. Heute lebt Jonathan Neale als hauptberuflicher Schriftsteller in London.
Taschenbuch: 412 Seiten
Originaltitel: Tigers of the Snow (New York : St. Martin’s Press 2002)
Übersetzung: Jerry Hofer
http://www.randomhouse.de/goldmann
Der Autor vergibt: 




