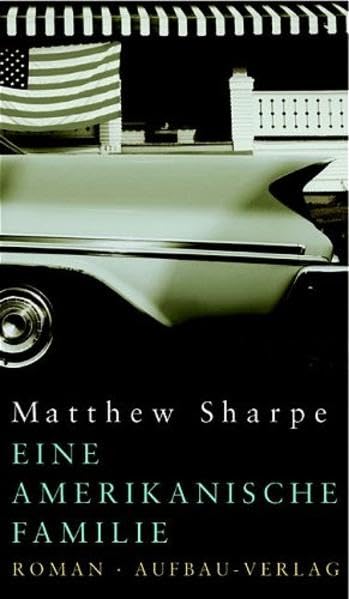Die Geschichte, die hinter der Veröffentlichung von „Eine amerikanische Familie“ steckt, mutet schon ein wenig fantastisch an. Mehr als 20 Verlage ließen Matthew Sharpe mit seinem Roman abblitzen, bis der winzige New Yorker Verlag |Soft Skull Press| Sharpes Buch druckte. Ein paar Wochen später war der Roman ein absoluter Renner. Die Kritiker zeigten sich begeistert und mittlerweile sind sogar schon die Filmrechte verkauft. Die Pressestimmen auf dem Klappentext verheißen Gutes. Vollmundiges Lob und ein Vergleich mit Jonathan Franzens [„Die Korrekturen“ 1233 lassen Freunde moderner amerikanischer Literatur in jedem Fall aufhorchen.
Eine schrecklich nette Familie: Chris Schwartz ist 17, ein vorlauter Klugscheißer aus Bellwether, Connecticut, der zu allem und jedem einen blöden Spruch macht. Seine ein Jahr jüngere Schwester Cathy unternimmt trotz der jüdischen Wurzeln ihrer Familie gerade einen Ausflug zum Katholizismus, getreu ihrem Vorbild der jüdischen Märtyrerin Edith Stein folgend. Pubertät wäre mit Blick auf beide ein passendes Stichwort. Vater Bernard schafft es, nachdem seine Frau ihn verlassen hat, kaum noch ohne seine tägliche Dosis Prozac aus dem Bett, während seine mittlerweile von ihm geschiedene Frau Lila nach Kalifornien durchgebrannt ist und dort Karriere macht. Alles ganz normal bei den Schwartzens.
Das ändert sich schon bald, als Bernard versehentlich seine Antidepressiva vertauscht. Er erleidet einen Schlaganfall und fällt ins Koma. Als Bernard aufwacht, ist die Welt nicht mehr dieselbe. Sohn und Tochter geleiten den Vater zurück in den Alltag, der sich für Bernard erschreckend befremdlich gestaltet. Er muss die einfachsten Handgriffe neu erlernen und tut sich mit so ziemlich allem schwer. Doch besonders Chris kümmert sich rührend, seine Schulbildung opfernd, um Bernards Training. Zusammen schlingert die Familie durch so manche kleinere und größere Katastrophe. Die Sprösslinge werden stetig, und ohne es recht zu merken, erwachsen und während sie ihre Unschuld verlieren, hat Vater Bernard sie wieder zurückgewonnen …
„Eine amerikanische Familie“ erzählt genau das, was der Titel vermuten lässt: Die Geschichte einer amerikanischen Familie. Etwas plump mag der deutsche Titel wirken (im Original heißt es: „The Sleeping Father“), aber er trifft’s halt. Sharpes Roman ist in erster Linie eine Familiengeschichte. Und die kommt so komisch und schräg daher, dass das Lesen von der ersten bis zur letzten Seite durchweg Spaß macht.
Den Reiz des Romans macht dabei seine Mischung aus. Auf der einen Seite irrsinnig witzig, auf der anderen Seite alles andere als eine Komödie. Sharpe gelingt der Drahtseilakt zwischen Dramatik und Witz, zwischen Humor und Melancholie. Verglichen wird „Eine amerikanische Familie“ im Verlagstext mit Sam Mendes‘ Film „American Beauty“, in dem Kevin Spacey als von Midlife-Crisis geplagter Vorstädter die Höhen und Tiefen eines sich wandelnden Familienlebens durchmacht. Ganz grob kann man den Vergleich im Grunde stehen lassen. Im Detail gibt es natürlich zu viele Unterschiede, um beides wirklich in einen Topf werfen zu können, aber die Stimmung ist in beiden Werken durchaus ähnlich. Diese Mischung aus Witz und Melancholie und dieser alles durchdringende Sarkasmus, der im Endeffekt dazu dient, den wahren Kern des heutigen Amerika zu entblößen, ist beiden Werken gemein.
Doch während die Figuren in „American Beauty“ so erschreckend normal wirken, präsentiert sich bei „Eine amerikanische Familie“ manches etwas überspitzt, was Sharpe aber andererseits durch seine feinfühlige Erzählweise kompensiert. Mag einiges, wie zum Beispiel die Entführung des Vaters zu Thanksgiving aus dem Krankenhaus oder Chris‘ „Make-up-Aktion“ am Krankenbett des schlafenden Vaters, noch so überzogen anmuten, so zeigt Sharpe dennoch, dass er ein Herz für seine Figuren hat. Wirken gerade Chris und sein Kumpel Frank auch noch so bitterböse und beleidigend auf andere Menschen, so erkennt man doch stets ihren guten Kern. Sharpe schafft es, trotz der scheinbar eher oberflächlich angelegten Erzählung, trotz des Humors, der zwischen den Zeilen funkelt, ein überraschend tiefes Bild seiner Figuren zu skizzieren. Er entblättert auf so lockere und unterhaltsame Art ihr Innerstes, dass es ein wahrer Genuss ist.
Sharpe wechselt immer wieder die Perspektive, verfolgt mal Bernard oder Lila, meistens aber Cathy und Chris. Und so ist „Eine amerikanische Familie“ eben auch eine Geschichte über das Erwachsenwerden, über die ersten sexuellen Erfahrungen und über die Tücken der Pubertät. Besonders Chris macht mit der Zeit einen Reifungsprozess durch und ist die heimliche Hauptfigur in Sharpes Roman. Seine bösartige Ironie trägt er wie eine Art Schutzschild vor sich her und wenn jemand auf die gleiche Art kontert, wie er zuvor ausgeteilt hat, ist er verunsichert. Er wandelt etwas haltlos durch seinen Alltag und weckt hier und da Erinnerungen an Holden Caulfield in J.D. Salingers „Der Fänger im Roggen“.
Was an der Lektüre so erfrischend ist, ist Sharpes Stil. Voller Wortwitz, raffiniert erzählt, bissig und gespickt mit Pointen, ist „Eine amerikanische Familie“ ein Roman, der Spaß macht. Sharpes Stil ist eine Stil der schnellen Schnitte. Er braucht keine großen Worte, um in der Handlung von einer Figur zur nächsten überzuleiten. Die Wechsel vollziehen sich wie von selbst. Temporeich treibt er die Geschichte voran, von der der Leser vielleicht manches vorausahnen mag, es dann aber in Sharpes Worten präsentiert zu bekommen, macht diese Transparenz wieder wett.
Was in meinen Augen ein wenig hinkt, ist der Vergleich mit Jonathan Franzens [„Die Korrekturen“. 1233 Beiden gemein ist zwar eine genaue Beobachtungsgabe mit einem Blick für kleine unscheinbare Details und beide haben sicherlich einen Sinn für Humor der eher trockenen Sorte, dennoch ist Sharpes Werk irgendwie lauter und frecher. Wenn Jonathan Franzen Pop ist, dann ist Matthew Sharpe Rock.
Thronend über all dem steht Sharpes Sinn für Sarkasmus und Ironie. |“Egal, ob einem die Ironie entging oder nicht, der Ironie entging man auf keinen Fall.“| (S. 150) Das scheint nicht nur Chris‘ Einstellung widerzuspiegeln, sondern lässt sich auch auf Matthew Sharpes Art des Erzählens übertragen. Daraus ergibt sich ein unnachahmlich heiterer Erzählstil, der richtig Lust darauf macht, mehr von Sharpe zu lesen. Doch da wird der deutsche Leser sich wohl noch gedulden müssen, bis mehr von Sharpe auf dem deutschsprachigen Buchmarkt erscheint bzw. auf die amerikanischen Originalausgaben umsatteln müssen. Da gäbe es dann immerhin noch einen Band mit Kurzgeschichten („Stories from the Tube“, 1998) und den Roman „Nothing is Terrible“ (2000).
Bleibt unterm Strich der Eindruck eines wirklich lohnenswerten Buches für Freunde moderner und vor allem unterhaltsamer amerikanischer Literatur. Wer die Stimmung und die Art des Films „American Beauty“ mochte, der wird auch an Matthew Sharpes „Eine amerikanische Familie“ seine wahre Freude haben. Ein Buch, das gewitzt, schräg, herzerfrischend, herrlich ironisch und ganz nebenbei so feinfühlig und mit einem ausgeprägten Sinn für Melancholie daherkommt, dass man es mitsamt seiner Figuren einfach mögen muss. Für mich eines der bislang unterhaltsamsten Bücher dieses Jahres. Bitte mehr davon!