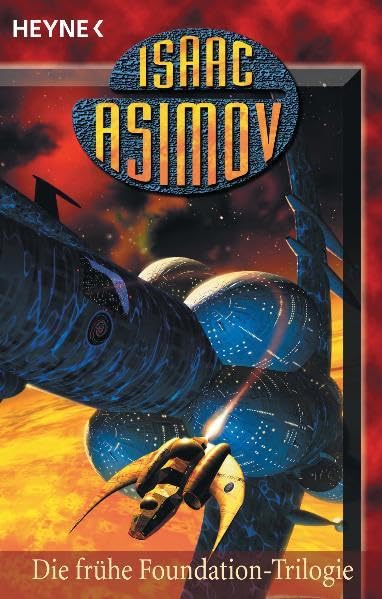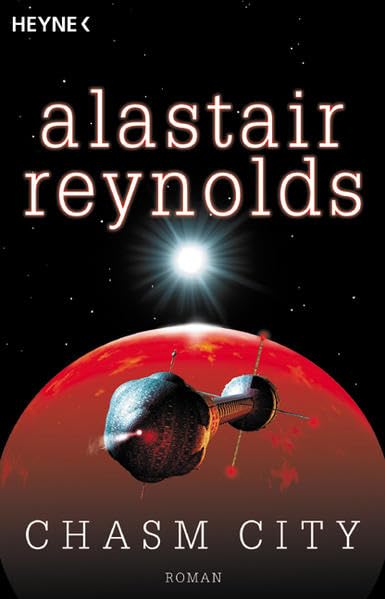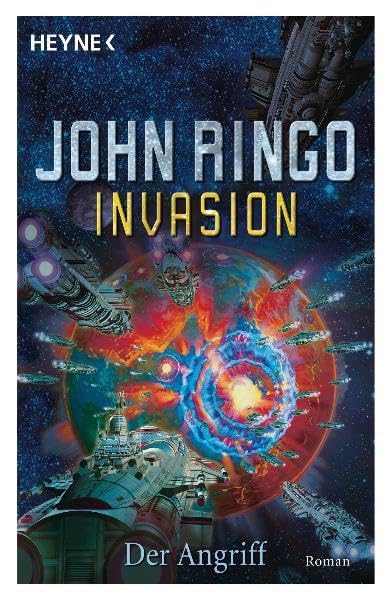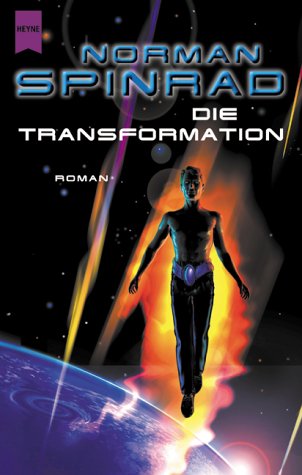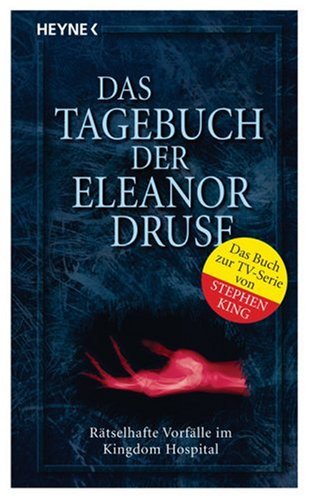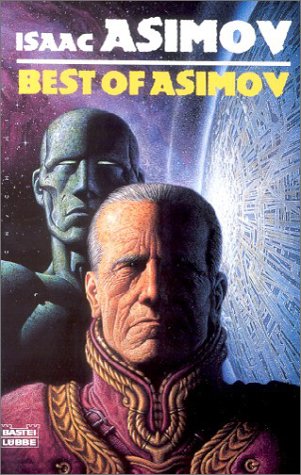_Mit seinem Fantasy-Roman „Das Paradies der Schwerter“ machte Tobias O. Meißner dieses Jahr allerorts Schlagzeilen. Nicht nur die Feuilletons von |FAZ| und |SÜDDEUTSCHE ZEITUNG| sind begeistert, auch aus der SF- und Rollenspiel-Szene kommen zahlreiche lobende Rezensionen. [ALIEN CONTACT]http://www.epilog.de/Magazin/ sprach mit ihm über seine Romane, seine Arbeitsweise und sein nächstes Buch._
_AC:_
Für viele Leser aus der Science-Fiction- und Fantasy-Szene bist du noch ein unbeschriebenes Blatt. Kannst du uns etwas über deinen Werdegang erzählen?
_Meißner:_
Ich wurde 1967 in der Weltstadt Oberndorf am Neckar geboren und bin im Alter von zwei Jahren mit meinen Eltern nach Berlin emigriert. Beruflich wurde ich vor allem von meinem Vater geprägt, der Journalist war. Mit 18 Jahren habe ich selbst angefangen als Journalist zu arbeiten. Danach habe ich Publizistik und Theaterwissenschaften studiert und abgeschlossen. In der Zeit habe ich auch mehrere Praktika gemacht, unter anderem für Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen. Dabei habe ich festgestellt, dass Journalismus doch nicht das Richtige für mich ist, weil ich es nicht so gut finde, wenn man innerhalb ganz kurzer Zeit Resultate erzielen muss, weil immer ein extremer Zeitdruck herrscht. Beim Schreiben von Belletristik arbeite ich zwar auch gern mit Deadlines, aber die sind dann schon etwas fürstlicher. Ich hatte bei den Zeitungen immer das Gefühl, dass man unglaublich viel verschenkt, wenn man sehr schnell schreiben muss.
In meiner Freizeit habe ich angefangen zu schreiben, bereits während der Schulzeit. 1990 habe ich mit drei Freunden einen kleinen Literaturklub gegründet, den wir »Deadline Project« nannten. Es ging darum, dass jeder in jedem Monat ein Kapitel einer Geschichte schreibt und es den anderen schickt. Jeder schrieb also einen Text und bekam drei. Nach einem halben Jahr gaben zwei von den vieren als Autoren auf, weil es nicht jedermanns Sache ist, jeden Monat pünktlich ein neues Kapitel liefern zu müssen. Aber die beiden blieben uns weiter als Leser treu, während Michael Scholz und ich als Autoren übrig blieben. Wir beide haben uns gegenseitig immer weiter angestachelt, weil keiner aufgeben wollte. Im Rahmen dieses »Deadline Projects« sind von 1990 bis 1996 meine ersten in sich geschlossenen Bücher entstanden: „Starfish Rules“, „HalbEngel“ und „Hiobs Spiel“, und Michael verfasste „Der Schreiber“, „Revolver“ und „Splitterkreis“. Dabei haben wir gar keine Kontakte zu Verlagen gesucht, das war nicht wichtig für uns. Erst als ich drei fertige Romane in der Schublade liegen hatte, dachte ich, dass es toll wäre, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nämlich den Spaß am Schreiben mit finanziellen Einkünften zu verbinden. Ich habe es zunächst mit „Starfish Rules“ versucht, und es klappte dann auch.
_AC:_
Zu welchen Verlagen hast du den Roman geschickt?
_Meißner:_
Das waren nur sechs oder sieben Verlage. Ich habe mich dabei an meiner eigenen Büchersammlung orientiert, um herauszufinden, welchen Verlagen ich meinen Text anvertrauen würde. Verblüffend früh hat sich |Rotbuch| in Hamburg für das Manuskript interessiert. Ich habe allerdings nicht das Manuskript versendet, weil ich befürchtete, dass es in einer Flut von unverlangt eingesandten Texten untergeht. Stattdessen habe ich eine Art Werbeseite designt, auf der die Schlagworte draufstanden sowie der Satz: »Bei Interesse fordern Sie das Manuskript an.« Rotbuch war der einzige Verlag, der auf diese Werbeseite reagierte und demzufolge auch der einzige, der das Manuskript bekommen hat. Allerdings hat es noch ein Jahr gedauert, bis sie sich durchgerungen hatten, einen völlig unbekannten Autor mit einem derart extravaganten Text zu publizieren. Sie hatten inzwischen drei Gutachten in Auftrag gegeben, die alle begeistert waren.
In diesem Jahr hatte ich an einem Drehbuch geschrieben und an weiteren »Deadline«-Projekten gearbeitet. Danach hatte ich Glück, weil der |Rowohlt|-Verlag die Taschenbuchrechte an „Starfish Rules“ gekauft hat, wovon ich ein weiteres Jahr leben konnte. Leider hatte das Taschenbuch ein entsetzliches Titelbild, das dem Verkauf nicht gerade förderlich war.
_AC:_
Lass uns über das neue Buch reden. „Das Paradies der Schwerter“ ist dein erster Fantasy-Roman …
_Meißner:_
Der erste veröffentlichte …
_AC:_
Wie meinst du das?
_Meißner:_
Ich habe mit Fantasy angefangen. Ich habe zwischen meinem 18. und 22. Lebensjahr ein Buch verfasst, das, wäre es fertig geworden, ungefähr 2000 Seiten umfasst hätte. Ich habe allerdings nach rund 400 Seiten aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass es einfach zu lange dauert, wenn ich für die ersten 400 Seiten schon vier Jahre gebraucht habe. Ich dachte mir, ich könnte noch weitere 16 Jahre an diesem einen Buch arbeiten – oder ich beginne lieber kleinere, überschaubarere Projekte. An „Starfish Rules“ habe ich allerdings auch vier Jahre gearbeitet. Jedenfalls habe ich mir damals mit den 400 Fantasy-Seiten einen guten Teil des Handwerks des belletristischen Schreibens selbst beigebracht.
_AC:_
Woher kam dein Interesse am Fantasy-Genre?
_Meißner:_
Eigentlich bin ich kein Fantasy-Fan oder –Kenner. Ich war in meiner Jugend von diesem eigenartigen Zeichentrick-Herr-der-Ringe-Film mehr beeindruckt als von Tolkiens Roman. Beim Lesen von Fantasy-Literatur hatte ich immer das Gefühl, dass mir etwas fehlt, dass irgendetwas nicht stimmt. Vieles war sehr gestelzt, klischeebeladen oder zu weit weg. Mir fehlte immer irgendetwas, das ich bei anderen Literaturformen gefunden habe. Ich hatte eine eigene Vision davon, wie ich Fantasy anders darstellen würde: den reinen Eskapismus weglassen, die Geschichte grobkörniger gestalten. So ähnlich wie das Verhältnis zwischen einem klassischen amerikanischen Edelwestern zu einem dreckigen Italowestern.
_AC:_
Michael Swanwick hat in einem aktuellen Interview gesagt, dass sich die meisten Fantasy-Autoren damit begnügen, die Staffage zu lernen – also Drachen, Elfen, Zwerge und so weiter – und dabei die Verankerung in der Realität vernachlässigen. Science-Fiction, auch schlechte Science-Fiction, hat diese Verankerung, weil sie eine, wenn auch manchmal minimale, Extrapolation unserer Welt ist. Momentan gibt es aber einen Trend, dass Fantasy realistischer und schmutziger wird. Ein Beispiel dafür ist China Miéville.
_Meißner:_
Ich habe irgendwann aufgehört Fantasy zu lesen, nachdem ich als Jugendlicher von der Ideenvielfalt der Romanheftserie „Mythor“ recht beeindruckt war. Aber ich kam mit dem Schreibstil nicht klar. Das Problem habe ich auch mit anderen Romanheften. Ich finde es schön, wie viele Ideen darin stecken, aber es ist leider so schlecht geschrieben. Da ich nicht weitergelesen habe, ist mir vielleicht auch einiges entgangen. Ich habe noch nie einen Jack Vance oder Fritz Leiber gelesen, Moorcock habe ich mir erst letztes Jahr mal angeschaut. Ich hatte immer den Eindruck, dass alle Fantasy daraus besteht, dass ein böser, dunkler Fürst das Land bedroht und kleinwüchsige Wesen oder Elfen oder Drachenreiter sich verbünden müssen, um diesen bösen Fürsten zu bekämpfen. Ich sah nirgendwo ein Gegenbeispiel. Ich dachte mir immer, dass es so nicht sein dürfte, denn das wäre ja so, als würde jeder klassische Abenteuerroman nur von Musketieren handeln. Aber ich bin wirklich kein Experte für Fantasy. Ich bin sozusagen aus Enttäuschung keiner geworden.
_AC:_
Was war der Anstoß für „Das Paradies der Schwerter“?
_Meißner:_
Da gab es mindestens vier Anstöße. Die brauchte ich auch, sonst hätte ich mich nicht daran gesetzt. Ich wusste von Anfang an, dass es drei Jahre dauern würde, das Buch zu schreiben – 36 Kapitel zu je einem Monat ergibt drei Jahre. Eine der Grundideen für „Paradies der Schwerter“ war, die Allwissenheit und Allmacht des Autors aus der Hand zu geben und eine Handlung zu entwickeln, die vom Zufall bestimmt werden kann, ohne dass das Handlungsgerüst aus dem Ruder läuft. Ich brauchte ein mathematisches Grundsystem, und dafür bot sich ein Turnier an. Ich wurde zum Reporter eines Geschehens, das ich selber nur in Gang gebracht habe, das dann aber aus kinetischer Energie selbst anfing zu rollen und immer schneller wurde. Das erklärt aber nicht, warum es ein Fantasy-Roman geworden ist.
Da ich mit Fantasy angefangen hatte zu schreiben, wollte ich irgendwann zu diesem Format zurückkehren, wenn sich die Gelegenheit bot. Die dritte Idee war, dass ich ein Buch mit vielen Protagonisten schreiben wollte, von denen man nicht weiß, welcher der wichtigste ist. Es sollten mindestens zehn sein – im Buch waren es dann sogar sechzehn –, die die Postmoderne in sich tragen; die auch aus Kulturkreisen stammen, die man eindeutig unserer Welt zuordnen kann und die in eine mittelalterliche Fantasy-Welt vielleicht gar nicht reinpassen. Die aus einem Italowestern, einem Samuraifilm oder einem Blaxploitation-Movie stammen könnten und die ich in dieses Buch hineinwerfen konnte, damit es ein phantastischer Schmelztiegel aus unterschiedlichen Storys und Beweggründen wird. Der vierte Ansatz war, dass ich mit sechzehn Protagonisten unterschiedliche Stilistiken und Blickpunkte anwenden konnte. Ich wollte die Geschichte nicht »von oben« betrachten, sondern für jede Perspektive eine eigene Deutungsweise schaffen. Es sollten Figuren sein, an denen man sich reiben kann.
_AC:_
Du sagtest, dass das Buch auf dem Zufall basiert. Wie ist das gemeint?
_Meißner:_
Ich habe die sechzehn Protagonisten entworfen, habe ihnen nach Rollenspielregeln bestimmte Körperwerte zugeordnet – also Geschicklichkeit, Attacke- und Paradefähigkeiten, Rüstungen – und habe die Kampfbegegnungen ausgewürfelt. Es war also nicht vorher festgelegt, wer gewinnt. Ich habe auch die Paarungen der Kämpfe nicht festgelegt, das ist sehr wichtig für das Buch. Ich habe sie stattdessen ausgelost und live, während ich die Lose aus dem Holztopf gezogen habe, geschildert, wer gegen wen antritt. _[Achtung: In den nächsten Sätzen werden einige Handlungswendungen verraten! Bitte erst „Das Paradies der Schwerter“ lesen!]_ Das ist fast noch wichtiger als die Kampfwerte, weil es bestimmte Konstellationen gibt, in denen zum Beispiel einer, der mit die besten Werte hat, der Degenfechter Cyril Brécard DeVlame, schon sehr großes Pech haben musste, gegen einen der beiden Gegner gelost zu werden, die eine dermaßen starke Rüstung tragen, dass er sie mit seinem Degen kaum verwunden kann. Genau das hat aber das Los entschieden. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit hätte DeVlame das ganze Turnier gewinnen können, das Los hat aber entschieden, dass er Pech hat und gleich in der ersten Runde ausscheidet. Ich war sehr begeistert darüber, wie die Lose mitgespielt haben, und dass sie mir auch einige zu klischeehafte Situationen erspart haben – zum Beispiel, dass die beiden Brüder gegeneinander antreten. _[Entwarnung!]_ Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass der Zufall ein besserer Autor ist als ich. Es war spannend, damit umzugehen und den Zufall ins Schreiben einzubinden. Oder auch Situationen umzubiegen, die zunächst sinnlos erscheinen. Die Sinnlosigkeit hat auch viel mit dem wirklichen Leben zu tun. Es endet eine Spannungskurve, die man aufgebaut hat, plötzlich ganz abrupt, wie im wirklichen Leben.
_AC:_
Gab es eine Situation, in der du versucht warst zu mogeln?
_Meißner:_
Glücklicherweise überhaupt nicht. Ich hätte auch auf keinen Fall gemogelt. Ich hatte auch meine Freunde aus dem |Deadline Project| als Kontrollinstanz, die auch alle Rollenspieler sind. Der Produktionsprozess war ganz offen, ich habe ihnen meine Würfeltabellen mitgegeben. Es gab ein paar Situationen, von denen ich gehofft habe, dass sie nicht passieren, hätte sie aber als Herausforderung an den Autor begriffen.
_AC:_
Die Kapitel des Buches, insbesondere die Kämpfe, sind unterschiedlich lang. Liegt es daran, dass du an einigen besonderen Spaß hattest?
_Meißner:_
Es hängt direkt mit dem Würfeln zusammen, dass einige Kämpfe schon sehr schnell vorbei waren. Andere Kämpfe zogen sich über mehrere Seiten als Würfel-Zahlentabellen hin, weil beide Kontrahenten jede Attacke des Gegners parierten. Dadurch wird das Kapitel automatisch sehr viel länger. Aber ich habe mir auch die Freiheit genommen, mich vom ganz konkreten Kampfgeschehen zu lösen. Bei der Auslosung habe ich gleichzeitig geschrieben, bei den Kämpfen habe ich nicht während des Würfelns geschrieben. Ich habe also nicht jede einzelne Attacke, die ausgewürfelt war, genau eins zu eins wiedergegeben, sondern habe mir den Kampf erst einmal ganz angeschaut und habe mir dann überlegt, was die Essenz des Kampfes ist. Oftmals habe ich dann auch bereits im ersten Satz der Schilderung eines Kampfes auf die Essenz hingearbeitet. Wenn ich weiß, wer am Ende stirbt, dann habe ich den Kenntnisstand, dass ich diese Figur tatsächlich zum letzten Mal beschreibe und ich hinterher nichts bedauern muss.
_AC:_
Du hättest aber hinterher noch etwas ändern können.
_Meißner:_
Das mache ich nie. Das habe ich beim |Deadline Project| gelernt. Dadurch, dass man an jedem Monatsende die Geschichte sozusagen |in progress| publiziert, also an die Freunde schickt, kann man nichts mehr ändern. Ich habe meine Freunde als Kontrollleser und bete, dass sie keine Fehler finden.
_AC:_
Dadurch setzt du dich als Autor aber auch sehr unter Stress.
_Meißner:_
Ich weiß nicht, wo mehr Stress liegt. Einer der vier Autoren im |Deadline Project| hat nach einem halben Jahr aufgehört zu schreiben, weil er immer wieder am ersten Kapitel Änderungen vorgenommen hat und irgendwann gar nicht mehr dazu kam weiterzuschreiben. Leider ist er uns als Schriftsteller dadurch verloren gegangen, obwohl er tolle Ideen hatte. Diesen Stress der nachträglichen Änderung habe ich mir nie gemacht. Ich schreibe ein Kapitel, und in den letzten Tagen eines Monats überarbeite ich es noch einmal richtig, und dann ist es halt fertig. Ich muss dann nicht noch einmal rückwärts durch das ganze Buch gehen.
_AC:_
Aber du arbeitest sehr konzentriert und in sehr kleinen Einheiten.
_Meißner:_
Ja, ich arbeite konzentriert. Das hängt damit zusammen.
_AC:_
Woher weißt du so viel über Waffen und Kampftechniken?
_Meißner:_
Vieles davon habe ich mir durch unterschiedliche Regelwerke der Fantasyrollenspiele in der Theorie angeeignet. Rollenspiele haben den schönen Aspekt, dass dort versucht wird, Traditionen oder bestimmte Bereiche des Daseins zu simulieren. Es gibt Experten, die dicke Bücher verfassen, wie man bestimmte japanische Waffen oder bestimmte Kampftechniken in Würfelergebnisse übersetzen kann. Diese Arbeit kann ich mir ersparen.
_AC:_
Hast du für das Buch speziell recherchiert?
_Meißner:_
Ja natürlich, ich habe mir aus vielen verschiedenen Quellen Inspirationen für meine Figuren geholt, habe aber auch vieles selbst entwickelt. Ich habe ein inzwischen veraltetes Regelwerk von |Das Schwarze Auge| als Grundsystem benutzt, allerdings dann modifiziert. Ich habe da eine gewisse Erfahrung, mir Regeln auszudenken, weil ich seit meinem sechzehnten Lebensjahr Spielleiter von Rollenspielkampagnen bin.
_AC:_
Du sagtest, dass das Buch in einer Art Mittelalter spielt.
_Meißner:_
Eher auf einer mittelalterlichen Entwicklungsstufe. Das kann natürlich auch zu einer postapokalyptischen Zeit sein, das habe ich gar nicht festgelegt. Es gibt viele Endzeitgeschichten, die in eine Art Mittelalter zurückfallen. Ich wollte für den Roman nicht festlegen, ob er in der Vergangenheit oder in der Zukunft spielt.
_AC:_
In einigen Rezensionen zu „Das Paradies der Schwerter“ wurde bemängelt, dass der Roman Anachronismen enthält. Die waren dann also Absicht?
_Meißner:_
Das sind keine Fehler, die mir unterlaufen sind, sondern eher Andeutungen, dass das Ganze auch in der Zukunft spielen könnte. Es gibt zum Beispiel den Begriff »an der Nadel hängen«, den man aus dem Mittelalter nicht kennt. Auch Wörter wie »Logistik« kommen vor. Ein solches Mittelalter, wie im Buch beschrieben, hat es ohnehin definitiv nie gegeben.
_AC:_
Welcher der Kämpfer war dein Favorit?
_Meißner:_
Einen Favoriten durfte ich nicht haben. Es wäre fatal gewesen, wenn ich einen gehabt hätte. Der Sinn des Spieles war, genau das zu vermeiden. Normalerweise, in anderen Büchern, habe ich immer einen Protagonisten, aber selbst da sind sie nicht immer meine Favoriten, zum Beispiel in „Starfish Rules“. Anders bei „Hiobs Spiel“; darin ist es offensichtlich, dass ich an Hiob klebe und jede seiner Bewegungen mit einer großen Faszination, manchmal auch mit Abscheu – aber das ist ja etwas Ähnliches – verfolge. Bei „Paradies der Schwerter“ wollte ich genau das nicht.
_AC:_
Auf der Impressumseite steht die Vorbemerkung: »|Paradies der Schwerter| ist der Roman, der in Tobias O. Meißners Neverwake-Zukunft unter dem Titel |Rakuen| veröffentlicht und berühmt wird (siehe Tobias O. Meißner |Neverwake|, Eichborn Berlin, 2001).«
_Meißner:_
Ja. Innerhalb der Neverwake-Chronologie wurde das Buch von einem Autor verfasst, dessen Akronym »Ein Robot.Messias« lautet. Wenn man die Buchstaben von »Ein Robot.Messias« umstellt, kommt dabei Tobias O. Meissner raus. Das muss man dann aber wirklich in „Neverwake“ nachlesen. Es ist nämlich so: Wenn man das Gesamtwerk verstehen will, muss man alles gelesen haben. Auch das unveröffentlichte …
_AC:_
War die Vorbemerkung nur ein Spaß, oder spielt sie für dich eine wichtige Rolle?
_Meißner:_
Es ist insofern wichtig, dass ich zuerst „Rakuen“ geschrieben habe. „Das Paradies der Schwerter“ hieß nämlich ursprünglich „Rakuen“, wurde dann aber aus vertriebstechnischen Gründen umbenannt, weil schon die Teilnehmer der Vertreterkonferenz des Verlages das Wort „Rakuen“ auf die absurdeste Art und Weise verdreht haben, so dass schnell klar wurde, dass im Buchhandel irgendetwas ganz anderes ankommt und es nie gelingen wird, dieses Buch jemandem zu vermitteln. Deswegen habe ich selber als Alternativvorschlag den Titel „Das Paradies der Schwerter“ eingebracht. Also, ich habe zuerst „Rakuen“ geschrieben, und danach erst „Neverwake“, auch wenn die Romane in anderer Reihenfolge erschienen sind. Ich konnte in Neverwake nur deshalb behaupten, dass es dieses Buch gibt, weil ich es schon geschrieben hatte. Daher also die Vorbemerkung.
_AC:_
Du hast so etwas wie einen Schutzengel, und der heißt Wolfgang Ferchl. Als |Rotbuch| „Starfish Rules“ gekauft hat, war er dort als Lektor beschäftigt und hat dich dann zum |Eichborn|-Verlag mitgenommen, wo er Programmchef war. Inzwischen ist er Verlagsleiter bei |Piper|. Welche Bücher sind in diesen drei Verlagen denn noch erschienen?
_Meißner:_
Beim |Rotbuch|-Verlag gab es „Starfish Rules“ und danach „HalbEngel“, ein Roman über Populärkultur und Rockmusik. Bei |Eichborn| hatte ich einen Vertrag über drei Projekte, zuerst „Todestag“, das ich damals noch gar nicht geschrieben hatte. „Todestag“ wollte ich sehr schnell schreiben, es durfte nur drei Monate dauern und hat sich direkt auf die Gegenwartspolitik bezogen. Das zweite Projekt bei |Eichborn| war „Neverwake“. Es sollte eigentlich eine Trilogie werden, aber daraus wird wohl nichts, weil es leider das kommerziell unverkäuflichste meiner Bücher geworden ist. Und zu meiner großen Überraschung war das dritte „Hiobs Spiel“. Keiner hat das Buch jemals verstanden, keiner mochte das Buch, aber Wolfgang Ferchl, mein »Schutzengel«, sagte, es gibt Projekte, die muss man als Verleger einfach bringen. Leider verkauften sich die drei Bücher nicht gar so gut. Wolfgang Hörner, der mich bei |Eichborn.Berlin| von Ferchl übernommen hatte, hat „Das Paradies der Schwerter“ gesehen, als es noch „Rakuen“ hieß. Er war davon überzeugt, und tatsächlich läuft es jetzt besser als alle meine anderen Bücher. Jetzt habe ich ein Angebot von |Piper|, und ich habe das Konzept für einen Fantasy-Zyklus aus meiner Schublade geholt, der zwölf Bände umfassen soll. Ich kann nur hoffen, dass |Piper| wirklich alle Bände bringen wird. Das hängt natürlich vom Erfolg ab.
_AC:_
„Hiobs Spiel“ und auch „Starfish Rules“ haben eine sehr extravagante Typographie. War das deine Idee?
_Meißner:_
Das ist nicht so einfach zu beantworten. In meinem Originalmanuskript ist so etwas schon angedeutet, mit unterschiedlichen Schrifttypen. Dass aber für jedes Kapitel eine eigene Kapitelüberschrift und jeweils eine andere Textgestaltung designt wurde, das hatte ich gar nicht zu träumen gewagt. Ich fand es aber toll. Und sie haben meinen Hinweis befolgt, dass jeder Handlungsstrang in „Starfish Rules“ immer die gleiche Schrifttype hat, was Struktur in das Chaos des Buches bringt. Bei „Hiobs Spiel“ sieht mein Manuskript relativ einfach aus, und ich finde es großartig, was der Designer daraus gemacht hat.
_AC:_
Hattest du Einfluss auf die endgültige Gestaltung?
_Meißner:_
Überhaupt nicht, ich habe nur die fertigen Druckfahnen bekommen, um sie abzusegnen.
_AC:_
„Hiobs Spiel“ ist zum Teil unglaublich brutal. Hat der Verlag darauf reagiert oder etwas verändern wollen?
_Meißner:_
Die Brutalität war nicht das Problem, sondern vielmehr die stilistischen Experimente, die ich in dem Buch gemacht habe; Sätze, die aus ihrem grammatischen Zusammenhang geschleudert wurden und vieles andere, das zunächst für mich ohne Beispiel war. Ich habe versucht, neuschöpferisch mit Sprache umzugehen und einen gewissen schamanistischen Ansatz zu finden. Wenn man ein Buch über Magie schreibt, dann sollte man auch versuchen, wie ein Schamane etwas Magisches in das Buch hineinzustecken. Und das geht bei einem Buch nun mal nur mit Sprache. Ich hatte also irrwitzige Sätze gebaut, die vom Lektorat hinterher herausgenommen wurden, weil sie angeblich unverständlich gewesen wären. Ich finde, dass der schamanistische Charakter des Buches unter dem Lektorat sehr gelitten hat. Andererseits kann man aber auch nicht deutlich genug betonen, dass |Eichborn| den Mut hatte, ein solches Buch überhaupt zu bringen.
_AC:_
Du sagtest, dass das Buch niemand verstanden hat. Ist es dir egal, dass es keiner versteht?
_Meißner:_
Ich glaube, dass ich selber nicht weiß, wie man es richtig verstehen sollte. Es besteht aus sehr vielen Einzelteilen, die viele Bedeutungen haben – zum einen für mich, aber auch historisch bedingt, wofür ich intensiv recherchiert habe. Die meisten Rezensionen wurden dem aber nicht gerecht. In „Starfish Rules“ habe ich ungefähr das Achtfache an Zeit investiert, das ich für meine Magisterarbeit an der Universität benötigt habe. Insofern wäre „Starfish Rules“ rein rechnerisch ein Buch, mit dem man sich acht Universitätsgrade holen könnte. Es steckt nichts Zufälliges drin, auch wenn es auf den allerersten Blick so aussehen mag.
_AC:_
Was ist dein Antrieb, dich jeden Tag an den Schreibtisch zu setzen und weiterzuarbeiten? Ist es der Spaß am Schreiben, oder eher, dass du etwas loswerden musst, das in dir lauert?
_Meißner:_
Der Hauptantrieb ist der Spaß und die Möglichkeit, Kreativität zu verarbeiten, ohne dass einem jemand reinredet. Das ist ganz anders als zum Beispiel beim Filmemachen, wo man auf viel zu viele Leute Rücksicht nehmen muss.
_AC:_
Obwohl du eigentlich schon immer Genreliteratur geschrieben hast – Science-Fiction, Fantasy, Horror – wurdest du vom Fandom nie wahrgenommen. Das ging allerdings auch anderen Autoren so, wie zum Beispiel Dietmar Dath oder Kai Meyer. Liegt das an deinem Anspruch, weil du »literarische« Bücher schreibst?
_Meißner:_
Das mag sein. Das Spannende für mich an meinem neuen Projekt für |Piper| ist, dass ich meine Stilistik sehr weit runterschraube und keine Sprachexperimente mehr mache. Ich möchte, dass das Buch ganz leicht zu lesen ist. Aber gleichzeitig versuche ich, eine extrem komplexe Geschichte aufzubauen, deren Komplexität man im ersten Band noch gar nicht unbedingt bemerkt. Aber ich habe ja das Gesamtprojekt im Kopf, ich weiß, was ich in den zwölf Bänden alles machen werde. Ich kenne bisher nichts Vergleichbares, sonst würde ich es nicht umsetzen wollen. Wenn ein anderer Fantasy-Autor so etwas schon gemacht hätte, würde ich dafür nicht zwölf Jahre meines Lebens opfern. Ich bin ja kein Masochist.
_AC:_
Fürchtest du dich nicht vor dem Berg an Arbeit? Oder dass du zwischendurch das Interesse an der Geschichte verlieren könntest?
_Meißner:_
Gar nicht. Die Herausforderung spornt mich eher an. Der Gedanke, einen so umfangreichen Zyklus zu schreiben, ist etwas Neues, das ich noch nie versucht habe.
_AC:_
Wobei du das Glück hast, dass du den Zyklus in einem Genre schreibst, in dem das möglich ist. Obwohl ich bei den meisten Zyklen nach dem ersten Band keine Lust mehr habe weiterzulesen.
_Meißner:_
Das geht mir genauso, denn ich habe das Gefühl, dass die meisten Fantasyautoren kein Gesamtkonzept haben, sondern einfach nur immer weiter schreiben und sich zu viel wiederholt.
_AC:_
Themawechsel. Welche Rolle spielen Realität und Virtualität für dich?
_Meißner:_
Realität ist ja auch immer virtuell. Ich glaube nicht, dass es eine einzige Wahrheit gibt. Deshalb ist es schwer, Realität zu fassen. Ich bin ein Verfechter der multiplen Perspektiven, und das merkt man meinen Büchern auch an. Es gibt immer sehr viele Figuren, die eine völlig unterschiedliche Sichtweise auf ein und dasselbe Geschehen haben.
Virtualität finde ich leichter zu beschreiben als Realität. Realität ist ein so unüberschaubarer Raum, dass man ihn nicht fassen kann, während man in der Virtualität ein Kontinuum schaffen kann, das vollständig begreifbar ist, weil man es nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten entwickelt hat. Das fasziniert mich auch immer wieder an Computerspielen, denn man kann ein Spiel quasi zu hundert Prozent durchqueren und lösen, was in der wirklichen Welt niemals möglich ist. Die Virtualität hält für einen Geschichtenerzähler immer Möglichkeiten bereit, irgendwo im hintersten Winkel etwas zu verbergen, das vom Leser aber trotzdem gefunden wird.
Ich habe früher sehr viele Computerspiele gespielt, und dann eine Pause von fast zehn Jahren gemacht, um mehr Zeit zum Schreiben zu haben. Seit es die PlayStations gibt, spiele ich wieder mehr, zum einen zur Entspannung, aber auch zum kreativen Input. Es ist manchmal eine Art Meditation, durch diese virtuellen Räume zu gleiten oder zu laufen. Oder auch Rennspiele zu spielen, in denen man irgendwann eine Geschwindigkeit erreicht, bei der man nicht mehr nachdenken darf, sondern intuitiv reagiert. All das fasziniert mich sehr. Irgendwann will ich ein Buch schreiben, das man nur noch intuitiv erfassen kann und gar nicht mehr über den Intellekt, aber dafür bin ich wahrscheinlich noch nicht gut genug.
_AC:_
Wir sind sehr gespannt auf deine nächsten Bücher. Vielen Dank für das Gespräch!
|Das Gespräch führten _Hardy Kettlitz_ und _Hannes Riffel_ am 5. Juli 2004 für das Magazin [ALIEN CONTACT.]http://www.epilog.de/Magazin/ Die Veröffentlichung bei |Buchwurm.info| erfolgt mit freundlicher Genehmigung der AC-Redaktion.|
_[Das Paradies der Schwerter]http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3821807237/powermetalde-21
von Tobias O. Meißner
|Eichborn.Berlin|
Februar 2004
gebundene Ausgabe
ISBN: 3821807237_