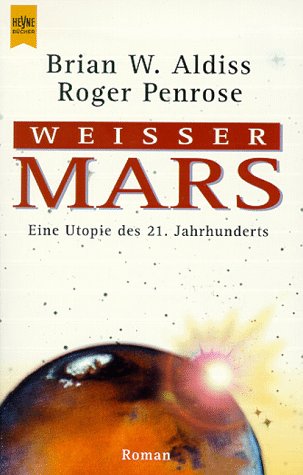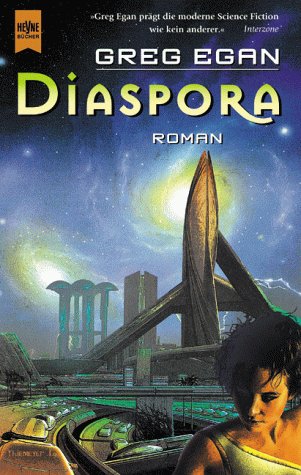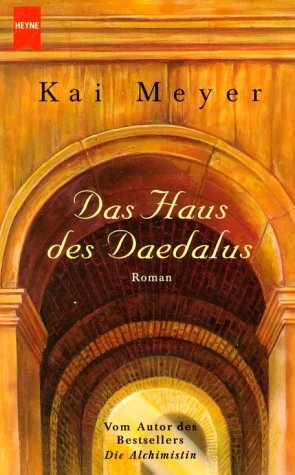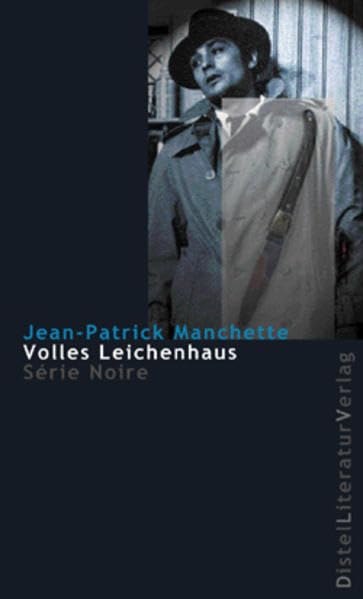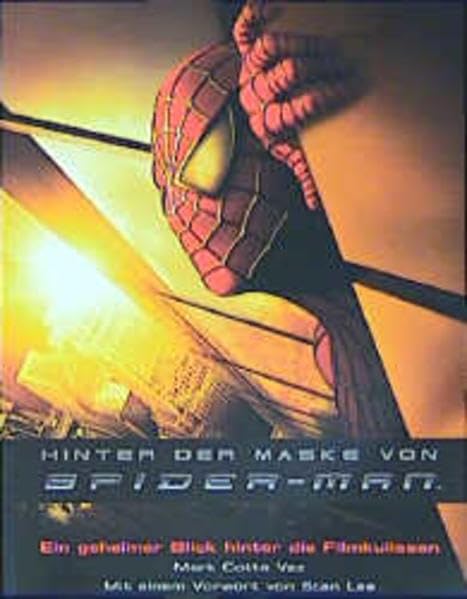|Der nachfolgende Artikel von _Winfried Wolf_ erschien zuerst am 15.07.2004 in der Tageszeitung [junge Welt]http://www.jungewelt.de/ und wird an dieser Stelle mit freundlicher Genehmigung der jW-Redaktion veröffentlicht. (Darstellung in alter Rechtschreibung)
Zuvor wird die Lektüre von Teil 1, [„Kein Europa der Bürger“,]http://www.buchwurm.info/artikel/anzeigen.php?id=16 empfohlen.|
Als Anfang der 1990er Jahre der geplante Zusammenschluß der Fluggesellschaften |KLM|, |SAS|, |Swissair| und |Austrian Airlines| scheiterte, wies das US-Wirtschaftsblatt |Business Week| auf eine bedeutende Schwäche der europäischen Wirtschaftswelt hin: |»Eine Restrukturierung der europäischen Industrie, die ohne Rücksicht auf nationalstaatliche europäische Grenzen erfolgte, wäre exakt der letzte, entscheidende Schritt hin zu Produktionseinheiten auf höherer Stufe. Es handelt sich jedoch um einen Schritt, den Europa offensichtlich nicht machen kann.«|
Tatsächlich gibt es knapp 50 Jahre nach der Bildung eines europäischen Wirtschaftsblocks kaum einen »europäischen« Konzern und – sieht man von Rüstung und Luftfahrt ab und berücksichtigt man die Übernahme von |Aventis| durch |Sanofi| – keinen bedeutenden deutsch-französischen Konzern. Versuche in dieser Richtung gab es – doch sie scheiterten. Genauer gesagt: Es setzte sich jeweils ein »Fusionsmodell« durch, bei dem die Flagge der Muttergesellschaft in der Regel national blieb. |NSU| wollte mit |Citroën| zusammengehen – tatsächlich verwandelte sich |NSU| in |Audi| und wurde |VW|-Tochter; |Citroën| wurde von |Peugeot| übernommen. |Hoesch| (BRD) und |Hogoovens| (Niederlande) gingen zu |»Estel«| zusammen – und scheiterten. Heute ist |Hoesch| Teil von |ThyssenKrupp|; |Hogoovens| wurde von |British Steel |übernommen. |Osram| sollte mit dem niederländischen Konzern |Philipps| zusammengehen; tatsächlich wurde |Osram| in |Siemens| eingegliedert; |Philipps| übernahm |Grundig|. |Renault| sollte mit |Volvo| mit »gleichberechtigtem Management« zusammengehen. Tatsächlich wurde |Volvo| in das |Ford|-Imperium eingefügt; |Renault| übernahm |Nissan|. |Beiersdorf| sollte zum französischen Unternehmen |Oréal| kommen; doch die deutsche Seite bestand darauf, daß die |Nivea|-Creme deutsch bleibt.
Als vor drei Monaten der deutsch-französische Pharmakonzern |Aventis| von dem französischen (und beim Umsatz halb so großen) Unternehmen |Sanofi| geschluckt wurde, äußerte der neue Boß Jean-Francois Dehecq den klassischen Satz, der in ähnlicher Form weltweit bei allen Fusionen zu hören ist: »Bei uns herrscht im neuen Vorstand Gleichberechtigung. Allerdings bin ich der Chef.«
Kurz: Unter den 200 größten Konzernen der Welt gibt es 76 US-amerikanische, 40 japanische und 68, die ihren Sitz in der Europäischen Union haben. Rechnet man die Schweiz hinzu, sind es sogar 74. Doch es handelt sich nicht um »europäische Konzerne«. Es sind auch nicht, wie in der NAFTA (|North American Free Trade Agreement|), Konzerne, die zu einem dominierenden Nationalstaat – in der NAFTA zu den USA – zählen. Vielmehr sind es 22 deutsche, 17 französische, zehn britische, sechs niederländische, sechs italienische, drei spanische und je ein schwedischer bzw. luxemburgischer Konzern. Hinzu kommen mit |Unilever| und |Royal Dutch Shell| zwei britisch-niederländische Unternehmen, deren »Binationalität« allerdings kein Ergebnis der EU, sondern über fast 100 Jahre gewachsen ist.
|Basis und Überbau|
Damit aber haben die EU-Strategen ein Problem. Ohne Basis kein Überbau. Will sagen: Ohne ökonomische Basis, ohne europäisches Kapital, kann sich der gesamte Überbau – EU-Kommission, EU-Verfassung, Europäische Zentralbank (EZB) bzw. Einheitswährung Euro – als an die Wand genagelter Pudding erweisen. Kommt es nicht zu einer Europäischen Union mit entweder europäischen Konzernen oder mit überwiegend Konzernen, die zu einem führenden Nationalstaat zählen, dann wird die EU immer von inneren nationalstaatlichen Spannungen gekennzeichnet sein und Gefahr laufen, in Krisenzeiten auseinanderzubrechen.
Dieses Problem war fast ein halbes Jahrhundert lang kein zentrales – solange sich die Weltmarktkonkurrenz nicht verschärfte. Seit der Wende 1989/90 leben wir jedoch in der neuen alten Welt des klassischen, ordinären Kapitalismus. Die Konkurrenz verschärft und die Krisenerscheinungen vertiefen sich; die Militarisierung ist allgemein. Die Blockbildung ist für die Konzerne und Banken in Europa die einzige Chance, in diesem Kampf zu bestehen bzw. die Konkurrenz der US-Unternehmen auf die Ränge zu verweisen.
In dieser Situation gibt es theoretisch drei Wege, wie die EU sich im kapitalistischen Sinn »weiter« entwickeln kann: Erstens, indem die Dominanz der deutschen Konzerne und Banken weiter ausgebaut wird. Zweitens, indem die »Achse Berlin–Paris« als alleinige, strategische angesehen wird und deutsche und französische Konzerne die ökonomische und politische Macht in der EU an sich reißen. Und drittens gibt es den Weg von Militarisierung und Krieg, die Schaffung eines Europas im Feuer von Kriegen.
Der erste Weg wird seit langem beschritten. Das Gewicht der deutschen Ökonomie innerhalb der EWG (EG bzw. EU) hat sich im ganzen letzten halben Jahrhundert, seit Gründung der EWG 1957, von Jahr zu Jahr verstärkt. Die EU-Osterweiterung ist ein weiterer großer Schritt in diese Richtung. Die deutschen Unternehmen konnten seit 1990 ihre Positionen in Mittel- und Osteuropa weit stärker aufbauen als dies den Großunternehmen aus anderen EU-Staaten gelang. Dabei gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen deutschen und österreichischen Unternehmen und Banken. Letztere agieren oft als deutsche Vorhut. Erstere können ohnehin davon ausgehen, daß es zu einem zweiten und »friedlichen Anschluß« kommt: Die österreichische Wirtschaft wird längst zu einem erheblichen Teil vom deutschen Kapital kontrolliert.
Doch dieser erste Weg gleicht einer Gratwanderung. Wenn es die deutschen Konzerne und Banken zu bunt treiben, wenn sie ihre reale Vormachtstellung zu brutal ausnutzen, werden sie »Rest-Europa« gegen sich aufbringen. Vor diesem Hintergrund war das Gerangel um das Abstimmungsprozedere in den EU-Institutionen wichtig. Vor allem Berlin drängte darauf, daß die Einigung über das Statut der Europäischen Gemeinschaft im Jahr 2000 (der sogenannte Kompromiß von Nizza) rückgängig gemacht und die Möglichkeit ausgebaut wurde, das deutsche Stimmengewicht im Verein mit wenigen Bündnispartnern zu Mehrheitsentscheidungen im deutschen Interesse zu führen. Durch die Abwahl der Regierung Aznar in Spanien und das Scheitern der Regierung Miller in Polen wurde in diesem Punkt auf der EU-Regierungskonferenz die deutsche Position weitgehend durchgesetzt.
|Spannungen|
Der zweite Weg, die deutsch-französische Zusammenarbeit, wird beim »Projekt Europa« ebenfalls seit fünf Jahrzehnten beschritten. Dabei gab es Höhen und Tiefen. Derzeit läuft die Achse Paris–Berlin wieder einmal nicht rund. Wer diese aktuellen deutsch-französischen Spannungen verstehen will, der sollte die Sätze zur Kenntnis nehmen, die am 23. September 1971 der französische Staatspräsident Georges Pompidou sprach: |»Im Aufbau Europas verfügt Deutschland über eine überlegene Wirtschaftsmacht – vor allem weil seine Industrieproduktion um fast die Hälfte größer ist als die unsere. Deshalb habe ich die Verdoppelung unserer Industriekapazitäten in den nächsten zehn Jahren als vorrangiges Ziel formuliert.«|
Diese Zielsetzung schlug nicht nur fehl. In den letzten drei Jahrzehnten hat sich der wirtschaftliche Abstand zwischen Deutschland und Frankreich und vor allem derjenige zwischen den deutschen und französischen Topkonzernen nochmals vergrößert. 1980 lag der addierte Anteil des deutschen und des französischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) am BIP der EG mit 41,1 Prozent ähnlich hoch wie im Jahr 2000 (40,2 Prozent). Dabei zählte die EG damals lediglich zwölf Mitgliedsländer; im Jahr 2000 waren es 15 Länder – Österreich, Finnland und Schweden waren hinzugekommen. Das »spezifische deutsch-französische Gewicht« konnte selbst in einer erheblich vergrößerten EG/EU gehalten werden.
Doch das jeweilige Gewicht der beiden Räder an der Achse Paris–Bonn/Berlin hatte sich deutlich verlagert. 1980 lagen die Anteile Frankreichs und Westdeutschlands am EG-BIP sehr nahe beieinander: Der deutsche Anteil machte 22,1 Prozent aus, der französische 19 Prozent. Im Jahr 2000 liegt der deutsche Anteil am EU-BIP bei 24 Prozent, der französische bei 16,5 Prozent. Das heißt: Die Tatsache, daß die Achse Paris-Bonn/Berlin innerhalb der erweiterten EU weiterhin dominiert, war in erster Linie dem gesteigerten Gewicht der deutschen Wirtschaft geschuldet. Das hat zweifellos auch mit dem seit 1990 vergrößerten Deutschland zu tun. Doch bei einem Blick auf den Welthandel stellt sich ein ähnliches Ergebnis ein. Der Anteil der französischen Wirtschaft an den Weltexporten lag 1980 bei knapp sechs Prozent und sank seither kontinuierlich – bis auf unter fünf Prozent 2003. Die deutschen Exporte erreichten 2003 den Rekordwert von 12 Prozent; Deutschland wurde wieder Exportweltmeister. Der Abstand zwischen den deutschen und den französischen Exporten vergrößert sich damit kontinuierlich. Beim Vergleich der industriellen Produktion blieb es im großen und ganzen bei dem Abstand, den Pompidou vor 33 Jahren festgestellt hatte: Der Output der deutschen Industrie liegt um knapp 50 Prozent über demjenigen der französischen.
In der aktuellen deutsch-französischen Debatte geht es um die Schaffung »europäischer Champions«. Doch macht man die Frage zum Maßstab, welche deutschen und französischen Konzerne unter den sogenannten Global Players vertreten sind, dann wird das Ergebnis in Paris als bitter empfunden. 2003 befanden sich unter den 20 größten europäischen Industriekonzernen sechs deutsche, jedoch nur drei französische. Dabei nehmen in der Regel die deutschen Topunternehmen in ihrer jeweiligen Branche die Spitzenposition ein. Im Fahrzeugbau liegen |DaimlerChrysler| und |VW| vor |Peugeot| und |Renault|. Im Kraftwerksbau hat |Siemens| einen mehr als dreimal größeren Umsatz als |Alstom|. In der Stahlbranche ist |ThyssenKrupp| stärker als |Arcelor|, wobei es sich bei dem letztgenannten »nur« um einen luxemburgischen Konzern mit starkem französischem Einfluß handelt. Ähnlich sieht es im Bereich der Banken und Versicherungen aus: Die |Deutsche Bank| liegt deutlich vor der Nummer eins in Frankreich, der |BNP Paribas|. Die |Allianz| liegt vor |Axa|.
Klammern wir die Rüstung aus, dann verbleiben nur drei industrielle Branchen, in denen ein französischer Champion vor der deutschen Konkurrenz liegt: im Ölgeschäft, wo |Total| (zuvor: |TotalFinaElf|) keine deutsche Konkurrenz kennt; in der Bahntechnik, in der |Alstom| vor allem mit den TGV-Hochgeschwindigkeitszügen und der Niederflur-Tram »Citadis« deutlich vor |Siemens| rangiert, während der Münchner Konzern wiederum mit dem Diesel-ICE und den Combino-Straßenbahnen veritable Einbrüche erlitt – und in der Pharmabranche, in der der jüngst fusionierte Konzern |Sanofi-Aventis| auf Platz drei der Weltrangliste landete – hinter dem US-Konzern |Pfizer| und dem britischen Unternehmen |GlaxoSmithKline| und weit vor der deutschen Konkurrenz (|Boehringer-Ingelheim|, |Bayer| und |Schering|).
Nicht zufällig geht es beim aktuellen deutsch-französischen Zoff um zwei dieser drei Bereiche. Nicht zufällig erhöht die deutsche Seite seit Mitte 2004 den Druck auf die französische Regierung, den |Alstom|-Konzern ganz oder weitgehend an |Siemens| auszuliefern.
|Krieg als »dritter Weg«|
Die einzigen Bereiche, in dem es eine funktionierende deutsch-französische Zusammenarbeit gibt, sind die Luftfahrt, die Raumfahrt und die Rüstung. Dies ist der dritte Weg, aus der EU eine in sich geschlossene Blockkonkurrenz zu den USA zu machen. Es ist auch der Weg, die »wirkliche Souveränität« der EU zu demonstrieren. Zu einem »richtigen« Staat gehörte immer die Funktion, »eigene« Kriege führen zu können – und sie dann auch zu führen. Die gegenwärtige Emanzipation Europas ist nichts anderes als die Kriegsbefähigung der EU.
Dabei handelt es sich bei Luftfahrt und Rüstung um Sektoren, die in erheblichem Maß von staatlichen Aufträgen und Subventionen bestimmt sind und teilweise direkt unter staatlicher Kontrolle betrieben werden. Wenn man so will, handelt es sich um »Industriepolitik pur« oder, in den Worten von Wirtschaftsminister Wolfgang Clement, um einen »wettbewerbspolitischen Sündenfall«. So waren denn auch Jacques Chirac und Gerhard Schröder wie zwei Taufpaten zugegen, als im Herbst 1999 der deutsch-französisch-spanische Rüstungszusammenschluß |EADS| gefeiert wurde.
Seit dem NATO-Krieg gegen Jugoslawien wurde das »Europa der Militarisierung« dynamisiert. Die EADS stellt den Kern eines großen militärisch-industriellen Komplexes dar. Indem EADS zu zwei Dritteln |Airbus| kontrolliert, gehen Rüstung und zivile Luftfahrt eine enge Symbiose ein – wie auch im Fall |Boeing| in den USA. Der einzige große europäische Rüstungskonzern, der bisher »außen vor« blieb, ist |BAe| (|British Aerospace Systems|). Dabei erhält |BAe| inzwischen mehr militärische Aufträge vom Pentagon als von europäischen Regierungen. Das hatte zweifellos die Partnerschaft, die Tony Blair mit George Bush im Irak einging, begünstigt. Die nächsten EU-weiten militärischen Zusammenschlüsse sind bereits in der Pipeline: Im Mai 2004 wurde der Zusammenschluß der deutschen Militärschiffbaukapazitäten (|HDW| in Kiel, |Deutsche Nordseewerke| in Emden und |Blohm & Voss| in Hamburg) beschlossen. Dieser Zusammenschluß zielt darauf ab, demnächst den deutsch-französischen Zusammenschluß aller Marinekapazitäten, eine »EADS zur See«, zu bilden. In Frankreich wären |Thales| und eine Sparte von |Alstom| Teil dieser Fusion im Kriegsschiffbau der EU. Weitere Zusammenschlüsse stehen zur Debatte – im Panzerbau und bei den Triebwerksherstellern (|MTU|/BRD, |Snecma|/Frankreich und |Fiat Avio|/Italien).
Vor diesem Hintergrund macht es Sinn, daß in dem Entwurf für die EU-Verfassung steht: »Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern«. Es macht Sinn, wenn in dieser Verfassung der neuen EU-Rüstungsagentur exekutive Rechte zur Durchsetzung dieser Aufrüstungsverpflichtung gegeben werden. Und es macht Sinn, wenn in dem Protokoll über die »ständige strukturierte Zusammenarbeit«, das auf der letzten EU-Regierungskonferenz gleichzeitig mit dem Entwurf der EU-Verfassung verabschiedet wurde, der Aufbau eines militärischen Kerneuropas festgelegt wird. Dort heißt es, daß dieses militärische Kerneuropa »bis 2007 über die Fähigkeit verfügen (muß) … innerhalb von fünf bis 30 Tagen Missionen … aufzunehmen«. Gemeint ist: Kriege zu führen.
Die beschriebenen »drei Wege«, um zu einem neuen EU-Staat zu gelangen, sind nur in der Theorie getrennt. In der Praxis werden alle drei Wege gleichzeitig beschritten. Das Erschreckende ist: Der Weg, der am ehesten »Erfolg« haben wird, ist der dritte, derjenige über Rüstung und Krieg. Dies war auch der Weg, der 1871 zum Deutschen Reich führte. Ähnlich der EWG/EG 1957 bis 1990 hatte vor 1871 die vorausgegangene lange Phase des Freihandels (»Norddeutscher Bund«) nicht zur Herausbildung eines deutschen Kapitals geführt. Erst der Überfall Napoléons III. auf Deutschland 1870 und der dann folgende preußische Feldzug gegen Frankreich führten in den Spiegelsaal von Versailles, in dem das Deutsche Reich ausgerufen wurde. Wobei schon im Gründungsakt neue Aufrüstung, Imperialismus und Weltkrieg angelegt waren.
|Lenin revisited|
In einer frühen Debatte zum Thema Globalisierung schrieb ein Verfechter der Globalisierungsthese, es habe sich ein »Ultraimperialismus« herausgebildet. Dabei sei »an die Stelle des Kampfes der nationalen Finanzkapitale untereinander die gemeinsame Ausbeutung der Welt durch das verbündete Finanzkapital« getreten. Demgegenüber stand eine zweite Position, die diese Art eines »neuen Kapitalismus« hinterfragte, auf die fortexistierende Konkurrenzsituation und auf die sich erneut abzeichnende offene Konfrontation mit den Sätzen verwies: |»Ultraimperialistische Bündnisse sind … in der kapitalistischen Gesellschaft notwendigerweise Atempausen zwischen Kriegen … Friedliche Bündnisse bereiten Kriege vor und wachsen ihrerseits aus Kriegen hervor, bedingen sich gegenseitig, erzeugen einen Wechsel der Formen friedlichen und nichtfriedlichen Kampfes auf ein und demselben Boden imperialistischer Zusammenhänge und Wechselbeziehungen der Weltwirtschaft und der Weltpolitik.«|
Diese Debatte fand ziemlich genau vor neunzig Jahren statt. Das erste Zitat stammt von Karl Kautsky, das zweite von Wladimir Iljitsch Lenin. Der letztere sollte auf erschreckende Weise recht behalten. Den scheinbaren »Ultraimperialismus« mit seinem »verbündeten Finanzkapital«, das die »gemeinsame Ausbeutung der Welt« organisiert, gab es nicht. Ansätze, die man dafür halten konnte, lösten sich bald auf zugunsten einer verschärften Konkurrenz und von Aufrüstung, mündend in den Weltkrieg.
Die »zivilen« Tendenzen, die heute von einigen dem Projekt EU zugeschrieben werden, und die dann besonders zivil aussehen, wenn sie als Kontrast zu dem »aggressiven US-Imperialismus« dargestellt werden, gibt es nicht. Vor allem begab sich die EU längst auf den Weg, eben diese Phase verschärfter Konkurrenz, Aufrüstung und Orientierung auf Kriege einzuleiten.
Die Kräfte, die dieses Europa der Militarisierung betreiben, sind oft weit geschichtsbewußter als die Linke. Sie demonstrieren gelegentlich offen, daß sie die »friedliche« Durchdringung Europas in einem engen Zusammenhang mit den zwei militärischen Versuchen der deutschen Konzerne und Banken sehen, ein Europa unter deutscher Hegemonie zu errichten.
Der |VW|-Konzern ließ am 15. März 1999 in den großen tschechischen Tageszeitungen ein ganzseitiges Inserat unter der Kopfzeile »Die große Frühjahrsoffensive« schalten. Er warb dabei für |VW| und für die |VW|-Tochter |Škoda|. Viele Tschechen wurden dabei an die große Frühjahrsoffensive erinnert, die auf den Tag genau fünfzig Jahre zuvor begonnen hatte, als deutsche Truppen am 15. März 1939 das sogenannte Protektorat Böhmen und Mähren errichteten. Die graphische Gestaltung der Anzeige wies im Zentrum eine alte Militärkarte auf.
_Winfried Wolf_
|Dieser Artikel wurde mit freundlicher Unterstützung und Genehmigung der Tageszeitung [junge Welt]http://www.jungewelt.de/ veröffentlicht.|