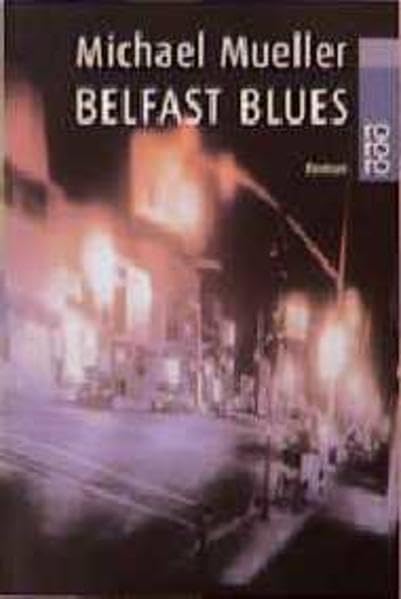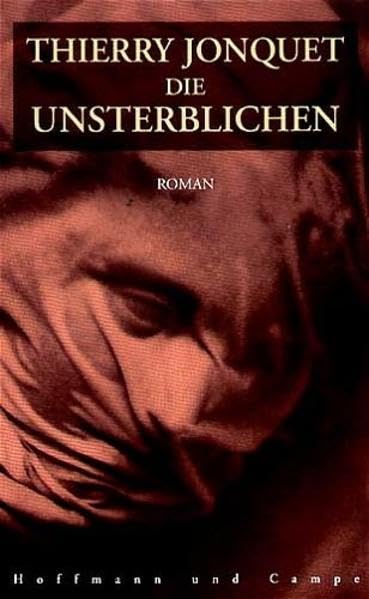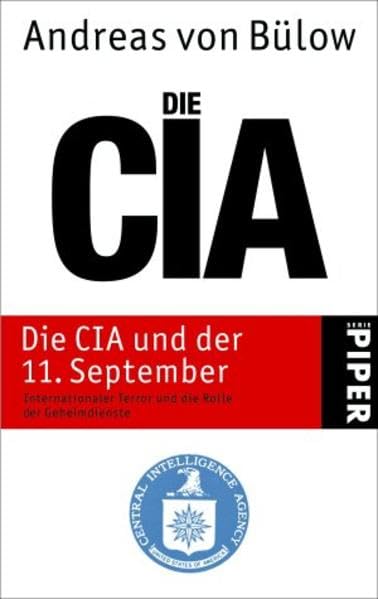Wir schreiben das Jahr 1999. Offiziell herrscht Waffenstillstand zwischen den verfeindeten katholischen und protestantischen Bürgerkriegsparteien in Nordirland, als ein schwerer Bombenanschlag auf den britischen Premier die zarten Bande des Friedens erschüttert. Jonathan, der in Belfast aufwuchs und nach einer Karriere bei der |Royal Ulster Constabulary| im britischen Sicherheitsdienst arbeitet, wird mit den Ermittlungen vor Ort beauftragt. Für ihn wird es ein Trip in die eigene Vergangenheit und die alte Heimat Belfast.
Er trifft seine Exfreundin Katie wieder, die er vor Jahren wegen seiner Karriere bei der Polizei verlassen hat und die immer der Meinung war, es wäre besser sich aus den „Troubles“ rauszuhalten. Er denkt an Raymond, seinen alten Freund aus Kindertagen, mit dem er zusammen etwas gegen Terror und Krieg unternehmen wollte und darum mit ihm zur Polizei ging. Und er erinnert sich an ihren früheren katholischen Freund Sean, der sich immer raushalten wollte und dann bei einem Anschlag auf einen protestantischen Pub durch eine katholische Granate ein Bein verlor.
Im Wirrwarr dieser Erinnerungen versucht Jonathan zusammen mit seinem Partner James, die Urheber des Anschlags zu finden. Doch er rennt gegen eine Mauer des Schweigens. Mehr und mehr bekommt er den Eindruck, für die Geheimdienstbosse in London nur den Sündenbock abgeben zu sollen, dem man bei ausbleibendem Fahndungserfolg die Schuld in die Schuhe schieben kann.
Doch in einer Ecke, in der er nicht mit Unterstützung rechnen kann, haben einige Leute plötzlich ein gesteigertes Interesse daran, dass Jonathans Ermittlungen erfolgreich sind. Aber welche Rolle spielt sein alter Freund Raymond, der vor Jahren den Dienst quittierte, eigentlich bei der ganzen Sache? Interessiert er sich wirklich nur noch so wenig für die „Troubles“, wie er Jonathan glauben lassen möchte?
„Belfast Blues“ ist grob betrachtet ein solider Agententhriller, der etwas abseits der gängigen Genreklischees angesiedelt ist. Einerseits spielt er vor dem Hintergrund des Nordirlandkonflikts, andererseits aber zumindest teilweise auch im Dunstkreis von ehemaliger Stasi und NVA im Deutschland nach der Wende.
Mueller greift einen recht interessanten Aspekt auf, der sicherlich auch auf andere Konflikte als den Nordirlandkonflikt übertragbar ist. Er zeigt, dass es trotz aller Friedensbemühungen immer noch Interessensgruppen gibt, denen ein Fortdauern des Krieges lieber ist, damit sie ihre liebgewonnene Macht nicht verlieren. Dies trifft beispielsweise auf die IRA zu, die in vielen Wohnvierteln oft mehr zu sagen hatte als die britischen Besatzer. Doch nicht nur im terroristischen Spektrum, auch in der Politik gibt es einige, denen der Sinn ganz und gar nicht nach Frieden steht, und um diesen Konflikt dreht sich vieles bei „Belfast Blues“.
Anfangs entwickeln sich Jonathans Ermittlungen sehr schleppend. Niemand scheint sich zu dem Attentat bekennen zu wollen und so kommt der Fall nur ziemlich schwer in Gang. Nachdem Mueller mit der Schilderung des Attentats die Bombe im wahrsten Sinne des Wortes gleich zu Beginn zündet, passiert erst einmal nicht mehr viel und so nutzt er das Papier für lange Rückblenden in Jonathans und Raymonds Vergangenheit.
Mueller schildert alles sehr genau, sowohl das Leben in den protestantischen und katholischen Wohnvierteln als auch den Verlauf der Ermittlungen. Das Buch macht dabei einen durch und durch gut recherchierten Eindruck, sowohl mit Blick auf die politischen Hintergründe als auch auf Ballistik und Geheimdienstarbeit. Mueller scheint also durchaus gut informiert zu sein. Ein Eindruck, der sich auch beim Blick auf seine Biographie bestätigt, denn er war schon als freier Fernsehautor und Reporter in Nordirland tätig und hat 1992 ein Buch zum Thema RAF/Stasi herausgebracht.
„Belfast Blues“ kommt zwar zu Beginn nicht so wahnsinnig schnell auf Touren, aber man muss Mueller lassen, dass er ein sehr ausgefeiltes Komplott inszeniert, das sowohl Jonathan als auch dem Leser erst ganz langsam Seite für Seite bewusst wird. Der Leser ist dabei zwar oft einen kleinen Schritt voraus, dennoch kann man sich teilweise noch keinen Reim auf die Indizien machen, die Mueller dem Leser unterjubelt. Und das ist durchaus eine der Qualitäten des Romans. Scheinen die Ermittlungen zunächst noch im Sande zu verlaufen und Jonathan mehrmals kurz davor zu stehen, die Nachforschungen aufzugeben, so gewinnt die Handlung mit der Zeit immer mehr an Fahrt und entwickelt gegen Ende ein geradezu erschreckendes Tempo. Die Geschichte rast unaufhaltsam einem düsteren Ende entgegen und man wird als Leser völlig gefangen genommen. Ganz am Ende bedient Mueller sich dann auch noch eines feinen Kniffs. Er blendet mitten im Showdown aus und erzählt das Ende der Geschichte aus der Rückblende. Eine Inszenierung, die ich ziemlich gelungen und spannungssteigernd fand.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt bei „Belfast Blues“ nicht nur auf der Thrillerhandlung, sondern ganz besonders auch auf der Biographie der beiden Jugendfreunde Jonathan und Raymond. Immer wieder wechselt Mueller die Perspektive, erzählt mal Gegenwärtiges, mal Vergangenes, mal aus der Sicht von Jonathan, mal aus der von Raymond und hin und wieder auch aus der Perspektive ihres gemeinsamen Freundes Sean. Dadurch wird die Geschichte nicht nur spannender, sondern auch facettenreicher und tiefgründiger.
Die Rückblenden wirken dagegen hier und dort ein wenig lang. Wenn beispielsweise Seans Geschichte erzählt wird und Mueller sich seitenlang über seine Erlebnisse nach dem Anschlag, bei dem er sein Bein verlor, auslässt, vergisst man ein wenig, dass man eigentlich einen Thriller liest, bei dem es im Grunde um eine ganz andere Sache geht. Sicherlich will der Autor mit diesen Rückblenden zeigen, wie sehr die Biographien der Protagonisten ihre Handlungsweise in der Gegenwart bestimmen und das ist ein durchaus wichtiger Aspekt, dennoch hätte ich an seiner Stelle die Rückblenden entweder mehr gesplittet oder gestrafft, denn so tragen sie den Leser oft weit von der eigentlichen Geschichte fort.
Was dagegen absolut überzeugen kann, ist die Zeichnung der Charaktere. Dadurch, dass man die Lebensgeschichten der wichtigsten Figuren relativ genau kennen lernt, kann man ihre Motivation und ihr Verhalten verstehen. Man merkt, dass Mueller dieser Aspekt sehr wichtig ist. Er zeigt, was der alltägliche Terror, so wie ihn die Nordiren seit den frühen Siebzigern tagtäglich erlebt haben, aus den Menschen macht. Wie zwei Jungen schon früh das hässliche Gesicht des Bürgerkrieges kennen lernen, einen Beitrag zu seinem Ende leisten wollen und ihn dann doch nur weiterführen, weil auch sie dieser Spirale der Gewalt ohnmächtig gegenüberstehen. Auf welche unterschiedliche Art und Weise beide daraufhin resignieren, ist ein weiterer Aspekt des Buches.
Was dabei hilft, die 523 Seiten des Romans relativ schnell hinter sich zu lassen, ist Muellers Schreibstil. Oft wirkt seine Sprache etwas schnörkellos, aber nicht emotionslos. Viele Sätze fallen eher kurz und knapp aus, aber Mueller wählt klare Worte und schafft es bei aller sprachlichen Schlichtheit auch immer wieder etwas Tiefgang in die Geschichte zu bringen. Das Buch liest sich sehr gut, ohne sich in kühler Oberflächlichkeit zu verlieren.
Mueller hat mit „Belfast Blues“ einen durchaus packenden Thriller abgeliefert, der vor allem zum Ende hin ein geradezu rasantes Tempo entwickelt und den Leser ein Stück weit nachdenklich stimmt. Wen neben einem politischen Thriller auch noch die Facetten des Nordirlandkonflikts interessieren, der findet hier auf jeden Fall spannenden Lesestoff.