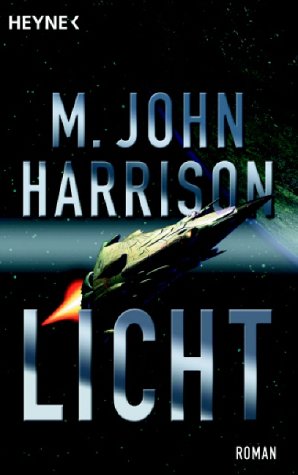
1999: Radioastronomen entdecken eine Zone in unserer Milchstraße, in der alle bekannten Regeln der Physik ihre Gültigkeit verlieren und in der sich die Realität geradezu aufzulösen scheint.
400 Jahre später: Man hat entdeckt, dass es in dieser Zone von Artefakten nicht-menschlicher Kulturen nur so wimmelt. Hier macht eine junge Raumfahrerin am Rande dieser Zone, dem „Strand“, eine Entdeckung, die weit in die Vergangenheit weist, ins Jahr 1999 …
Mit „Licht“ legt der englische Starautor M. John Harrison den ersten definitiven Science-Fiction-Roman des 21. Jahrhunderts vor: Eine atemberaubende Achterbahnfahrt durch Zeit und Raum, ein Buch, so voller Energie und Einfälle, dass man nur staunen kann. Wofür andere Autoren mehrbändige Zyklen benötigen und George Lucas sechs Filme – dafür genügt Harrison dieser eine Roman! (Verlagsinfo, modifiziert)
Der Autor
Der 1945 geborene Engländer M(ichael) John Harrison lebt und arbeitet in London. Wenn er nicht gerade eine Felswand erklimmt. Der begeisterte Bergsteiger begann 1968 seine ersten Storys zu veröffentlichen, und zwar gleich in dem Avantgarde-Science-Fiction-Blatt „New Worlds“, das unter der Herausgeberschaft Michael Moorcocks nicht nur die Szene kräftig aufmischte, sondern auch die Sittenwächter in Harnisch brachte. Bei diesem Magazin arbeitete er auch als Redakteur bzw. Buchlektor und durfte sogar Moorcocks Serienhelden Jerry Cornelius als Vorlage für eigene Storys verwenden. Kritiken schrieb er unter dem Pseudonym „Joyce Churchill“.
Sein erster Roman „The Committed Men“ (1971) spielt in einem Post-Holocaust-Szenario und erinnert schwer an J. G. Ballards Katastrophenromane wie etwa „Highrise“ (Der Block, 1970), in dem die Zivilisation in die Barbarei zurückgefallen ist. Sein dritter Roman „The Centauri Device“ (1973), eine Space-Opera, verrät Harrisons Misstrauen gegen die eskapistischen Tendenzen der Science-Fiction-Form: Besagtes Alien-Gerät zerstört die gesamte Galaxis.
Harrisons bis dato zentrales Werk ist die „Viriconium“-Sequenz, für die er, könnte man sagen, zwanzig Jahre brauchte: „The Pastel City“ erschien 1971 und schilderte eine typische sterbende Erde à la Jack Vance und H. G. Wells, in der das Ende der Zeit in der gleichnamigen Stadt heraufdämmert, beobachtet nur durch die Insektenaugen von Alien-Invasoren. Obwohl das Setting das der |Sword and Sorcery Fantasy| ist, passiert überhaupt nichts Magisches.
Der zweite Roman trägt den Titel „A Storm of Wings“ (1980), der dritte hieß zunächst „In Viriconium“ (1982), später „The Floating Gods“. Der 1983 in „Interzone“ veröffentlichte Text „The Luck in the head“ wurde 1991 mit Ian Miller zu einer Graphic Novel umgearbeitet.
Harrisons zentrale Aussage, wie der Kritiker und Autor John Clute sie herausgearbeitet hat, lautet: „Jede persönliche Flucht aus der Welt muss verdient werden, indem man sich um eben diese Welt kümmert, denn nur wenn man sein Selbst, die Stadt und die zu erklimmende Felswand genau betrachtet und sich/sie in allen Einzelheiten wahrnimmt, erkennt man, was man zu verlassen wünscht.“ Nur die Schärfe und Kälte des wahrnehmenden Blicks variiert bei Harrison, nicht aber das Anliegen, die Welt zu erkennen.
Und weil dies alles so furchtbar ernst ist, kommen bei Harrison immer wieder Katzen vor, und nicht zu knapp. So auch in seinem neuesten Roman „Licht“.
Handlung
Das Jahr 1999
Der Geschichte verläuft auf zwei Zeitebenen. Im Jahr 1999 arbeiten zwei englische Quantenphysiker namens Brian Tate und Michael Kearney an einem neuen Quantenrechner. Beide experimentieren dabei mit Katzen – genau wie es einst der Quantenphysiker Schrödinger in seinem Gedankenspiel tat. Gleich im ersten Kapitel erfahren wir, dass Michael Kearney furchtbar von seinem Leben als Mann, der mit einer Magersüchtigen verheiratet war, angeödet ist und sich etwas Nervenkitzel als Frauenmörder verschafft.
Kearney ist aber auch ein Gehetzter: Er hat Visionen von einem in einem Würfel eingesperrten Dämon, den er „den Shrander“ nennt. Und dieser gibt ihm Befehle, die sich für so manchen am Forschungsprojekt Beteiligten als tödlich erweisen. Besonders dann, als man Kearney das Projekt wegnimmt …
Wie auch immer man zu Mord steht, so führt doch die Arbeit von Tate & Kearney zu einem relativ positiven Ergebnis: dem Grundstein für die interstellare Raumfahrt. Das ist ja auch was wert. Zu etwa der gleichen Zeit entdecken Radioastronomen den geheimnisvollen Kefahuchi-Trakt, eine Zone in unserer Milchstraße, in der die bekannten Gesetze der Einstein’schen und Newton’schen Physik keine Anwendung mehr finden. Fazit: eine interessante Gegend, die man sich mal anschauen sollte.
Das Jahr 2400
Der Kefahuchi-Trakt ist aber im Jahre 2400 nicht nur interessant, sondern auch tödlich. Die Menschheit hat ihre Nase in den Weltraum hinausgesteckt und ist dort im Randgebiet des Traktes, am sogenannten „Strand“, auf etliche seltsame Artefakte gestoßen. Diese stammen von diversen Alienrassen, die hier ein Sonnensystem verschoben haben und dort ein Planetchen. Die Artefakte sind – ähnlich wie in Hamiltons „Armageddon“-Zyklus und Reynolds‘ [„Unendlichkeit“ 503 – Ziele von Prospektoren und anderen Glücksrittern.
Allerdings haben sie nicht mit K-Käpten Seria Maú Genlicher gerechnet, die ihnen mit ihrem hypermodernen K-Schiff „White Cat“ nachstellt und sie reihenweise vernichtet, ohne auch nur den Überlebenden die Hand zur Rettung zu reichen. Irgendwie scheint K-Käpten Maú ein Problem mit den Menschen zu haben. Auch ihre Kunden, die Nastischen Aliens, finden Maús Verhalten leicht degoutant. Dabei führen sie doch selber ein halbes Hundert Kriege im Weltraum.
Eines Tages stößt Seria Maú auf die Spur eines Geheimnisses. Sie fliegt zum künstlichen Planeten Redline und unterhält sich dort mit einem gewissen Billy Anker. Während er sie ausfragt und sie ihn interviewt, tauchen Kriegsschiffe der menschlichen Flotte der EMC („Earth Military Contracts“) auf und bombardieren ihr trautes Stelldichein. Gegen die zahlreichen Einwände ihres Schiffes nimmt Seria Maú Billy Anker an Bord und rettet ihn aus der Gefahrenzone. Doch hinter wem war die EMC her? Billy weiß um ein Geheimnis in einem Wurmloch des Kefahuchi-Trakts: eine Goldmine der Aliens …
Ed Chianese, Jahr 2400
„Chinese Ed“ ist ein viel netterer Zeitgenosse. Er existiert zwar – wie Neo in der „Matrix“ – nur in einem Virtualitätstank, aber dafür in einer Zeit, in der wir uns zurechtfinden: den vierziger Jahren der USA, mitten im Film-noir-Land eines Philip Marlowe und Sam Spade. Kein Wunder, dass Chinese Ed ebenfalls ein Schnüffler ist, der aber doch ab und zu auch mal ans Vögeln denkt – und damit ist er bei der feschen Rita Robinson genau an der richtigen Adresse. Es gibt nur ein kleines Problem: Wie kommt die riesige gelbe Ente in seine Lieblingskneipe?
Jemand hat sich wohl eingeschaltet und den Salon mit den Virtualitätstanks gestürmt. Dagegen hat Ed Chianese etwas, der sich gern als „Chinese Ed“ einklinkt. Er ist ein Twink, und Twinks sind süchtig nach den Erlebnissen, die sie in den Tanks haben können. Leider kommt es im Laufe der Auseinandersetzungen mit den Gangstern, die den Tank-Salon stürmten, zu einem bedauerlichen Zwischenfall: Ed erschießt eine der Gangsterladys.
Klar, dass nun seines Bleibens nicht mehr länger in der WG sein kann und er sich vom Acker machen muss. Gar nicht so einfach in New Venusport, einer recht abgeschlossenen Weltraumkolonie. Doch er schließt die Freundschaft eines Rikscha-Girls mit dem schönen Namen Annie Glyph (ein Witz: Das bedeutet „jedes beliebige Schriftzeichen“). Mal abgesehen davon, dass der Sex mit der stämmigen, hochgezüchteten Läuferin Annie fantastisch ist, so braucht sie doch eine Menge Speed namens |Café electrique|, und das ist nicht billig.
Auf seiner Suche nach einer Einnahmequelle stößt er auf „Sandra Shens Observatorium und die Original-Karma-Pflanze: der Zirkus von Pathet Lao“. (Pathet Lao klingt irgendwie kambodschanisch oder wie Thai.) Zum Zirkus, der auch ein Museum à la Madame Tussaud’s enthält, gehört ein Historienbild mit dem Titel: „Brian Tate & Michael Kearney blicken auf einen Computermonitor 1999“. Hier wird er Wahrsager im Auftrag der geheimnisvollen und keineswegs besonders real-menschlichen Sandra Shen. Beim Wahrsagen steckt er den Kopf in eine seltsame Flüssigkeit, die sein Bewusstsein verändert: das Gesicht im Aquarium.
Was die Flüssigkeit ist, verschweigt ihm Sandra Shen ebenfalls. Und er weiß auch nicht, was er während seiner Visionen als Orakel äußert. Feststeht, dass das Publikum zunehmend begeistert ist, wie positiv sich seine vorhergesehene Zukunft entwickelt. Und zweitens, dass er selbst zunehmend intensivere Einblicke – Erinnerungen? – in seine eigene Jugend gewährt bekommt, als er noch eine Schwester namens Alice und einen Vater hatte, aber keine Mutter, denn die war schon tot. Die Familie lebte auf dem Lande, nahe einem Weltraumbahnhof, und eines Tages wollte seine Schwester eine Astronautin werden, woraufhin er davonlief …
Mein Eindruck
Der Autor erzählt die Geschichte einer Familie, und diese Geschichte erstreckt sich über vier Jahrhunderte. Alle vier Familienmitglieder – Vater, Mutter, Sohn und Tochter – entwickeln sich in überraschender Weise weiter, so dass man sie nach 400 Jahren kaum als solche wiedererkennt. Das bildet natürlich für den unvorbereiteten Leser ein ziemliches Rätsel, denn diese Geschichte wird rückwärts erzählt, während sich die Figuren vorwärts entwickeln … Und so manche Kritiker sind nie dahintergekommen, wie die drei Erzählebenen miteinander zusammenhängen. Sie machten es sich einfach und erklärten den Autor für bekloppt. Basta. Auch ein Weg, sich aus der Affäre zu ziehen.
Ein Roman, den man verbieten muss?
Doch wie meine Autorenbeschreibung oben hoffentlich deutlich gemacht hat, ist Harrison ein alter Haudegen der britischen Science-Fiction und mit allen literarischen Wassern gewaschen. Deshalb begegnen ihm die auf dem Umschlag genannten Autoren Iain M. Banks und Stephen Baxter mit größtem Respekt. Harrison und Moorcock, Ballard und ein paar andere Autoren setzen die britische Science-Fiction auf die literarische Landkarte.
Sie wandten die neu entwickelten Erzählregeln der modernen Literatur (Nouveau Roman, Bewusstseinsstrom usw.) auf das altbackene, von Amis dominierte Genre an und erzielten dadurch Aufsehen erregende Wirkungen. Norman Spinrads Roman „Champion Jack Barron“ war ebenso Gegenstand von Debatten im Parlament wie J. G. Ballards Storys „The Assassination of John Fitzgerald Kennedy Considered as a Downhill Motor Race“ und „Plan for the Assassination of Jacqueline Kennedy“. Man wollte ihr Sprachrohr „New Worlds“ verbieten.
Den Roman „Licht“ braucht man nicht zu verbieten, sollte ihn aber doch nicht unbedingt einem Kind unter 16 Jahren in die Hand drücken. In etwa zehn Kapiteln wird gevögelt, was das Zeug hält, und die Figuren haben keine Hemmungen, das F-Wort in den Mund zu nehmen. Das ist ein hübscher Aspekt auf der Oberfläche, der einem Autoren aus den wilden sechziger und siebziger Jahren wohlansteht. Aber nach dem Motto „love makes the world go round“ führt und hält Sex die Paare zusammen. Und manchmal kann das richtig lustig sein, so etwa dann, wenn es sich um Klone handelt, die sowieso unfruchtbar sind.
Aber Scherz beiseite. Viel wichtiger ist ja, dass sich der Autor einer Erzählweise bedient, die Otto Normalleser nicht gewohnt ist. Obwohl die drei Erzählstränge ganz streng in ihrer Reihenfolge gehalten und sogar durch Icons an jedem Kapitelanfang gekennzeichnet werden, scheint sich keine Spannung aufzubauen, die den Leser vorwärts ziehen würden. Seltsamerweise gibt es aber eine Menge Querverbindungen, die zunehmen. Es ist, als würde man in ein Gewebe vordringen.
Michael Kearney
Das liegt zum Teil daran, dass der Kearney-Erzählstrang keineswegs eine Hard-Science-Story ist, in der man der Entdeckung des Jahrtausends entgegenfiebern würde. Vielmehr scheint es sich so zu verhalten, dass sowohl Tate als auch Kearney vor ihrer Entdeckung Angst haben und von ihr – zumindest psychologisch – überwältigt und vereinnahmt werden. Vielmehr liest sich die Story wie ein Gothic-Geister-Horror-Story über einen Dämon namens Shrander, der aus einem geheimnisvollen Würfel aufzusteigen pflegt. Bekanntlich hat Clive Barker in „Hellraiser“ daraus einen umfassenden Roman-Plot gemacht, der inzwischen über ein Dutzend mal auf Zelluloid verewigt worden ist. Vielleicht sollte Barker den Autor verklagen.
Seria Maú Genlicher
Der zweite Erzählstrang um Kearneys Tochter Seria Maú Genlicher ist purer Cyberpunk: Die Raumfahrerin existiert nicht mehr in der Gestalt, die wir als menschlich definieren würden. Körperlich lebt sie in einem Tank, genau wie Neo in der Matrix: umgeben von einer Nährflüssigkeit, über Kabel und Schläuche angeschlossen an ihr Raumschiff, die „White Cat“. Dessen Mathematik ist eine Künstliche Intelligenz und ihre wichtigste Steuereinheit. Sie ermöglicht Seria, innerhalb von Milliardstel Sekunden Kursänderungen auszuführen und Attacken zu fliegen. Seria braucht keine körperliche Anwesenheit: Sie projiziert ihr Hologramm an jeden beliebigen Ort, so etwa in der Szene, als sie Billy Anker begegnet.
Ed Chianese
Serias Bruder Ed Chianese liebt es ebenfalls, in einem Tank seine schönsten Stunden zu verbringen und sich in Scheinwirklichkeiten zu verlustieren. Er ist ein Realitätsflüchter, und in der Autorenbiografie ist kurz berichtet, was der Autor mit solchen Figuren macht: Er wirft sie in die Realität, ganz gleich, von wem diese wiederum gemacht worden ist. Auf Umwegen über Sandra Shen erkennt Ed allmählich, dass er eine Herkunft hat. Als er unter vielen Herzschmerzen mit dieser zu Rande gekommen ist, eröffnet ihm Sandra Shen (der Name ist ein Anagramm von „Shrander“), welche Zukunft ihm offensteht. Er wünscht sich ein Raumschiff namens „Black Cat“ …
Querverbindungen
Nicht nur Katzen gibt es allenthalben, sondern auch Würfel. Das ist nur konsequent, denn alle drei Erzählstränge drehen sich um die gleiche Familie. Aber alle Erzählstränge weisen als gemeinsames Element ein Rätsel auf, das sich als verborgener Beweggrund erweist. Für Kearney ist der Shrander sowohl Dämon als auch der Torwächter zu einer Realität, die fremdartig und beängstigend ist – und direkt zu seiner und Tates Entdeckung führt: den mathematischen Transformationen, die interstellare Raumfahrt ermöglichen. Die „White Cat“ wäre ohne diese – an Bord als KI verkörperlichte – Mathematik nicht möglich.
Sandra Shen ist eine andere, spätere Erscheinungsform des Shranders. Sie transformiert das Leben von Ed Chianese, zum Teil durch ihre seltsame Flüssigkeit, in der Ed wahrsagt. Seria hingegen erlebt keine Manifestation des Shranders an Bord oder sonstwo. Doch der Shrander befindet sich an Bord. Von einem zwielichtigen Genschneider namens Onkel Sip hat sie eine geheimnisvolle Schachtel erhalten, aus der nur hin und wieder ein Schaum aufblubbert und der Satz: „Dr. Haends! Dr. Haends in die Chirurgie!“ zu hören ist. Natürlich ist „Dr. Haends“ ebenfalls ein Anagramm von Shrander. In ihrem Tank träumt Seria Maú von einem Gentleman, der in Frack und Zylinder gekleidet ist und ihr rät: „Verzeihe dir selbst!“ Diese Botschaft ist die gleiche auch für Ed und seinen Vater Michael Kearney.
Erlösung
Wer ist der Shrander?, dürfte man sich spätestens jetzt fragen. Das darf ich aber nicht verraten, um die Spannung nicht zu zerstören. Aber man kann betrachten, was er bewirkt: den konzeptionellen Durchbruch. Kearney ist im Alter von 20 Jahren ein Furcht erregender Blick in eine Erscheinungsform der Realität gewährt worden, die ihn sowohl inspiriert als auch ängstigt. Das wirkt sich auch auf seine Sexualität aus. Seine Frau Anna kann davon ein Lied singen. Das, was meistens als „normaler Sex“ angesehen wird, ist Kearney nicht möglich. Für Anna ist es der Gipfel des Triumphs, als sie Kearney endlich dazu bringen kann. Es ist anzunehmen, dass aus dieser Vereinigung die Zwillinge Alice (Seria) und Ed entstammen. Anna ist eine sehr tapfere, aber auch sehr verzweifelte Frau.
Kearney liebt es, am Strand zu sitzen, neben dem Wochenendhäuschen auf Long Island. Ed Chianese geht gerne an den Strand, um sich von den anstrengenden Wahrsage-Sessions zu erholen. Annie Glyph leistet ihm Gesellschaft. Seria Maú lebt im „Strand“. Dies ist die Region der Artefakte, die den Kefahuchi-Trakt umgibt und relativ ungefährlich ist.
Der Shrander ebnet diesen beiden den Weg zu einer anderen Art von Durchbruch: durch ein Wurmloch in eine andere Dimension. Diese ist angeblich von Billy Anker erkundet worden, aber wer glaubt schon einem Klon? Immerhin unternimmt Seria einen kühnen Flug durchs XR1-Wurmloch in jene andere Dimension und findet endlich Erlösung: Diese Realität ist voller Licht. Ich stelle sie mir ungefähr so vor wie die lichterfüllte Dimension, in der sich Neo auf dem Höhepunkt von „Matrix Revolutions“ befindet, als er in der Matrix City dem lokalen Gott begegnet. Diese Dimension strahlt golden, denn sie ist aus Informationen aufgebaut. Nur strahlt sie nicht grünlich, sondern hell wie die Sonne. Dies ist es, was Seria und später Ed finden. Es ist Offenbarung und Erlösung, die ihnen der Shrander bringt.
Ist der Autor bekloppt?
Wie man hoffentlich gesehen hat, ist die Geschichte durchaus mit einer Aussage und einem wunderschönen Finale versehen. Es gibt auch sehr viel Humor, allerdings von der trockensten Sorte, so dass die Ironie an die meisten Leser verschwendet sein dürfte, fürchte ich – auch Sekt schmeckt nicht jedem. Was den Leser verstört, ist die Art, wie die Story sich entwickelt. Kearney ist ein Mörder, der nicht bestraft wird. Seine Frau bestraft ihn nicht einmal, sondern verhilft ihm indirekt zu ewigem Ruhm, wohingegen der Wissenschaftler Kearney, statt ein brillantes Genie zu sein, nicht aus seiner privaten Hölle erlöst wird. Alle diese Enden sprechen den amerikanischen Regeln, wie Science-Fiction zu sein hat, Hohn. Aber das war ja schon in den sechziger und siebziger Jahren nicht anders.
Ist dies eine Space-Opera? Banks und Baxter behaupten es – und der deutsche Verlag sowieso. |Heyne| hat in seinem letzten Jahrbuch die „New Space Opera“ so intensiv behandelt, als ginge es um einen breiten Durchbruch in eine andere Dimension der Science-Fiction. Und getreu diesem Marketingprogramm veröffentlicht |Heyne| eine „New Space Opera“ nach der anderen, zuletzt „Singularität“ von Charles Stross und die Fortsetzungen von Reynolds‘ „Unendlichkeit“, einem wirklich grandiosen, wenn auch keineswegs einfachen Roman (siehe meine Besprechung). Manches davon mag sogar lesbar sein. „Sternentanz“ von John Clute war es nicht, und bei „Licht“ von M. John Harrison wurden, wie erwähnt, einige Zweifel laut.
Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass „Licht“ einfallsreich ist wie die besten Romane von Iain M. Banks aus der Kultur-Serie, etliche Cyberpunk-Elemente aufweist, was die Vision von der Technik in 400 Jahren angeht. Und sich dennoch nicht scheut, Gothic Horror aufzugreifen, um London 1999 in eine Stadt des Zwielichts zu verwandeln, in der alles möglich sein kann. Eine Show wie „Sandra Shens Zirkus von Pathet Lao“ scheint dem viktorianischen 19. Jahrhundert zu entstammen und erinnert an Christopher Priests exzellenten Roman „The Prestige“ (Das Kabinett der Magier; bei |Bastei-Lübbe|).
Die Übersetzung; Humor
Die Fußnoten, mit denen die Übersetzer obskure oder rätselhafte Verweise und Zitate im Text erklären, sind wirklich wertvoll und hilfreich. Die Übersetzer brüsten sich innerhalb des Haupttextes aber manchmal auch mit ihrem Können. Solche ausgefallenen deutschen Wörter wie hier findet man selten in einer Übersetzung aus dem Englischen.
Ihre Übertragung ist durchweg sehr lesbar und lässt den Humor erkennen, den der Autor in Hülle und Fülle hineingepackt hat. Allein schon die Namen der Raumschiffe klingen wie die lustigen Namen der Kulturschiffe bei Iain M. Banks: „Touching the Void“ ist noch das harmloseste Beispiel. Einmal taucht eine Herde Schiffe auf, deren Namen jeweils Anagramme der anderen Namen darstellen.
Und natürlich gibt es etliche Katzen und Würfel und Sex und Strände. Und wer Seria Mau’s Namen mit einem S versieht, erhält eine Maus in einer Katze. Dies entspricht genau den im Roman geäußerten Verhältnissen: Nicht Seria hat sich das Raumschiff „White Cat“ ausgesucht, sondern es war umgekehrt. Und wahrscheinlich verhält es sich mit Eds „Black Cat“ ebenso.
_Unterm Strich_
Alle oben genannten Ausführungen sind meine persönlichen Deutungen der Aussagen, die ich dem Text entnommen habe. Andere Kritiker kommen möglicherweise, ja sogar wahrscheinlich, zu anderen Interpretationen. Dies lässt die offene Erzählstruktur des Romans mit voller Absicht zu.
Insgesamt ist „Licht“ keine leichte Kost, sondern eine lohnende Frucht harter Arbeit und geduldiger Hartnäckigkeit. Wer die erste Hälfte des Buches geschafft hat, ist bereits Sieger nach Punkten: Von hier ab wird’s leichter, spannender, actionreicher. Und gegen Schluss verknüpfen sich die drei Erzählstränge zu den dargestellten Zusammenhängen. Licht, fürwahr! Licht am Ende des Tunnels.
Taschenbuch: 446 Seiten
Originaltitel: Light, 2002
Aus dem Englischen von Marianne & Hendrik Linckens
ISBN-13: 9783453520042
www.heyne.de
Der Autor vergibt: 





