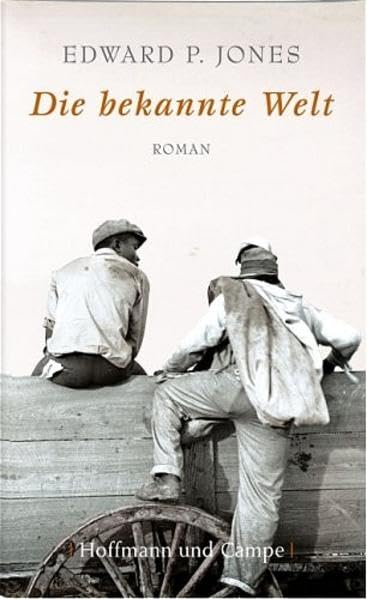Zehn Jahre hat Edward P. Jones sein Romandebüt „Die bekannte Welt“ vorbereitet. Nun erntet er die Früchte dieser langjährigen Arbeit. „Die bekannte Welt“ war kaum erschienen, da sorgte das Buch auch schon für Furore, nicht zuletzt aufgrund der brisanten Thematik. 2004 heimste Edward P. Jones den Pulitzerpreis ein, in diesem Jahr folgte der IMPAC Award 2005. Reichlich Vorschusslorbeeren, die eine entsprechend hohe Erwartungshaltung wecken.
„Die bekannte Welt“ spielt Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA. Für die meisten Schwarzen endete in Virginia die ihnen bekannte Welt an der Grundstücksgrenze der Plantage, auf der sie arbeiteten. Was dahinter lag, war unbekannt, fremd und Stoff für Träume. So erging es auch Henry Townsend in jungen Jahren. Er wuchs als Sklave auf der Plantage von William Robbins auf. Sein Vater ist einer der Schwarzen, die es geschafft haben. Aufgrund seiner außerordentlichen Begabung in der Verarbeitung von Holz, verdient er sich etwas dazu und spart genug an, um zunächst sich selbst, dann seine Frau Mildred und zuletzt seinen Sohn Henry freizukaufen.
Henry steht fortan auf eigenen Füßen und er macht etwas daraus. Schon bald hat Henry, dank der Unterstützung durch William Robbins, der ihn fast wie einen Sohn behandelt, seine eigene Plantage – mit seinen eigenen Sklaven. Aus heutiger Sicht wirkt es geradezu absurd, dass ein Schwarzer, noch dazu ein ehemaliger Sklave, selbst zum Handlanger der Sklaverei wird, für Henry ist es weder ungewöhnlich noch verwerflich. Zusammen mit seiner Frau Caldonia bewirtschaftet er seine Plantage mit einer stetig größer werdenden Schar Sklaven. Doch das Glück ist nicht von Dauer. Henry stirbt relativ jung, seine Frau Caldonia steht fortan allein vor der Aufgabe, die Plantage am Laufen zu halten. Dennoch kann sie nicht verhindern, dass sich Chaos auf der Plantage einschleicht. Caldonia drohen die Zügel zu entgleiten …
„Die bekannte Welt“ ist weniger eine geradlinig erzählte Geschichte, sondern vielmehr das vielschichtige und groß angelegte Portrait einer ganzen Epoche. In diesem Portrait spiegelt sich eine Phase der Aufbruchstimmung wieder. Immer mehr Sklaven erlangen die Freiheit, auf den ersten Plantagen kommt es zu Aufständen und der Krieg zwischen Süd- und Nordstaaten liegt genauso wie das offizielle Ende der Sklaverei nicht mehr in weiter Ferne. Innerhalb dieser Epoche hat Jones sich ein dunkles und relativ unbekanntes Kapitel herausgefischt: freie Schwarze, die selbst zu Sklavenhaltern werden.
Jones fängt diese Phase der Geschichte ein und skizziert sie anhand einer so großen Vielfalt von Figuren, dass er sogar ein Namensverzeichnis für sinnvoll erachtet hat. Und das ist durchaus angebracht. Jones präsentiert dermaßen viele Figuren, dass man als Leser schon Acht geben muss, dass man nicht den Überblick verliert. So verlangt der Roman ein recht hohes Maß an Aufmerksamkeit, belohnt den Leser aber eben auch mit einem faszinierend breit gefächerten Bild der damaligen Zeit. Jones zeigt alle Seiten auf: Sklaven und Sklavenhalter, Weiße und Schwarze, Freie und Unfreie, Gesetzeshüter und Sklaveneinfänger, Rechtschaffende und Gesetzlose.
Jones Roman weist schon eine beachtliche Tiefe auf. Trotz der Vielzahl der Figuren schafft er es, dem Leser Handlungen und Handelnde nahe zu bringen. Das Innenleben der Protagonisten wird größtenteils recht deutlich, was in Anbetracht der Fülle an Figuren schon beachtenswert ist. „Die bekannte Welt“ ist ein Roman, der uns tief in das Geschehen zieht und eine recht dichte Atmosphäre aufweist, ohne wirklich Spannung zu bieten. Die damalige Zeit wird greifbar und der Roman wirkt insgesamt sehr plastisch in seinen Schilderungen.
Was Jones‘ Erzählweise besonders auszeichnet, ist sein großer Weitblick. Immer wieder streut Jones ein, was aus handelnden Nebenfiguren später einmal wird. Das ist eine Mischung aus Preisgeben und Andeuten, die zum portraitierenden Charakter des Buches beiträgt und dabei hilft, die damaligen Ereignisse in ihrer Bedeutung zu ermessen. Das ist einerseits sehr schön, denn man spürt beim Lesen immer wieder, dass unter der Oberfläche dieses Romans etwas ganz Großes atmet, aber das kann nicht über Schwächen hinwegtäuschen, die ein wenig die Freude trüben.
Jones springt innerhalb der Handlung unglaublich viel hin und her. Ausgehend von Henrys Tod, zieht er seine Geschichte auf und blickt sowohl auf zurückliegende Ereignisse wie auch auf zukünftige. Zusammen mit der Vielzahl an Figuren ergibt das den Effekt der zeitweiligen Desorientierung. Ich habe mich beim Lesen ab und zu mal gefragt, an welcher Stelle der Chronologie sich die Geschichte eigentlich gerade befindet. Manchmal neigt man bei der Lektüre ein wenig dazu, den zeitlichen Rahmen aus den Augen zu verlieren, einfach weil Perspektive und Figuren stetig wechseln.
Teilweise hatte ich obendrein das Gefühl, dass Jones in seiner weitblickenden, stets vorausschauenden Erzählweise ein wenig zu weit geht. So kommt es beispielsweise vor, dass während einer Unterhaltung zwischen zwei Figuren immer wieder auf bestimmte zukünftige Ereignisse eingegangen wird. Eine Figur sagt einen Satz, anschließend lässt Jones den Blick in die Zukunft schweifen, als nächstes gibt eine andere Figur eine Antwort auf den vorangegangenen Satz, während Jones gleich darauf wieder in die Zukunft springt. Diese Wechsel mitten in den Dialogen haben den etwas unangenehmen Nebeneffekt, dass sie die Geschichte zerstückeln. Ohne etwas gegen Zeitsprünge zu haben, sind mir Zeitwechsel dieser Art einfach zu abgehackt. Sie trüben die Atmosphäre und in meinen Augen hätte Jones gut daran getan, von solchen Spielereien die Finger zu lassen.
Recht unscheinbar ist Edward P. Jones in seiner ganzen Erzählart. Sprachlich wirkt der Roman sehr unauffällig und schlicht, geradezu einfach. Jones erzählt sehr zurückhaltend und bringt trotz dieser sehr einfachen Art seine Figuren recht gut zur Geltung. Er gibt ihnen viel Raum sich zu entfalten. Sie bilden den unumstrittenen Mittelpunkt der Geschichte. Sie wachsen einem im Laufe des Romans durchaus ans Herz und wirken so durch und durch menschlich, dass man sie fast für echt halten möchte.
Jones zeichnet ein lebhaftes Bild einer Epoche, in dem auch Platz für viele kritische und nachdenklich stimmende Zwischentöne ist. Allein die Tatsache, dass Henry Townsend, die zentrale Figur der Geschichte, ein Schwarzer ist, der selbst Sklaven hält, zeigt schon, dass Jones (ebenfalls Afroamerikaner) durchaus auch zur Kritik an der eigenen Rasse fähig ist.
In der Handlung tauchen einige freie, teils sklavenhaltende Schwarze auf, die einem zu manchen Punkten der Handlung das Gefühl geben, dass die Hautfarbe vielleicht doch keine so große Rolle spielen mag, wie es uns die reale Geschichte eigentlich gelehrt hat – zumindest solange man frei ist. Aber diese Flausen weiß Jones einem auszutreiben. Knallhart holt er den Leser auf den Boden der Tatsachen zurück und zeigt, wie sehr die Hautfarbe doch alles dominiert und liefert mit seinem Roman letztendlich Material für interessante Gedankenspielereien. Jones zwingt den Leser dazu, die Perspektive zu wechseln und den Horizont zu verändern. Schon deswegen wird man das Buch nach der Lektüre noch eine ganze Weile im Gedächtnis behalten.
Was die historischen Hintergründe anbelangt, so wird es schwierig, wirklich stichhaltige Informationen zu finden. Die Frage, ob es damals wirklich schwarze Sklavenhalter gab oder nicht und wenn ja, wie viele, lässt sich kaum befriedigend beantworten – kein Wunder also, dass Jones selbst zehn Jahre in die Recherche investiert hat, bevor er sich daran machte, seine Geschichte innerhalb von sechs Monaten aufzuschreiben. Er selbst bezeichnet den Roman vielsagend als „historisch stichhaltig aber zu 98 Prozent erfunden“.
Alles in allem schlägt man das Buch am Ende mit etwas gemischten Gefühlen zu. Man spürt beim Lesen, dass unter der Oberfläche von Jones‘ Debütroman etwas Großartiges schlummert, aber es dringt nicht immer bis an die Oberfläche und ist nicht immer ganz leicht zu erfassen. Der Erzählfluss wird immer wieder für Rück- und Vorblenden unterbrochen, was in einigen Momenten etwas abgehackt wirkt und es dem Leser erschwert, die Chronologie im Auge zu behalten. Jones‘ Stil wirkt einfach und nüchtern, hin und wieder funkelt in manchen Absätzen aber auch eine gewisse Poesie auf.
Die Vielfalt der Figuren wirkt zunächst etwas unübersichtlich, ist aber vielleicht auch gerade deswegen in der Lage, ein weitreichendes Bild der damaligen Zeit zu skizzieren. Nicht immer bis in den letzten Winkel fesselnd, aber dennoch ist „Die bekannte Welt“ eine Geschichte, die man mit großem Interesse weiterverfolgt. Jones‘ Weitblick in erzählerischer Hinsicht und die Tiefe der Erzählung ganz allgemein ermuntern zum stetigen Weiterlesen. Jones skizziert ein groß angelegtes Gemälde einer ganzen Epoche, das vor allem wegen seiner nahe gehenden Figuren im Gedächtnis bleiben dürfte.