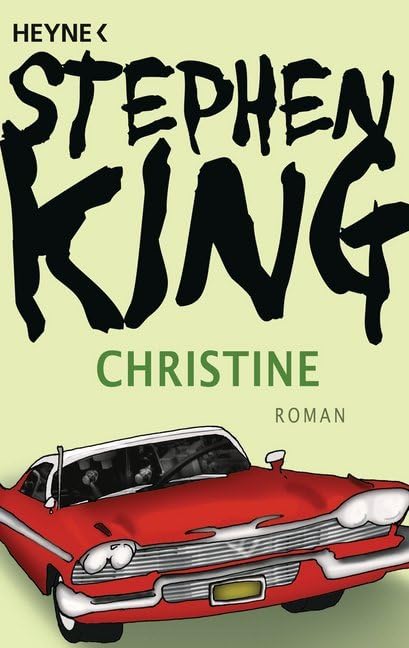Es ist Liebe auf den ersten Blick, als Arnie Cunningham, gerade 17 geworden, Christine begegnet – einem feuerrot-weiß lackierten, haifischflossengezierten Plymouth Fury des Baujahres 1958. In Libertyville, einem Städtchen im US-Staat Maine, ist Arnie, der intelligent aber keine Sportskanone ist sowie von heftiger Akne heimgesucht wird, der Prügelknabe seiner Highschool. Nur die Freundschaft zum baumlangen Football-Spieler Dennis Guilder verhindert, dass die Jugend von Libertyville den Außenseiter endgültig ausradiert.
Niemand weiß, dass Arnie hinter einer Maske aus Gleichmut sehr wohl seinen Groll nährt und Rachepläne schmiedet. Das macht sich Christine zunutze, die weniger ein Auto, sondern eine Metall gewordene und von einem bösen Geist beseelte Todesmaschine ist und sich als Instrument der Vergeltung anbietet, die Arnie in Libertyville üben will.
Die Reihe ist lang aber Christine willig. Dennis muss mit ansehen, wie der dämonische Wagen Macht über seinen Meister gewinnt. Hass ist der Treibstoff, nach dem Christine giert. Eine unheimliche Metamorphose setzt ein, die aus dem verrotteten Autowrack eine strahlende Blechschönheit erstehen lässt. Auch Arnie gewinnt an Selbstbewusstsein und Attraktivität, doch mit seinen Pickeln verlässt ihn sein liebenswürdiges Wesen.
Die Situation eskaliert, als Arnie sich neu verliebt – in eine Menschenfrau! Leigh Cabot ist die amerikanische Highschool-Queen schlechthin, doch auch sie stellt keine echte Konkurrenz mehr für Christine dar. Die hat inzwischen einen Grad des Eigenlebens erreicht, der es ihr ermöglicht, den Meister und sein Geschöpf die Rollen tauschen zu lassen. Als die verstörte Leigh ausgerechnet in die Arme von Dennis Guilder flüchtet, ist der Zeitpunkt der großen Schlussabrechnung gekommen. Christine bläst offen zum großen Halali auf ihre echten und eingebildeten Feinde und erweist sich wie jeder böse Geist zunächst als unzerstörbar … und schlau. Wer nicht für Christine ist, muss gegen sie sein, so lautet die einfache Regel, und daher frisst die automobile Revolution schließlich auch ihre Kinder …
Des Teufels liebstes Spielzeug
Mehr als drei Jahrzehnte sind vergangen, seit Stephen King die Phantastik-Fans dieser Welt mit der überraschenden Tatsache konfrontierte, dass der Teufel nicht zwangsläufig in einem Zauberspiegel, auf einem Geisterschiff oder in einem Spukschloss hausen muss, sondern ganz zeitgemäß in ein Auto fahren kann. Siehe da: Es funktioniert prächtig und belegt gleichzeitig, dass King als Schriftsteller wesentlich geistreicher ist (oder war), als ihm dies seine zahlreichen Kritiker zugestehen mögen.
Das Automobil ist nicht nur ein integraler Bestandteil des „American Way of Life“, sondern genießt darüber hinaus geradezu hymnische Verehrung als Objekt der Selbstverwirklichung und -darstellung: Zeig mir was du fährst, und ich sage dir, wer du bist. Wo derjenige von seinen Mitmenschen mit Neid oder Anerkennung betrachtet wird, der buchstäblich den Längsten hat, muss zwangsläufig eines besonderen Triebes am Baum der Technik-Geschichte mit Liebe gedacht werden.
Das Vierteljahrhundert nach dem II. Weltkrieg bescherte den USA (neben dem Kalten Krieg) einen wirtschaftlichen Aufschwung, wie es ihn nie zuvor gegeben hatte. Die übergroßen, spritfressenden, barock überladenen Automobile (oder besser „Straßenkreuzer“) der 1950er und frühen 60er Jahre spiegeln den Glanz einer Ära wider, in der es in Amerika nur den Himmel als Grenze zu geben schien – und selbst wurde energisch in Angriff genommen.
Nutzlos aber wunderschön
Der 1958er Plymouth Fury ist für King der Höhepunkt dieses Rausches: ein technisch selbst für seine Epoche bestürzend simpel konstruiertes, monströs übermotorisiertes, Kraftstoff vergeudendes, ungefilterte Abgase ausstoßendes, trotz seiner Größe kaum vier Passagieren Platz bietendes Gefährt, dessen Anblick nichtsdestotrotz noch heute zuverlässig die wehmütige Erinnerung an eine Zeit weckt, als man sich nur vor den gottlosen Kommunisten in Acht nehmen musste, denen man aber anders als den Gespenstern einer noch unbekannten Zukunft – Umweltzerstörung, Dauerrezession, Terrorismus – notfalls ordentlich in den Hintern treten konnte.
Diesen Traum oder die wehmütige Erinnerung daran zu nehmen und in einen echten Albtraum zu verwandeln, ist wie gesagt ein gelungener Einfall. Es ist aber nicht der einzige, mit dem Stephen King in „Christine“ aufwartet. Analysiert man, wie der Autor sein Garn spinnt, wird rasch deutlich, dass er dabei noch ganz andere heilige Kühe schlachtet.
Kleine Städte voller Lügen
Die US-amerikanische Kleinstadt als Mikrokosmos oder Hort aller Tugenden, die dieses Land einst groß gemacht haben, ist ebenfalls ein Topos der Populärkultur. Hier, wo die Leute einander noch persönlich kennen, ist man freundlich und nett zueinander, kennt anders als in der sündhaften Stadt die kleinen, aber wirklich wichtigen Dinge des Lebens und weiß ihren Wert zu schätzen. So lassen sich die wichtigsten Klischees kurz zusammenfassen.
Dass dem natürlich mitnichten so ist, haben vor Stephen King schon andere (Autoren) thematisiert. Trotzdem existiert die Idylle als stille Sehnsucht besonders in den Köpfen derer weiter, die sich von den Anforderungen, die die Gegenwart an sie stellt, überfordert fühlen. Stephen King, der Chronist des bürgerlichen Mittelstandes, kennt diese harmonisch-verlogenen Traumwelt genau. Er spielt mit ihr wie ein Virtuose auf seinem Musikinstrument. Libertyville (schon der Name ist reine Ironie) ist kein Goldfischteich, sondern ein Haifischbecken, dessen Bewohner auch vor Kannibalismus nicht zurückschrecken.
In Libertyville leben keine Waltons; es ist ein gesichts- und kulturloser Flecken irgendwo dort auf dem Land, wo es ganz besonders platt ist. Bewohnt wird er von bestenfalls gleichgültigen, meist bornierten, selbstsüchtigen, gemeinen Zeitgenossen. Nur die Familie stellt manchmal eine kleine Oase in der grausamen Wüste dar, die Alltag heißt, doch man verlasse sich besser nicht zu sehr darauf, denn auch hier kann es krachen, und wenn dies geschieht, dann ziehen selbst böse Geister lieber den Kopf ein!
Krieg der Jugend
Ein besonderes Kapitel widmet King jener Vorhölle auf Erden, die der amerikanischen Jugend vorbehalten bleibt: der Highschool mit ihrem komplexen und rigidem Kastensystem, in dem es für jeden Schüler und jede Schülerin einen festen Platz gibt – und Gnade Gott dem armen Teufel, den es in die Unterschicht der Unberührbaren jenseits der Footballspieler, Cheerleader oder reichen Söhne/Töchter verschlägt! Die Unbarmherzigkeit, mit der die Unglücklichen malträtiert werden, die es nicht geschafft haben, irgendwo ‚oben‘ ihre Nische zu finden, ist der explosive Nährboden, auf dem jene inzwischen auch hierzulande bekannten jugendlichen Amokläufer gedeihen, die bis an die Zähne bewaffnet ihre Schule heimsuchen, um zu vernichten, was sie nicht im amerikanischen Wettstreit zum optimal für den Lebenskampf gerüsteten Bürger heranwachsen, sondern an Leib und Seele zerbrechen ließ.
Arnie Cunninghams wahnwitzige Wutanfälle – schon lange bevor Christine ihn beherrscht – verraten einen Menschen am Rande des Abgrunds, nachdem ihn die Welt ein wenig zu lange getreten hat. Wenn King ihn beklemmend authentisch Rache schwören lässt für das erlittene Unrecht, verschmilzt das fiktive Libertyville von 1978 mit den vielen Kleinstädten, in denen es seither massenmörderisch krachte.
Die Meisterschaft, mit der King seine Version von Thorntons „Kleiner Stadt“ präsentiert, wurde von den Lesern offenbar deutlicher und früher zur Kenntnis genommen und anerkannt als von der Kritik. Viel zu lang sei die Mär vom mordenden Mobil geraten und lächerlich dazu, wurde moniert, was dem Erfolg des Buches jedoch keinerlei Abbruch tat. Heute weiß man längst, was man an „Christine“ hat: einen modernen Klassiker der Phantastik, verfasst von einem wirklich guten Erzähler auf dem Höhepunkt seiner schriftstellerischen Fähigkeiten. Viele hundert Seiten lesen sich jederzeit mühelos, obwohl (scheinbar) wenig passiert. Doch der wahre Horror liegt eben nicht in Christines spektakulären Attacken, sondern in der bedrückenden Atmosphäre einer stetig wachsenden Bedrohung, die sich Libertyville wie eine Gewitterfront nähert und genauso unaufhaltsam ist.
„Christine“ im Film
Während „Christine“, der Roman, sich auch im 21. Jahrhundert gut gealtert bzw. gereift behaupten kann, kann „Christine“, der Film von 1983, weniger gut mithalten. Die wenig inspirierte Auftragsarbeit des schon damals künstlerisch ausgebrannten Drehbuchautors und Regisseurs John Carpenter folgte strikt den Konventionen des Hollywood-Kinos und klammerte jede Gesellschaftskritik sorgfältig aus. Der Arnie Cunningham des Films ist und bleibt der ewige Außenseiter, dessen tragische Züge hinter der Maske des Rächers weitgehend verschwinden und der folgerichtig vom aufrechten amerikanischen, d. h. angepassten Junghelden und seiner maßvoll emanzipierten Gefährtin ausgelöscht wird, nachdem zuvor den asozialen Abschaum der Repperton-Bande die ‚gerechte‘ Strafe ereilte: Die Störenfriede sind verschwunden, die traditionelle soziale Ordnung ist wieder hergestellt – bis sie das nächste Monster gebiert …
Autor
Normalerweise lasse ich an dieser Stelle ein Autorenporträt folgen. Wenn ich ein Werk von Stephen King vorstelle, pflege ich dies zu unterlassen, wie man auch keine Eulen nach Athen trägt. Der überaus beliebte Schriftsteller ist im Internet umfassend vertreten. Nur zwei Websites – die eine aus den USA, die andere aus Deutschland – seien stellvertretend genannt; sie bieten aktuelle Informationen, viel Background und zahlreiche Links.
Taschenbuch: 879 Seiten
Originaltitel: Christine (New York : Viking 1983)
Übersetzung: Bodo Baumann
http://www.heyne-verlag.de
eBook: 1001 KB
ISBN-13: 978-3-641-05386-4
http://www.heyne-verlag.de
Hörbuch-Download: 23 h 1 min. (ungekürzt; gelesen von David Nathan)
http://www.audible.de
Der Autor vergibt: