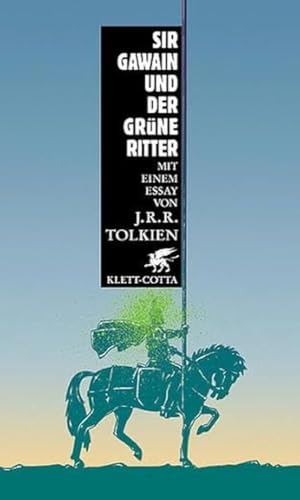Das arthurische Versepos „Sir Gawain“ aus dem 14. Jahrhundert, das aus über 2500 Zeilen mit Stabreim besteht, dürfte relativ bekannt sein. Es ist eine Abenteuergeschichte für Erwachsene und dreht sich um Liebe und Sex, Fragen der Ehre, gesellschaftliches Taktgefühl, persönliche Integrität sowie volkstümliche Magie – Letztere in der Gestalt des Grünen Ritters, der offenbar nicht zu besiegen ist.
Der Essayist: Tolkien
Professor Tolkien war schon rein beruflich ein Liebhaber der alt- und mittelenglischen Dichtung, sei es nun der „Beowulf“ oder Geoffrey Chaucers berühmte „Canterbury Tales“. Am liebsten waren ihm jedoch, so berichtet sein Sohn Christopher, die Dichtungen aus den westlichen Midlands, in denen Tolkien aufwuchs. Denn diese wichen vom Sprachgebrauch Chaucers, der sich später durchsetzte, gewaltig ab – folglich geriet ihr alliterierender Stil in Vergessenheit.
Aus dieser Region und aus der Zeit um 1370 stammt die Dichtung „Sir Gawain und der Grüne Ritter“. 1925 veröffentlichte Tolkien eine erste Übersetzung in Oxford. 1967 folgte eine zweite von N. David, und darauf stützt sich die deutsche Übersetzung durch Hans J. Schütz. Den Essay, der bereits in dem |Klett-Cotta|-Band „Die Ungeheuer und ihre Kritiker“ erschien, hat Wolfgang Krege übersetzt.
Handlung
Am Neujahrstag hat König Artus mal wieder seine Ritter um die Tafelrunde versammelt. Weihnachten ist vorüber, aber auf Burg Camelot feiert man immer noch gerne. Die Freude wird leider schwer gestört, als ein merkwürdiger Ritter auftaucht und den König selbst zum Kampf herausfordert. Der völlig in grün gekleidete und sogar mit einer grünen Haut und grünem Haar versehene riesige Ritter bezweifelt, dass unter den anwesenden Rittern einer sei, der edleren Gemüts ist als er selbst.
Die Herausforderung
Oho, welche Frechheit, meint Artus und würde den Herausforderer am liebsten selbst Mores lehren, doch Gawain bittet aus Pflichtgefühl selbst um diese Ehre. Artus stünde doch wohl über solchem Geplänkel, oder? Artus meint „okay“, und der Grüne Ritter hat nichts dagegen, statt dem König diesem Ritter die Rübe abzuschlagen. Denn darin besteht die Herausforderung: Gawain darf dem Ritter einen Hieb mit einer Waffe versetzen, ohne dass dieser sich wehrt. Doch danach darf der Grüne sich revanchieren – und zwar genau ein Jahr und einen Tag später.
Gawain hat kein Problem mit diesem Arrangement, denn schließlich will er ja a) nicht als Feigling dastehen und b) scheint das eine todsichere Sache: Welcher Mensch hätte sich denn nach einem tödlichen Axthieb auf den Nacken davon erholt? Keiner!
Mit einer stabilen Streitaxt trennt er dem brav vornübergebückten Ritter sauber den Kopf ab. Zum Erstaunen aller richtet der sich wieder auf, als wäre nichts gewesen, schnappt sich seinen Kopf und fordert Gawain auf, in einem Jahr allein zur grünen Kapelle zu kommen. Sprach’s und ritt von dannen. Er hat ihnen nicht einmal seinen Namen verraten. Gawain ist nun der Gelackmeierte, denn mit der Wette hat ihn der Grüne Ritter offensichtlich hereingelegt.
Ein Jahr später
So ein Jahr kann schnell vorübergehen, doch Gawain hat die Pflicht nicht vergessen. Angetan mit einer prächtigen Rüstung, macht er sich auf die Suche, fahndet überall in ganz Wales nach der grünen Kapelle, erlebt jede Menge Abenteuer mit den wilden Bergbewohnern (darunter auch Oger!), doch die Kapelle findet er nicht. Stattdessen stößt er – nachdem sein Gebet an Maria erhört wurde – auf eine prächtige und wehrhafte Burg. Hier freut man sich über alle Maßen darüber, ein echten Hofmann des Hochkönigs bei sich aufnehmen und unterhalten zu dürfen. Besonders die schöne Gattin des Burgherrn hat es Gawain angetan – wie schön sie sich von ihrer ständigen Begleiterin, einer düsteren alten Vettel, abhebt. Leider erfährt er nie ihren Namen.
Nach einer Weile des Feierns meint Gawain am 29. Dezember, jetzt müsse er aber los, schließlich seien es nur noch wenige Tage bis Neujahr. Der Burgherr, der (vorerst) leider ebenfalls namenlos bleibt, meint, er würde Gawain rechtzeitig zu der Kapelle bringen lassen, die ja ganz in der Nähe liege. Gawain müsse nur noch drei Tage ausharren. Dann schlägt er eine Wette vor: Der Burgherr werde etwas von seinen Jagden mitbringen und es seinem Gast geben, woraufhin ihm der Gast im Tausch dafür das geben würde, was er unterdessen in der Burg empfangen habe.
Wie raffiniert dieser Deal ist, stellt sich heraus, als Gawain am nächsten Morgen, während der Burgherr schon auf der ersten von drei Jagden ist, von der schönen Gemahlin seines Gastgebers geweckt wird. Da sitzt sie nun am Bettrand – die Verführung in Person.
Kann Ritter Gawain der Versuchung widerstehen, oder wird sie ihn von seinem Vorhaben abbringen? Immerhin vertritt er hier quasi seinen König!
Mein Eindruck: die Erzählung
Der Text der Erzählung liegt keineswegs als Epos in Verszeilen vor – das gibt es in anderen Ausgaben – sondern in Prosaform. Dadurch lässt er sich sehr gut lesen und verstehen. Die Handlung dürfte ebenfalls keine Probleme bereiten, aber es gibt natürlich ein paar Knackpunkte, auf die es ankommt und die man leicht übersieht.
Obwohl der Autor unbekannt ist, beruft er sich sich als erstes auf den alten Homer und dessen Heldengedichte „Ilias“ und „Odyssee“. Durch diesen Hinweis erspart sich der Autor selbst die obligatorische Anrufung der Muse, denn das hat ja schon der griechische Kollege erledigt. (Auch die detaillierte Beschreibung von Gawains prächtigem Schild ist der homerischen Beschreibung von Achilleus‘ Schild nachempfunden.)
Außerdem stellt sich der Autor damit in die entsprechende literarische Tradition. Nur das entsprechend gebildete Publikum kann mit diesem Homer-Verweis etwas anfangen, wodurch er schon am Anfang seinen Anspruch deutlich macht: Dieser Stoff ist nichts für die ungebildeten Stände. Nur wer Homer und die französischen Ritterromane kennt – so einer der Verweise am Schluss -, ist nach Ansicht des Autors in der Lage, mit dem „Gawain“ angemessen umzugehen.
Der Autor wendet sich also als Gebildeter an seinesgleichen, stellt sich nicht über sie. Dennoch ist das, was er im „Gawain“ vorzubringen hat, keine Lappalie, sondern eine ernsthafte Kritik des höfischen Moralkodex. Das wird am Schicksal des braven Ritters Gawain in der Burg der Verführerin deutlich.
Zweimal wird Gawain aufs Kreuz gelegt: einmal auf Camelot vom Grünen Ritters, dann wieder in der Burg des namenlosen Jägers. Nun ist aber Gawain keineswegs ein kompletter Idiot, mit dem man nach Belieben Schlitten fahren könnte, sondern sein Handicap besteht darin, dass er stets den hehren Idealen des höfischen Anstands und der Rechtschaffenheit entsprechend handeln will und muss. Er bietet dem Burgherrn sogar seine Dienste an, weil ihm die höfischen Regeln dies so vorschreiben. Allerdings scheint er es mit seinem Diensteifer ein wenig zu übertreiben
Deshalb bringt ihn die Versuchung durch die schöne Lady schwer in die Bredouille: Es wäre ein schwerer Bruch seines ritterlichen Kodex, sie von der Bettkante zu stoßen. Also plaudert er mit ihr über dieses und jenes, Gott und die Welt. Zum anderen darf er jedoch auch nicht seinen Burgherrn dadurch verraten, dass er mit der Lady Ehebruch begeht und seinen zeitweiligen Dienstherrn betrügt.
Doch in der dritten Nacht reichen all seine Finten, die ihm höfisches Gebaren, Geschwätz und Tändeleien an die Hand geben, nicht mehr aus, um die Waffen der Versucherin abzuwehren: Sie kommt oben ohne. Jetzt wird’s ernst. Wie uns der Autor klarmacht und was sich im Verhalten Gawains spiegelt, streckt der höfische Anstandskodex die Waffen und die religös motivierte Moral kommt endlich zu ihrem Recht – was wohl längst überfällig war, meinen wir lesen zu können. Gawain sucht sogleich den Beistand eines Mönches auf, bei dem er die Beichte ablegen kann.
Doch er hat einen winzigen Fehler gemacht, der ihm zum Verhängnis werden könnte. Das ist aber durchaus verständlich, wenn man in Betracht zieht, dass er ja am nächsten Tag sterben soll. An Neujahr soll er in der Grünen Kapelle dem Grünen Ritter seinen entlößten Nacken hinhalten, damit dieser ihn mit der Axt durchtrennen kann. Keine erhebenden Aussichten. Man kann also Gawains Fehltritt mit seiner Angst um sein Leben entschuldigen. Aber ist es wirklich so einfach? Wenn Gawain nämlich ein wirklich frommer Christenmensch wäre, dann würde er auf die Freuden des Jenseits hoffen und den tödlichen Hieb in Kauf nehmen. Also ist Gawain weder ein Top-Christ noch ein Top-Ritter, sondern lediglich ein normaler Mensch.
Und als solcher wird er uns auch vorgestellt. Denn auch wenn seine beiden Gastgeber in der Burg (vorerst) namenlos bleiben, so sind doch alle einigermaßen gut charakterisiert. So ist etwa der Burgherr ein großer Jäger vor dem Herrn, der das Jagen (leider) als Sport betreibt, zuweilen unter Einsatz des eigenen Lebens. Diese Charakterzeichnungen berechtigen Tolkien in seinem Essay zu der Aussage, dass es sich bei dem Text „Sir Gawain“ nicht um eine tumbe moralische Allegorie handle, sondern um ein tief verwurzeltes Märchen. In diesem würde der Autor auf alte Quellen zurückgreifen und sie den Erfordernissen der Zeit und des Autorencharakters anpassen.
Das Auftauchen eines von Magie umgebenen Grünen Ritters und eines möglicherweise magischen Gürtels dienen Tolkien als Beleg, dass es sich um ein Märchen handelt. Heute würden wir von „Fantasy“ sprechen. Außerdem kommt in dem Text auch die arthurische Hexengestalt Morgan le Fay vor – sie ist die düstere Gestalt an der Seite der Burgherrin. Sie hat also ihre Finger im Spiel.
Der brave Ritter Gawain verflucht nach dem Showdown an der Grünen Kapelle – sorry, er stirbt nicht – alle Frauen, was nun wirklich ungerecht ist. Er verflucht seine eigene Feigheit, die ihn verwundbar für ihre Versuchung gemacht hat. Das ist ebenfalls ungerecht, denn er hat ja drei Tage lang tapfer standgehalten, wie es ihm die höfische Sitte gebot, und seinen Burgherrn nicht verraten, wie es ihm die christliche Moral gebot. Es nun einfach mal so, dass Gawain ein Opfer seiner eigenen ethischen Maßstäbe geworden ist, die er nur zum Teil erfüllen kann, da sie sich in etlichen Punkten widersprechen.
Diese Widersprüche und ihre Folgen aufzuzeigen, ist der Zweck, für den das Epos geschrieben wurde. Ob es wohl geholfen hat? Wir können es natürlich nicht wissen. Aber Zweifel dürften angebracht sein.
Der Essay
Tolkiens sechzig Seiten langer Essay plus Postskriptum zu „Sir Gawain“ ist ein kleines Meisterstück. Dieser Vortrag, den er an einer nicht näher bezeichneten akademischen Institution gehalten hat, ist recht anspruchsvoll, sowohl in der Gedankenführung als auch in der Sprache und Terminologie. Aber weitaus verständlicher als so manche akademische Arbeit, die nach dem 2. Weltkrieg geschrieben wurde. Wie erwähnt, hatte Tolkien den „Gawain“ schon 1925 veröffentlicht. Außerdem ist sein eigener Kommentar bzw. Anmerkungsteil angehängt, den er beifügte, als „Gawain“ 1953 von der BBC im 3. Programm gesendet wurde. Mehr Erklärungen kann der heutige Leser eigentlich nicht verlangen.
Tolkien erklärt zunächst den Aufbau des „Gawain“ und stellt eine These auf: Dies ist keine moralische Allegorie, sondern ein tief verwurzeltes Märchen. Dann macht er sich daran, relevante Gründe und Textstellen anzuführen, um seine These zu belegen. Seine Argumente sind in meine obige Analyse eingegangen, brauchen also nicht noch einmal wiederholt zu werden. Natürlich ist Tolkiens Argumentationskette viel feiner aufgebaut und besser formuliert, als ich dies im Rahmen einer Buchbesprechung tun kann. Dafür braucht er aber auch sechzig Seiten.
Tolkien spricht als Philologe, nicht als Linguist oder moderner Literaturwissenschaftler. Er setzt sich mit seinen Vorgängern auseinander, die er zuweilen |ad absurdum| führt, und vertritt seine eigene Einschätzung. Hier verlässt er die exakte Wissenschaft, die die Philologie wohl ohnehin nie war, und betritt das weite Reich der persönlichen Interpretation. Das ist legitim, denn der Autor des „Gawain“ bezieht keine eindeutige Stellung, wie sein Held zu beurteilen ist. Allerdings sprechen auch die Gründe, die Tolkien für seine Deutung mancher Stellen anführt, für seine Sichtweise. An keiner Stelle artet sein Essay in trockenes Haarespalten aus. Und am Schluss haben wir einen tieferen Einblick in ein für das englische Mittelalter essenzielles Werk gewonnen.
Und zudem hat Tolkien es geschafft, in uns Sympathie für jenen ach so vollkommen scheinenden Ritter Gawain zu wecken, der an seinen Ansprüchen an sich scheitern muss. Doch diese Ansprüche wandeln sich mit den Epochen, und selbst das Verständnis, das Tolkien 1925 oder 1953 dem Helden entgegenbringt, könnte so manchem heutigen Leser ein Kopfschütteln abringen: Diese Moral, dieser Anstand, diese Sitte! Herrje, haben wir mit diesen alten Zöpfen nicht schon 1968 Schluss gemacht? Es sieht manchmal so aus, doch andererseits feiern die alten Werte wie Treue, Loyalität und Aufrichtigkeit ein Comeback. Wäre es anders, wären wir nicht besser als die Versucherin und die Hexe Morgan le Fay (die vermutlich ein und dieselbe sind): Wir würden dann beispielsweise die neu in die EU eingetretenen Länder und ihre Menschen alle aufs Kreuz zu legen versuchen. Und das wäre wirklich fies, oder?
Die Übersetzungen von Text und Essay
Hans J. Schütz hat auf Seite 97 eine Nachbemerkung eingefügt. Wir erfahren mehr über das Werk und seine Bedeutung, sowohl im literarischen Kontext als auch in seiner Aussage. Schütz erwähnt, dass das moralische Dilemma, in dem sich Gawain verstrickt, nicht durch den Autor beseitigt, sondern in einer Ambivalenz belassen wird, „was zu zahlreichen Deutungen geführt hat“ – mit denen sich Tolkien oben auseinandersetzt.
Sodann führt Schütz die diversen englischen Ausgaben des Originals und die Übersetzungen auf. Wirklich erstaunlich ist die Tatsache, dass die erste deutsche Übersetzung erst durch Manfred Markus (Stuttgart) im Jahr 1974 erfolgte. Diese orientiere sich sehr stark am Originaltext, liefere aber nicht die Vorlage für die Prosaübersetzung durch Schütz. Dafür sei vielmehr Davis‘ Mittelenglisch-Übersetzung aus dem Jahr 1967 die Grundlage gewesen (und nicht etwa Tolkiens eigene Übersetzung). Ein kluger Schachzug, denn Schütz lässt sowohl philologische Genauigkeit als auch verklärende Nachdichtung – mit allen stilistischen und sprachlichen Eigenheiten – links liegen, um eine möglichst lesbare und modernen Lesern verständliche Prosafassung vorzulegen.
Die akademischen Geister mögen über den Wert einer solchen Fassung streiten. Den Leser, der mit Akademien nichts am Hut hat, sich aber für literarische Meisterwerke – auch der Fantasy – begeistern kann, wird die Prosafassung aber durch eine verständliche Textgestalt und eine spannende Handlung unterhalten. Überkandidelten Stilfiguren wird hier eine Absage erteilt, so dass man sich beim Lesen auf die Story konzentrieren kann, ohne sich viel um die Form kümmern zu müssen.
Unterm Strich
Die sehr lesbare Prosafassung der mittelenglischen Verserzählung mag den Fantasyleser als klassisches Werk dieses Literaturzweigs ebenso interessieren wie als Werk des arturischen Legendenkreises. Letzten Endes halten sich jedoch die phantastischen Elemente dessen, was Tolkien als „Märchen“ zu bezeichnen beliebt, ein wenig in Grenzen. Statt wie sonst den Helden als magiebegabt dazustellen, ist es umgekehrt: Der Held wird Opfer der Magie von Morgan le Fay und muss sich mit den verfügbaren Mitteln verteidigen.
Diese bestehen (in drei Kategorien) einerseits aus höfischer Sitte und Anstand, andererseits aber aus christlichen Moralgesetzen. An den Widersprüchen dieser Vorgaben scheitert unser braver Ritter, und das dient dem Autor zur Kritik an den höfischen Wertvorstellungen seiner eigenen Zeit – nach dem Motto: Erziehen wir unsere künftigen (Thron-)Erben eigentlich nach den richtigen Idealen? Keine müßige Frage. Sie stellt sich jedem frischgebackenen Elternpaar aufs Neue.
Tolkiens Essay spricht wohl eher Leser mit literaturwissenschaftlichen Interessen an, ist aber durchaus verständlich formuliert und mit Anmerkungen erweitert. Die beiden Übersetzer haben jedenfalls in ihrer jeweiligen Kategorie saubere Arbeit geleistet. Ich konnte keine Fehler finden. Nur manchmal fiel es mir schwer, im Text die Hochzahl zu einer bestimmten Anmerkung zu finden. Sie sind mitunter in den zitierten Versen versteckt oder unter den Angaben, an welcher Stelle der 2500 Zeilen des Gedichtes man sich gerade befindet.
Gebunden: 168 Seiten.
O-Titel: Sir Gawain and the Green Knight
Aus dem Englischen von Wolfgang Krege.
ISBN-13: 978-3608932638
Der Autor vergibt: